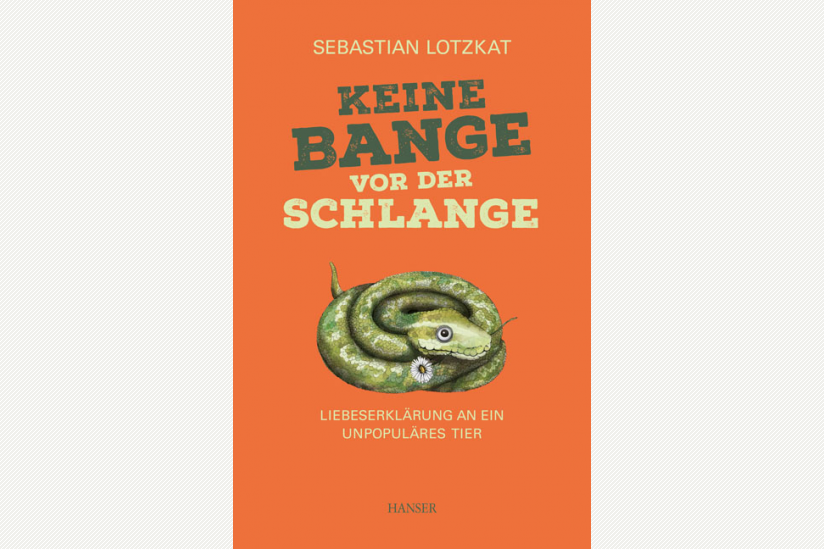Sebastian Lotzkat scheut vor nichts zurück. Als Science-Slammer kämpft er mit Fünf- bis Zehnminuten-Vorträgen landauf landab um den Siegerpreis eines meist studentischen und akademischen Publikums für seine Darbietungen und wirbt um Verständnis für das Objekt seiner wissenschaftlichen Neugier: die Schlangen. Auch in seinem Erstlingswerk "Keine Bange vor der Schlange" tut er das routiniert wie ein Entertainer vom Club Méditerranée.
Wie vertreibt man am wirkungsvollsten eine Schlange? Jawohl, mit Hüpfen, am besten noch dazu über dem Kopf mit den Händen klatschen. Das lässt uns von der Bodenperspektive aus ein wenig größer aussehen. Vor allem lässt das Stampfen vermuten, dass sich mindestens eine Elefantenherde nähert. Lotzkat, der Schlangenversteher, der sie in Panama für seine Promotion erforschte und am Senckenberg-Museum als Museumsführer arbeitet, kennt sich aus mit der Schlangensicht auf die Welt. Und macht dem Leser gleich klar, dass man Schlangen eigentlich (fast) nie vertreiben sollte und es auch nicht zu tun braucht. Denn sie werden weit eher vor Menschen die Flucht ergreifen und nur dann zubeißen, wenn ihnen der Fluchtweg abgeschnitten wird.
Von wegen sehen. Nein, das können Schlangen nicht besonders gut. Dafür verfügen sie gleichsam über Wärmebildkameras: Grubenorgane jeweils zwischen Augen und Nasenlöchern verschaffen ihnen eine Wahrnehmung der belebten und unbelebten Gegenstände im Raum über eine ausgeprägte Fähigkeit, minimalste Wärmeunterschiede zu sondieren und zu orten. Für die Jagd im nächtlichen Tropenwald nützlich. Außerdem erriechen beziehungsweise erschmecken sie sich die Welt, die vielfältigen Aromen. Deshalb züngeln sie. Hören können Schlangen über den ganzen Körper, da sie über kein Trommelfell verfügen.
Diese so ganz unterschiedlichen "Lebensentwürfe", wie Sebastian Lotzkat es nennt, sind es, die ihn an den Schlangen faszinieren. Giftschlangen, die sich als Schlingpflanzen tarnen, und harmlose Nattern (die meisten), von denen sich einige als Giftschlagen tarnen, um nicht ihrerseits gefressen zu werden. Oder beides kombiniert. Schlangen, die sich oben tarnen, aber bei Gefahr auf den Rücken drehen, um mit einem grell farbigen Streifenmuster auf der Unterseite vor sich zu warnen und dabei – alles Bluff – ungefährlich sind, wie die mittelamerikanische Natter Rhadinaea calligaster. Sogar die Farbe wechseln können Schlangen wie ein Chamäleon, nur viel langsamer. Tagsüber unauffällig braun und nachts fast schwarz gefleckt auf weißem Grund gibt sich die die kubanische Zwergboa.
Schlangen sind Beutegreifer. Einige können auf Bäume klettern und suchen auch aktiv nach ihren Opfern, Nestern oder Nagern, wie die ungiftige liebenswürdige Äskulap-Natter, andere warten tagelang zusammengerollt auf ihrem Platz, bis ihnen die Beute in den Mund läuft, wie die Klapperschlange. Wenn es sein muss, sind Schlangen auch Hungerkünstler. Eine Madagaskar-Boa soll 49 Monate ohne Nahrung durchgehalten haben.
Es gibt kaum Lebewesen, die ihre Nahrung derart effizient nutzen wie die Schlangen. Dafür haben sie vieles reduziert. So finden sich bei ihnen von den bei fast allen Wirbeltieren paarig vorhandenen Organen wie Lunge und Nieren nur jeweils eines. Schultern und Lendenknochen fehlen genauso wie die Gliedmaßen. Nur bei den Riesenwürgeschlangen wie der Anakonda werden noch ansatzweise Lendenknochen ausgebildet. Sie sind also die ältesten unter den Schlangen.
Schlangen sind wenig gesellig und betreiben keine Brutpflege, wie einige Arten unter den Fischen, Krokodilen oder Chamäleons es tun. Unsere heimische Kreuzotter gehört immerhin zu den Lebensgebärenden, das heißt, die Schlängelchen verlassen den Mutterleib in dem Moment, in dem sie das Ei verlassen. Viele Schlangen wärmen allerdings die Eier mit ihrem Körper. Die absolut ungiftigen und mit ihren gelben Halbmonden hinter dem Kopf wunderschönen Ringelnattern wissen, dass mitunter gärende Komposthaufen ihnen die Arbeit abnehmen, und nutzen das gern.
Eines macht allerdings selbst Schlangen gesellig: die Kälte. Oft überwinterten früher, als Schlangen noch verbreiteter waren, selbst Schlangen verschiedener Arten, ja, sogar gemeinsam mit Kröten, eigentlich ihre Beute, gemeinsam unter Baumstämmen oder Steinen – daher vielleicht die Metapher von der Schlangengrube.
Aber Schlangen vertilgen auch Ratten, Mäuse, Schnecken und Raupen, unsere Nahrungskonkurrenten. Ihr Gift lässt sich als Herzmittel nutzen.
Wenn auf der Welt die Fälle von Schlangenbiss zunehmen, dann liegt das daran, dass die Zahl der Menschen zunimmt, und wir immer mehr in die Territorien der Schlangen eindringen oder sie reduzieren. Durch Überschwemmungen etwa infolge der Klimaveränderungen. Da retten sich Mensch und Tier auf das verbleibende trockene Land. In Bangladesh sind bei Überflutungen daher Schlangenbisse die zweithäufigste Todesursache nach dem Ertrinken.
Schlangenbisse treffen fast immer die Armen. Die bei der Landarbeit mit den Händen dem Boden nahekommen, die unter Strohdächern unter unverschlossenen Hütten leben. Armutsbekämpfung wäre daher das Beste, was man zur Prävention von Schlangenbissen tun kann. Da hat Sebastian Lotzkat sicherlich recht.
Sebastian Lotzkat: "Keine Bange vor der Schlange. Liebeserklärung an ein unpopuläres Tier", Hansa Verlag München 2016, 292 S. 19,90 Euro