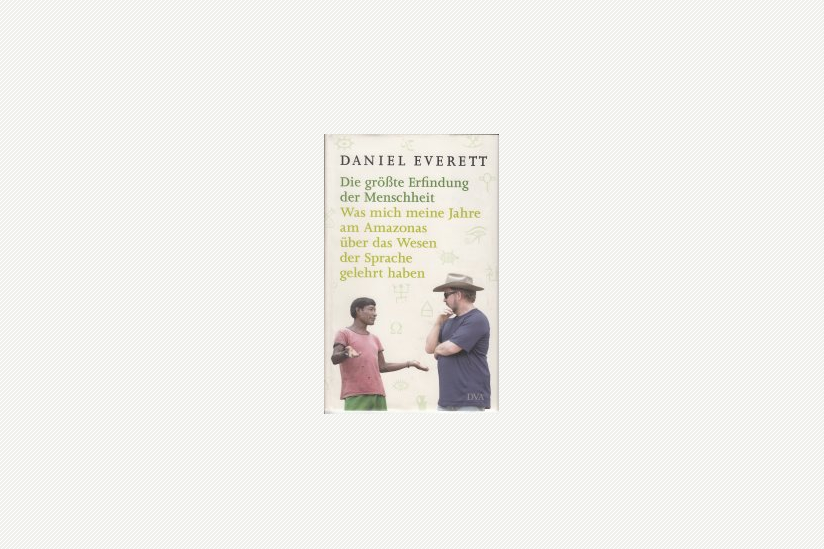(hpd) Es gibt Sprachen, die ganz anders funktionieren als unsere. Die Pirahā am Amazonas zählen nur bis zwei und bilden keine Verben in der Vergangenheitsform, auch nicht in der Zukunftsform. Dafür erfordert es ihre Grammatik, bei jedem Ereignis, über das sie reden, anzugeben, ob sie es selbst gesehen oder gehört, von jemandem anderen erfahren haben oder aus Anzeichen schließen. Woher kommen die Sprachen und woher kommen ihre Unterschiede, fragt sich Daniel Everett.
Ende der Siebziger reiste Daniel Everett zum ersten Mal zu den Pirahā, als er, wie er in seinem Buch "Die größte Erfindung der Menschheit. Was mich meine Jahre am Amazonas über das Wesen der Sprache lehrten" schreibt, "noch Christ und Missionar war". Er beschäftigte sich viele Jahre mit der Sprache und der Lebensweise dieses nur einige hundert Menschen zählenden Völkchens. Statt schließlich von einem Glauben überzeugen zu wollen, wurde er zum Forscher. Heute lehrt er als Professor und Dekan des Bentley Colleges bei Boston Linguistik und Anthropologie. Was alle Sprachen gemeinsam haben und warum sie sich unterscheiden, diese Fragen ließen ihn nicht mehr los. Seine in der Praxis gewonnenen Erkenntnisse bringen etablierte Sprachtheorien ins Wanken.
Eine Pirahā-Mutter wird die Frage, wie viele Kinder sie habe, nicht beantworten können, wenn es mehr als zwei sind. Dennoch kann sie den Namen jedes ihrer Kinder sagen, wahrscheinlich auch, wo sie gerade sind und ob sie in Sicherheit sind. Für die Farbe Rot haben die Pirahā kein spezifisches Wort, genauso wenig wie sie Grün von Blau unterscheiden. Sie werden aber nach der Farbe eines Gegenstandes befragt, den wir als rot bezeichnen, sagen, er habe die Farbe von Blut, zu eine grünen Frucht, sie sei unreif. Eine Wegangabe wird ein Pirahā nicht mithilfe der Angaben von rechts und links formulieren, denn diese Wörter fehlen im Pirahā; er wird zum Beispiel erklären, dass man stromaufwärts gehen müsse, dann in Richtung eines bestimmten markanten Baumes und so weiter. Die Orientierung erfolgt nicht vom eigenen Körper aus betrachtet, sondern anhand der Topologie eines Raumes. Eine weitere Überraschung: Die Pirahā haben zusätzlich eine Summ- und außerdem eine Pfeifsprache, in denen Vokale und Konsonanten Tonhöhen entsprechen.
Inzwischen haben Forscher Gehirnregionen, das Broca- und das Wernicke-Areal, ausfindig gemacht, die immer dann aktiv sind, wenn gesprochen wird. Aber was ist in ihnen verankert, wie wurde es verankert – tatsächlich genetisch? - und dienen sie ausschließlich dem Sprechen? Vieles spricht heute dafür, dass diese Gehirnregionen auch für einige andere Aspekte der Handlungskoordination zuständig sind. Ist in jenen Gehirnarealen also wirklich eine Urgrammatik verankert, eine Minimalstruktur, die allen Sprachen gemeinsam ist? Und gibt es diese Struktur überhaupt, wie sie erstmals 1957 von Noam Chomsky á la Platon proklamiert wurde? Chomsky stellte die These auf, dass jeder Satz über ein Subjekt und ein Prädikat verfügen müsse, um Sinn zu machen, beziehungsweise auf sie rückführbar wäre - was Aristoteles auf der Ebene der Logik auch schon dachte. Everett hält es ebenfalls frei nach Aristoteles für viel wichtiger, dass jede Sprache erst zu einer solchen wird, indem sie die Möglichkeit zu Erweiterungen eröffnet. Sie werden bei den Pirahā jedoch nie innerhalb eines Satzes erfolgen. Trotzdem wird jede Erzählung eine Menge von ihnen enthalten. Ohne sie ist erzählen nicht möglich.
Daniel Everett listet zusätzlich eine Reihe weiterer Konditionen auf, die Sprechen stets aufweist. Sprechen setzt ein Bewusstsein voraus (nicht unbedingt ein Selbstbewusstsein) und eine Absicht. Und Sprache operiert mit Bedeutungen. Sie benutzt Symbole.
Durch das Sprechen werden Ereignisse voneinander isoliert (der "Papagei" vom "Baum" etwa) und miteinander verbunden ("Der Mond erleuchtet den Urwald" - die Pirahā setzen für das undurchdringliche Walddickicht im Übrigen dasselbe Wort wie für jegliche Umgebung schlechthin ein). So entstehen Urteile über Vor- und Hintergrund und Kontingenz, wie Everett es nennt.
Wer spricht, will etwas sagen, was seiner Umgebung entspricht; sein Wissen mit ihr in Übereinstimmung bringen, wenn er fragt; anderen ermöglichen, durch eine Information ihr Wissen in Übereinstimmung mit der Umgebung zu bringen oder ihr Verhalten ihr entsprechend zu ändern. Diese Absicht kommt immer vor dem Sprechen.
Für die Entstehung der Sprache heißt das: Ihr Motor ist ein überaus mächtiger Instinkt zur Interaktion und Kommunikation, konstatiert Everett, jedoch kein spezifischer Sprachinstinkt. Was unterschiedliche Menschengruppen daraus machen, hängt von der Umwelt und ihren Bedürfnissen ab, und ihrer Kultur. Die Pirahā sprechen nur über die unmittelbare Gegenwart, etwas anderes hat für sie keinen Sinn. Und für etwas anderes brauchen sie auch keine Grammatik. Soweit Everett erfuhr, erzählen sie sich auch keine Mythen, über die Entstehung der Welt etwa, und ersehnen oder fürchten kein Weltende. Nicht zufällig titelte man 2010 Everetts erstes Buch über die Pirahā auf Deutsch: "Das glücklichste Volk".
Was einer Gemeinschaft unabdingbar ist, ist dennoch nicht unbedingt, was ihre Mitglieder aussprechen. Manchmal tun sie es gerade nicht. Dabei kann dann selbst das Subjekt-Prädikat-Prinzip durchbrochen werden. Für "geben" haben die Papua kein Wort. Wahrscheinlich, weil es in ihrer Gesellschaft so selbstverständlich ist, dass es nicht gesagt werden muss. Die Folge ist, dass in solchen Sätzen, in denen von Geben die Rede ist, eben kein Verb, sondern nur Subjekt und Objekt vorkommen, entsprechend dem Schema "Paul Fritz Banane." Die Wari´, ein von Everett ebenfalls studiertes Indio-Volk in Brasilien, benutzen das Wort "sagen" nicht. Sie würden zum Beispiel folgende Aussage als vollständig empfinden: "Paul kommt bei Sonnenaufgang. Paul seiner Mutter".
So sehr Sprache mit der Lebensweise zusammenhängt, sie tut es nicht notwendig unmittelbar. Everett berichtet von einem Nachbarvölkchen, den Banawá, bei dem nicht wie bei den Pirahā und den meisten Sprachen der Welt das grammatikalische Geschlecht im Plural maskulin ist (etwa: "die Jäger und Sammler", wenn unter denen, von denen die Rede ist, wenigstens ein Mann ist. Diese Ethnie benutzt die Femininform, solange mindestens eine weibliche Person zugegen ist. Was nicht heißt, dass den Frauen bei den Banawá eine beneidenswerte Rolle zukäme. Im Gegenteil – die Initiationsriten der Banawá bestehen darin, dass die zur Geschlechtsreife gelangten Mädchen erst wochenlang eingesperrt und anschließend von den Männern ihrer Sippe fürchterlich verprügelt werden.
Könnte es sein, dass die Pirahā ihre Mythen nicht thematisierten, weil sie ihnen selbstverständlich waren – so selbstverständlich, dass sie sie, weil nicht mehr über sie gesprochen wurde, vergessen haben?
Everett versteht seine Forschungsergebnisse antithetisch zu Chomsky, aber liegen die beiden tatsächlich so weit auseinander? Chomsky geht von einer universellen Grammatik aus. Doch Chomsky äußert sich einzig als Linguist, die Frage der biologischen Voraussetzung der Entstehung dieser Grammatik liegt schon deshalb außerhalb seiner Fragestellung, weil "universell" eben heißt: Ohne eine solche Grammatik wäre sinnvolles Sprechen nicht möglich. Sie selbst kann deshalb rein logisch nicht mehr hinterfragt werden. Punktum. Die Frage, wo und wie sie lokalisiert ist, überließ er anderen - empirischen - Forschungsbereichen. Die Gegenposition nahm 1975 John Langshaw Austin ein, nach der Sprechen ein "Sprechakt" ist, was, wenn man noch weiter zurückgehen will, auf der Erkenntnis von Ludwig Wittgenstein fußt, derzufolge sprechen immer nur in einem Handlungszusammenhang Sinn macht. "Was ist aber die Bedeutung des Wortes 'fünf'? Von einer solchen war hier gar nicht die Rede; nur davon, wie das Wort 'fünf' gebraucht wird", schrieb Wittgenstein 1953 in den "Philosophischen Untersuchungen".
Sprache liefert Bedeutungen, so Everett. Eine Handlung unterscheidet sich von einem Geschehen gerade dadurch, dass sie eine Bedeutung hat, so einige analytische Handlungstheoretiker wie James Opie Urmson und Herbert Lionel Adolphus Hart. Es wäre zirkulär, diese aus der Handlung zu schließen, würden sie vielleicht einwenden. Aber unter Umständen ist die Wirklichkeit eben nur zirkulär zu beschreiben.
Sprache funktioniert so wie sie muss, und dies zunächst als Erkenntnisinstrument. Denken funktioniert allerdings auch ohne Sprechen, meint schließlich Everett, sonst hätten Menschen nie Sprache entwickeln können. Sie ist vor allem eines: ein Werkzeugkasten – der Erkenntnis, die wir beim Handeln benötigen. Die Evolution stellte dafür schließlich mit der Veränderung des Kehlkopfes und der weiteren Fortentwicklung des Gehirns die immer adäquateren Mittel, immer funktionstüchtigere Organe, zur Verfügung.
Daniel Everett: „Die größte Erfindung der Menschheit. Was mich meine Jahre am Amazonas über das Wesen der Sprache lehrten“. Deutsche Verlagsanstalt München 2013, 463 Seiten 24,99 Euro