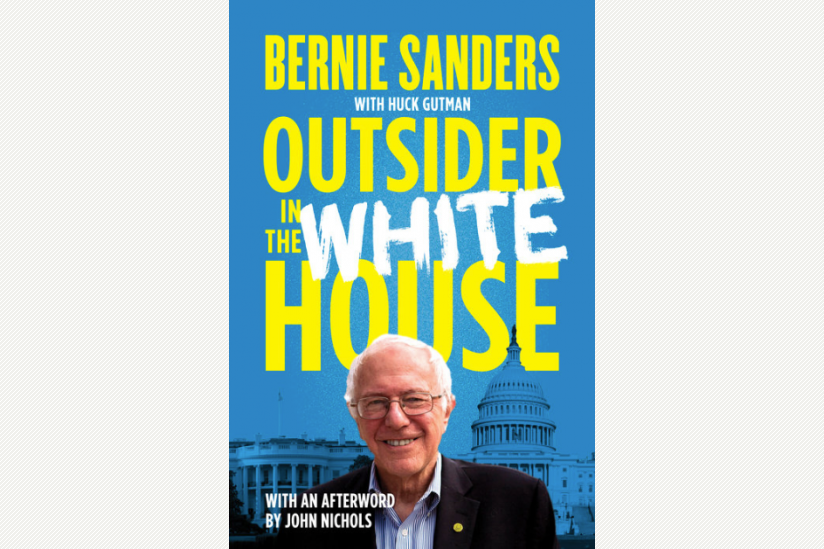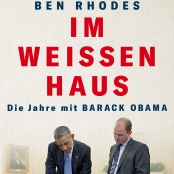BONN. (hpd) Der 74jährige Senator von Vermont Bernie Sanders ist der aktuell bedeutendste Konkurrent von Hillary Clinton um die Nominierung als Kandidat der Demokraten für die US-Präsidentschaftswahlen 2016. Unter dem Titel "Outsider in the White Hose" liegt eine Neuausgabe der politischen Autobiographie des bekennenden demokratischen Sozialisten vor.
Bei den Bewerbern um die Kandidatur zur US-Präsidentschaft bei den Demokraten gibt es einen Außenseiter, der doch noch realistische Chancen hat. Der mittlerweile 74jährige Senator von Vermont Bernie Sanders, der ohne Parteimitgliedschaft als Unabhängiger antritt. Allein dies ist schon ungewöhnlich. Noch ungewöhnlicher ist, dass sich Sanders als demokratischer Sozialist versteht. Er möchte Amerika skandinavischer machen und sieht ein Vorbild in den nordeuropäischen Wohlfahrtsstaaten.
In den Umfragen liegt Sanders auf Platz 2 noch hinter Hillary Clinton, hat aber in den letzten Monaten aufgeholt und den Abstand verringert. Bei seinen Reden, die mittlerweile Zehntausende anziehen, kritisiert er in scharfer Form den Einfluss der Superreichen auf die Politik und die wachsende soziale Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Wer mehr über diesen ungewöhnlichen Politiker erfahren will, kann jetzt zu seiner politischen Autobiographie greifen. Dabei handelt es sich um eine Neuausgabe von 1997 mit dem geändertem Titel: "Outsider in the White House".
Im Vorwort macht Sanders nicht nur auf seine politischen Grundpositionen aufmerksam, er formuliert auch einen anderen Politikstil: "Wenn ich gewählt werde, will ich nicht nur für Euch arbeiten, ich will mit Euch arbeiten" (S. XIII). Angesichts seiner Außenseiter-Position muss Sanders denn auch auf die Unterstützung einer "Graswurzel-Bewegung" setzen. Ohne eine solche dürfte er gegenüber den finanziellen Mitteln seiner Konkurrenten keine Chance haben. Derartige Erfahrungen hatte er durch sein ganzes politisches Leben machen müssen.
Bereits in den 1970er Jahren kandidierte Sanders für diverse Ämter, erhielt aber allenfalls zwischen 1,5 und 6,1 Prozent der Stimmen. 1981 konnte er aber einen Erfolg erzielen, wurde Sanders doch denkbar knapp zum Bürgermeister von Burlington in Vermont gewählt. Bei den nächsten Wahlen konnte er mit noch weit größeren Abständen gewinnen. Bei der Kandidatur für den Senat erhielt Sanders in Vermont 2004 65,4 Prozent und 2012 sogar 71 Prozent der Stimmen – und dies als bekennender demokratischer Sozialist in den USA.
Seine politische Autobiographie berichtet über die damit einhergehenden Entwicklungen. Erstaunlicherweise erfährt aber wenig über die Erfahrungen und Gründe, die Sanders in jungen Jahren in die Politik trieben. Die Lektüre von Dewey, Jefferson und Lincoln kann es ebenso wenig allein gewesen sein wie die von Debs, Fromm und Marx (vgl. S. 17). Insbesondere Eugene V. Debs, der Anfang des 20. Jahrhunderts fünfmal als Sozialist für das Amt des US-Präsidenten kandidierte, habe ihn beeindruckt (vgl. S. 27). Dieser definierte sich indessen selbst als revolutionärer Sozialist, während Sanders sich als reformerischer Sozialist versteht. Ausführlich beschreibt er, wie Bündnisse in Kampagnen zwischen verschiedenen Gruppen von Bürgerinitiativen bis zu Gewerkschaften geschlossen wurden. Sie bildeten den Grundstock für die Wahlerfolge. Sanders veranschaulicht aber auch immer wieder, wie finanzkräftige Konkurrenten mit Negativ-Kampagnen gegen ihn punkten wollten. Letztendlich scheiterten sie jedoch trotz der Hilfe des Establishments ihrer Partei.
Im Buch abgedruckt sind auch Auszüge aus einer Rede, die bei der Kampagne für einen Senat-Sitz von Sanders gehalten wurde. Darin finden sich Aussagen, die er auch heute noch nutzt: "Eine Wirtschaft in welcher es allen Bürgern gut geht, nicht nur den sehr reichen" (S. 58). Oder: "Wir können nicht weiterhin eine der höchsten Raten von Kinderarmut in der Welt haben, während die Zahl der Millionäre und Milliardäre ansteigt" (S. 61). Doch für die Wiederholung von jahrzehntealten Aussagen gibt es einen guten bzw. schlechten Grund: Es hat sich daran kaum etwas geändert. Ablehnung und Unmut über so viel soziale Ungerechtigkeit ziehen sich denn auch durch das Buch. Darüber hinaus berichtet Sanders von seinem Engagement für einen Mindestlohn ebenso wie von seiner Stimme gegen den Irak-Krieg zu Beginn der 1990er Jahre. Sanders erörtert auch die Frage, warum so viele Menschen etwa bezogen auf die Gesundheitspolitik entweder gegen ihre eigentlichen Interessen wählen oder sich ganz aus dem politischen Wahlsystem zurückgezogen haben.
Demgegenüber fordert er eine Re-Vitalisierung der Demokratie und benennt dafür konkrete Vorschläge. Auch diese alten Ideen sind von bleibender Aktualität, da sich an den Gegebenheiten kaum etwas geändert hat. Dabei geht es um Änderungen in der Bildungspolitik, Entmonopolisierung der Medien, Einführung von Krankenversicherungen, Stärkung der Gewerkschaften, Steuererhöhungen für Reiche oder Steuersendungen für Ärmere. Auch für die Finanzierung macht Sanders einige Vorschläge und verweist etwa auf die hohen Militärausgaben. Dies alles würde wohl in der Tat eine "politische Revolution" bedeuten, welche Sanders bezogen auf den Bruch der Dominanz von Superreichen deutlich einfordert: "… und dieses Land wird dann allen von uns gehören" (S. 304). Eine derart scharfe Kritik an den sozialen Zuständen in den USA hat man von einem relevanten US-Politiker lange nicht mehr gehört – vielleicht zuletzt von Robert F. Kennedy 1968. Sanders legt als patriotischer Amerikaner die Finger in die Wunde eines sozial auseinander driftenden Landes.
Bernie Sanders with Huck Gutman, Outsider in the White Hose, London – New York 2015 (Verso-Verlag), 346 S., 16,95 US-Dollar