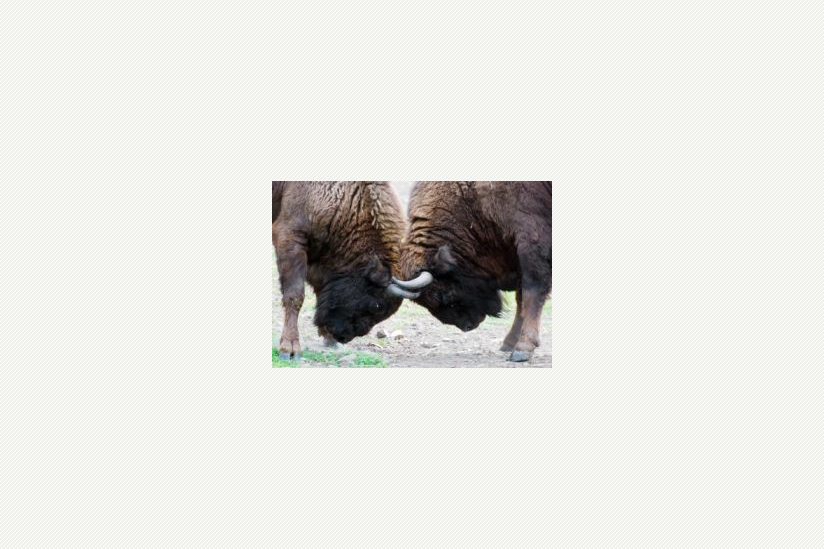WIEN. (hpd) Am 12. Februar haben sich die Februarkämpfe von Teilen der sozialdemokratischen Arbeiterschaft gegen die faschistische Regierung unter Bundeskanzler Engelbert Dollfuß zum 77. Mal gejährt. Der Aufstand war die erste bewaffnete Aktion gegen eine faschistische Regierung – und ein Verzweiflungsakt, mit dem die de facto schon abgeschaffte Republik hätte gerettet werden sollen. Die Gräben dieser Kämpfe ziehen sich bis heute durchs Land.
In Österreich sind sogar die Autofahrerklubs nach Parteien aufgeteilt, lautet eine gerne geäußerte sarkastische Kritik vor allem aus Deutschland. Der ÖAMTC, der größte Klub, gilt als eher konservativ, der kleinere ARBÖ ist eine sozialdemokratische Domäne. Eine Spaltung, die ein klassisches Relikt der Zwischenkriegszeit ist. Das gilt, in abgemilderter Form, für die beiden Rettungsorganisationen Rotes Kreuz und Arbeitersamariterbund, das gilt in gesteigertem Maß für die Sozialdienste der großen Parteien. Die ÖVP hat ganz offiziell das Hilfswerk, die SPÖ die Volkshilfe.
Bis vor wenigen Jahren galt das auch für den Bankensektor. Allein, das rote Bankenimperium ist heute Geschichte. Die BAWAG als seine letzte Bastion gehört dem US-Fonds Cerberus. Der ÖGB musste sich während des BAWAG-Skandals von der Bank trennen, die einst als „Arbeiterbank“ in der ersten Republik ein Pendant zum schwarzen Raiffeisen-Sektor sein sollte. Für Gewerkschafter war es Ehrensache, dort ein Konto zu haben.
„Grüß Gott“ versus „Guten Tag“
Selbst beim Grüßen zieht sich ein tiefer Graben durch das Land. Wobei das „Grüß Gott“ eine ambivalente Rolle spielt. Vor allem in ländlichen Gegenden wurde es als Gegenstück zum als deutsch empfundenen „Guten Tag“ vom katholischen zum österreichischen Gruß schlechthin, beinahe zur patriotischen Pflicht umstilisiert. Was bei Sozialdemokraten (wie auch bei Grünen und den wenigen Liberalen) regelmäßig für Irritationen sorgt, wenn ein Parteimitglied oder Sympathisant aus den Bundesländern mal fröhlich mit „Grüß Gott“ grüßt. In diesen Kreisen verwendet man bewusst das nicht-katholische „Guten Tag“. (Das „Freundschaft“ ist bei österreichischen Sozialdemokraten für den internen Gebrauch reserviert.)
Das sind nur einige beinahe anekdotische Beispiele. Vielfach mutet es an wie die Situation zwischen Real Madrid und FC Barcelona. Und so unähnlich sind sich Spanien und Österreich in der Lagerbildung nicht. Auch wenn der Faschismus in Österreich schon 1945 sein Ende fand. Die Christlich-Sozialen gründeten sich flugs als ÖVP neu und wollten mit der eigenen Diktatur, dem so genannten Ständestaat, zwischen 1933/34 und 1938 so gar nichts mehr zu tun haben. Ungeachtet dessen, dass ihre Spitzenfunktionäre nach 1945 zum Teil tragende Rollen im klerikalfaschistischen Regime bis 1938 gespielt hatten. Mit dem Dollfuß-Kult machte man munter weiter. Der Errichter der Diktatur war bei einem versuchten Nazi-Putsch 1934, wenige Monate nach dem Februar-Aufstand der Sozialdemokraten, erschossen worden und gilt seither in weiten Teilen des konservativen Lagers als Märtyrer für ein unabhängiges Österreich. Sein Bild hängt bis heute in den Räumen des ÖVP-Klubs im österreichischen Parlament. Links neben dem Kreuz.
Historisch gewachsenes Misstrauen
Und ging mit der These der „geteilten Schuld“ hausieren. Die Sozialdemokraten seien auch irgendwie selbst schuld gewesen, an dem, was passierte. Gerne wird aus dem Linzer Parteiprogramm der Sozialdemokratie zitiert, wonach diese eine „Diktatur des Proletariats“ habe errichten wollen. Dass der entsprechende Passus eindeutig rein defensiv formuliert ist, für den Fall, dass sich die damals schon teils paramilitärisch organisierte konservative Reichshälfte einer sozialdemokratischen Bundesregierung nach erfolgreichen Wahlen gewaltsam widersetzen würde, wurde wohlweislich verschwiegen.
Auf der Gegenseite erzeugt das bis heute kein sonderliches Vertrauen. Auch wenn man, anders als in Deutschland, seit 1945 die meiste Zeit mit den Konservativen eine Regierung bildete – richtig warm wurden die Sozialdemokraten nie. Und im Extremfall gab es einige Genossen, die, wohl aus subjektiv-biografischen Gründen, den Nazis weniger nachtrugen als den Klerikalfaschisten. Der schwarze Terror sei schlimmer gewesen als der braune, waren einige überzeugt. Bis heute gibt es Stimmen in der Sozialdemokratie, die in der rechtslastigen FPÖ eher einen Koalitionspartner sehen als in der ÖVP. Und das nicht nur aus taktischen Überlegungen oder aus – auch bei Teilen der SPÖ-Basis vorhandenen – gemeinsamen Ressentiments gegen Migranten heraus. Auf ÖVP-Basis ist die Liebe zur FPÖ etwas abgekühlt. Zu frisch sind die Erinnerungen an die gemeinsame Koalition zwischen 2000 und Anfang 2007, in der sich die FPÖ samt ihren diversen Absplitterungen eher durch internes Chaos ausgezeichnet hatte. Was nicht heißt, dass nicht gewisse Teile der Schwarzen die FPÖ und wahlweise das BZÖ als Koalitionspartner präferieren würden.
Bis ins Schlagerfach gespalten
Es war gerade der Tabubruch der ÖVP, die FPÖ in die Regierung zu holen, der die alten Konflikte wieder aufbrechen ließ. Seitdem es wieder große Koalitionen gibt, hat man den Eindruck, die Großparteien würden einander ständig belauern, auf einen Fehler des jeweils anderen warten, um reflexartig eine Gegenposition einnehmen. Zuletzt zu beobachten beim Thema Wehrpflicht. Aus verschiedenen, wohl auch tages- und nicht nur grundsatzpolitischen Überlegungen gibt die SPÖ ihre Position pro Wehrdienst auf. Ein Bruch mit der Tradition, mit dem Selbstverständnis der Partei: Seitdem das Berufsheer im Februar 1934 auf Arbeiter geschossen hatte, bekannte sich die Gesamtpartei vorbehaltslos zur Wehrpflicht. Grundwehrdiener würden in einem Bürgerkrieg nicht auf die eigenen Leute schießen, so die Überzeugung. Die ÖVP liebäugelt seit längerem mit einem Berufsheer, NATO-Beitritt unter Umständen inklusive. Jetzt macht die SPÖ einen Schwenk – und die ÖVP entdeckt aus Trotz ihre längst erkaltete Liebe zur Wehrpflicht wieder.
Was wunder in einem Land, in dem sogar Zeitgeschichtler parteipolitisch zugeordnet werden. Von Künstlern ganz zu schweigen. Bis hinunter ins Schlagerfach. Und das ist nicht nur eine Folge der Politik, mit der sich der SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky um Künstler und Intellektuelle bemühte. Entsprechend sehen die Auftrittsmöglichkeiten für Künstler im weiten politischen Kosmos aus. Es sei denn, man will gerade jemand von der Gegenseite für sich einspannen. Da wird dann schon mal ein eigenes Museum gebaut, wenn’s sein muss.
Vielleicht ja doch...?
Nur lassen sich Dauerkonflikte, zumal derartig zermürbende, kaum langfristig aushalten. Die in Österreich so gerühmte Sozialpartnerschaft ist gleicherart Ausdruck wie Synthese der politischen Gräben. Ihre Bedeutung ging in ihren einflussreichsten Zeiten weit über die normale Konfliktregelung zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern hinaus. Zahlreiche Gesetzesvorhaben, bei denen sich ÖVP und SPÖ nicht einigen können, werden an die Sozialpartner ausgelagert, die tragfähige Kompromisse basteln. Nicht zu Unrecht hielt sich das geflügelte Wort von den Interessensvertretungen (Gewerkschaft, Arbeiterkammern, Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung) als Nebenregierung. Mitunter glitt die fleischgewordene Synthese ins unfreiwillig komisch ab. Wenn einander ein ordenbehangener Gewerkschaftspräsident und ein nicht minder dekorierter Wirtschaftskammerpräsident bei gesellschaftlichen Anlässen herzlich die Hände schütteln, hat das einen Hauch von Realsatire.
Vielleicht liegt es an den politischen Verwerfungen der jüngeren Vergangenheit, dass das gegenseitige Belauern stellenweise nicht mehr ganz so grimm gesehen wird. Ein ÖVP-naher Zeithistoriker etwa sagte öffentlich, die These von der „geteilten Schuld“ sei nicht mehr haltbar. Die SPÖ wiederum ist vom Dogma Wehrpflicht abgerückt. Schwierig ist zu beurteilen, inwiefern die Versuche, ein gemeinsames Narrativ für den Februar 34 zu finden, Zeichen einer Annäherung sind oder der Versuch des restaurativen Zudeckens. Die Pläne eine Historikerkommission einzuberufen, klangen vielversprechend. Bis bekannt wurde, dass sie aus je einem SPÖ und einem ÖVP-nahen Zeithistoriker bestehen sollte. Das lässt wieder etwas von den tiefen Gräben des Februar erahnen.
Max Bitter