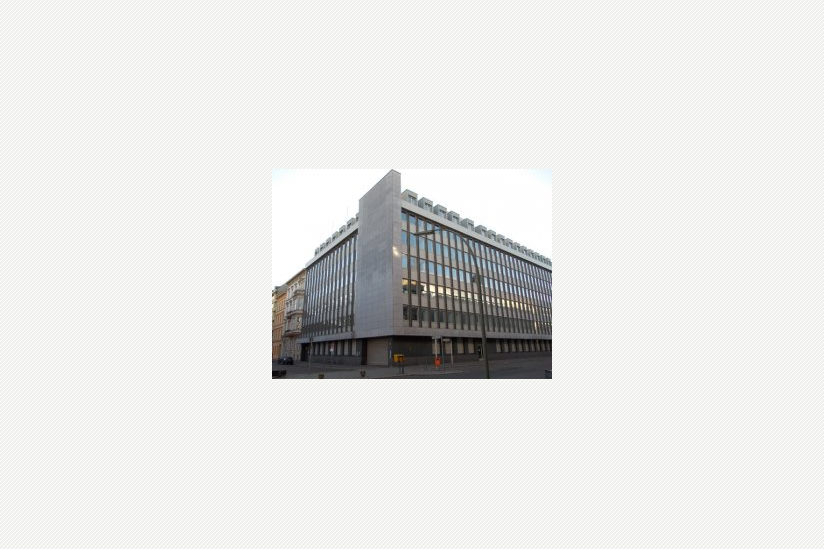BERLIN. (hpd) Mit unverhohlener Genugtuung haben der Zentralrat der Muslime und die Frauenorganisation von Milli Görüs auf ein erst jetzt bekanntgewordenes Urteil des Arbeitsgerichts Berlin (55 Ca 2426/12) vom 28. März dieses Jahres reagiert. Die 55. Kammer des Arbeitsgerichts Berlin hat einer muslimischen Frau Schadensersatz zugesprochen, weil sie von einem Berliner Zahnarzt nicht als Zahnarzthelferin eingestellt worden war. Der Grund für die Nichteinstellung: sie hatte es abgelehnt während der Arbeitszeit ihr Kopftuch abzulegen.
Ein Kommentar von Walter Otte
Die Presse vermeldet ein „Kopftuch-Urteil“ und titelt „Kopftuch durchgesetzt“ (Berliner Zeitung vom 21.10.2012), als sei eine bahnbrechende Entscheidung von historischer Bedeutung gefällt worden. Die Berliner Senatorin Kolat (deren Ehemann muslimischer Verbandsfunktionär ist) begrüßt das Urteil in triumphierendem Ton, als seien bislang Muslime in Deutschland ihrer Religion wegen diskriminiert worden.
Offenbar bekommen muslimische Verbandsvertreter und selbsternannte Fürsprecher religiöser Selbstdarstellungen derzeit Oberwasser infolge der Debatte um religiös motivierte Knabenbeschneidungen. Da passt es gut ins Bild, wenn nun ein weiterer „Erfolg“ spektakulär vermeldet werden kann, auch wenn an dem Urteil nichts spektakuläres ist.
Denn bereits mit Urteil vom 10.10.2002, somit vor gut zehn Jahren, hat das Bundesarbeitsgericht (2 AZR 472/01) einen Kopftuch-Streit entschieden: Das Gericht urteilte damals, dass das Tragen eines „islamischen“ Kopftuches während der Arbeitszeit durch eine Verkäuferin in einem Kaufhaus (in der Kosmetikabteilung) für sich allein keine Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber rechtfertigt. Dabei ging das Gericht vom Grundrecht der Arbeitnehmerin auf Religionsfreiheit aus, das auch grundsätzlich in einem Arbeitsverhältnis gelte. Hiergegen sei das Grundrecht der Unternehmerfreiheit (Artikel 12 Abs. 1 Grundgesetz) abzuwägen; da im seinerzeitige Fall vom Arbeitgeber jedoch keine konkreten betrieblichen Störungen oder wirtschaftlichen Einbußen vorgetragen wurden, sah das Bundesarbeitsgericht die Belange des Unternehmens als nicht vorrangig an. Diese Entscheidung ist vom Bundesverfassungsgericht (1 BvR 792/03) durch die Nichtannahme einer gegen das Urteil gerichteten Verfassungsbeschwerde bestätigt worden, wobei ausdrücklich bestätigt wurde, dass es stets auf den konkreten Einzelfall ankomme. Von Bedeutung für das Bundesverfassungsgericht war auch, dass es möglich war, die muslimische Kopftuchträgerin auf einer weniger exponierten Stelle im Betrieb als in der Kosmetikabteilung einzusetzen.
Fazit: keine generelle uneingeschränkte Befugnis zum Zeigen religiöser Symbole in einem Arbeitsverhältnis, stattdessen Abwägung der Belange des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers im Einzelfall! Beschränkungen des Rechts des Arbeitnehmers, im Arbeitsverhältnis zu religiöser Selbstdarstellung mittels seiner Kleidung berechtigt zu sein, ergeben sich bei betrieblichen Störungen (etwa des Betriebsfriedens) und bei wirtschaftlichen Einbußen des Arbeitgebers (etwa durch Kundenverlust).
Daran hat sich auch durch das jetzt zu beachtende Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) nichts Wesentliches geändert, allenfalls kann es (bei Einstellungen von Arbeitnehmern) zu Schadensersatzverpflichtungen (in überschaubarer Größenordnung) kommen. Im AGG, das seit 2006 in Kraft ist, ist eine Ungleichbehandlung (Diskriminierung) etwa wegen der Religionszugehörigkeit der betroffenen Person untersagt. Damit ist deren Rechtsposition gestärkt und bei einer Abwägung verschiedener widerstreitender Rechte unbedingt zu berücksichtigen, was jedoch nichts an der Berücksichtigung der vom Bundesarbeitsgericht genannten Abwägungskriterien ändert.
Wie sich das Urteil des Arbeitsgerichts Berlin zu den vom Bundesarbeitsgericht aufgestellten Kriterien äußert, ist (bislang) nicht bekannt.
Nichts Neues zu Kopftüchern im Arbeitsleben
Zu rechnen ist gegenwärtig allerdings damit, dass auf Initiative muslimischer Organisationen hin verstärkt muslimische Frauen darauf bestehen könnten, während der Arbeitszeit Kopftuch zu tragen, um ihre Religionszugehörigkeit zu demonstrieren. Zu rechnen ist auch damit, dass eher als vor zehn Jahre bereits Arbeitsgerichte und nicht erst das Bundesarbeitsgericht zugunsten des Kopftuch-Tragens am Arbeitsplatz entscheiden werden. Dabei wird es für die rechtliche Beurteilung aber – so wie seinerzeit - stets auf den Einzelfall ankommen.
Vermutlich werden unter dem Einfluss muslimischer Funktionäre auch weitergehende Forderungen nach Räumen und Pausen zum Beten, nach getrennten Kantinen (mit und ohne Schweinefleisch) gestellt werden. Da gilt allerdings: Die Grundrechte (etwa auf Religionsfreiheit) gelten im Verhältnis privater Interessen untereinander nicht unmittelbar, so dass der Durchsetzung von noch mehr Religion am Arbeitsplatz kein rechtlicher Erfolg beschieden sein wird. Dass die entsprechenden Forderungen lautstark gestellt werden, wird jedoch nicht zu vermeiden sein, zumal offenbar Organisationen wie Milli Görüs und deren Frauenorganisation versuchen, Einfluss zu nehmen und sich öffentlich zu profilieren. Diese Organisationen erhoffen sich zudem – gewissermaßen unisono mit der Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes – eine Signalwirkung des Urteils aus Berlin. Das dortige „Argument“, muslimische Frauen würden allein wegen ihres Glaubens in der Privatwirtschaft nicht eingestellt, verfängt allerdings nicht. Nicht wegen ihres Glaubens sondern wegen der demonstrativ nach außen dargestellten Bekundung ihrer Religion will man sie (bisweilen) in nichtreligiösen Einrichtungen nicht beschäftigen. Wegen ihres Glaubens allein werden sie keineswegs benachteiligt, sonst wären nicht unzählige muslimische Frauen (ohne Kopftuch) in Arbeitsverhältnissen in vielen Branchen beschäftigt.
Nicht berührt von dem Urteil des Arbeitsgerichts Berlin und den erwähnten Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts ist die Problematik des Kopftuch-Tragens im Öffentlichen Dienst, insbesondere an Schulen, auch wenn der Zentralrat der Muslime und Milli Görüs dies massiv fordern. Im Öffentlichen Dienst sind maßgeblich die staatliche Neutralitätspflicht und die Besonderheiten des Öffentlichen Dienstrechtes sowie die Grundsätze des Berufsbeamtentums zu berücksichtigen, so dass eine Gleichsetzung mit der vom Arbeitsgericht entschiedenen Problematik in privatrechtlichen Arbeitsverhältnissen aus rechtlichen Gründen ausscheidet.
Die Entscheidung des Arbeitsgerichts Berlin führt zu einer Entschädigung der muslimischen Frau in Höhe von drei Monatsgehältern, keineswegs jedoch dazu, dass sie den Arbeitsplatz erhält. Der betroffene Zahnarzt hatte den Presseberichten zufolge, da er die Frau für fachlich qualifiziert gehalten hat, mehrfach das Gespräch mit ihr über das Kopftuch-Tragen gesucht. Diese Offenheit hat sich nicht ausgezahlt: sie war Anlass für die Erhebung der Klage zum Arbeitsgericht, gewissermaßen ein gefundenes Fressen für muslimische Funktionäre, denen es nicht auf ein Miteinander im Arbeitsprozess sondern lediglich auf die Durchsetzung ihrer religiösen Vorstellungen ankommt.
Es wäre allerdings fatal, wenn Konsequenz aus diesem Urteil die Vorstellung sein würde, dass sich Offenheit gegenüber Muslimen nicht auszahlt. Der betroffene Zahnarzt und auch andere Arbeitgeber jedoch werden wohl mit kopftuchtragenden Arbeitsplatzbewerberinnen künftig gar kein Gespräch mehr suchen, sondern ohne jegliche Erörterung und Begründung eine Einstellung ablehnen. Und sie werden skeptischer werden bei Einstellungen, denn sie werden befürchten, dass eines Tages die muslimische Mitarbeiterin sich entschließen könnte, ihre religiöse Gesinnung nach außen durch das Tragen eines Kopftuches zu demonstrieren. So ist es durchaus möglich, dass das Berliner Urteil der Sache der muslimischen Frauen einen Bärendienst erwiesen haben könnte.
Mit verstärkten Anstrengungen von vor allem fundamentalistischen Muslimen, ihre religiöse Überzeugung öffentlich demonstrativ zur Schau zu stellen, wird sicherlich zu rechnen sein. Aber nicht sämtliche Anstrengungen werden Erfolg haben – schon aus rechtlichen Gründen nicht.
Eines aber sollte beachtet werden, und dies gibt Anlass zu Optimismus: Die übergroße Anzahl der in Deutschland lebenden Muslime legt überhaupt keinen Wert darauf, ihre religiösen Überzeugungen – etwa durch das Tragen uniformer Kleidung – nach außen gegenüber der Gesellschaft, zu jeder Zeit und an jedem Ort demonstrativ darzustellen. Dies wird immer nur eine Minderheit wollen. Und damit wird man umgehen können.