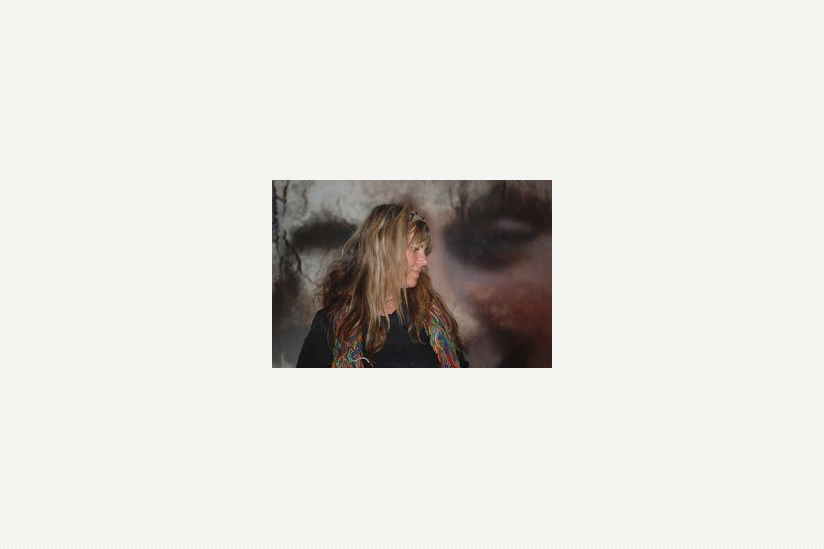BERLIN. (hpd) Ein Weg durch die Jahre: 20 Jahre Mauerfall – ein Grund, Menschen zu treffen, mit ihnen zu sprechen. Hier das fünfte (und letzte Gespräch): Über den Alltag in Berlin-Mitte, die Faszination des Scheunenviertels, Veränderungen und Gebliebenes. Wir treffen die Fotografin Gundula Schulze Eldowy, die von 1979 bis 1989 Alltagsszenen in Ost-Berlin dokumentiert hat.
hpd: Ich bin hier in der Schönholzer Straße und vor mir sitzt Gundula Schulze Eldowy. Woher kommt dieser schöne Name?
Gundula Schulze Eldowy: Er kommt aus Ägypten. Ich war dort von 1993 bis 2000. Dort hatte ich neben der Cheops-Pyramide eine Wohnung, ein Kamel vor der Tür, ein Pferd und „Dauy“ heißt das Licht. Und da ich Fotografin bin und mit Licht arbeite, dachte ich, „Das Licht“ wird nicht gehen, aber „Eldowi“, das klingt gut.
Es klingt großartig und hört sich auch gut an. Gundula, wir sind ja hier, um über deine alte Heimat zu sprechen. Du bist Ost-Berlinerin?
Ich bin seit 1972 in Berlin.
Wo kommst du eigentlich her?
Aus Erfurt in Thüringen. Ich bin dort aufgewachsen, in einer zauberhaften Gegend am Stadtrand und hatte eine wunderschöne Kindheit. Aber dann hat es mir irgendwie nicht gefallen, dass ich da in der Provinz war und als ich das erste Mal nach Berlin kam, war ich fünfzehn.
 Berlin glich damals einer untergegangenen Stadt, hatte etwas von einer archäologischen Stätte, es war einfach unglaublich der Anblick. Für jemanden, der nie etwas von Krieg gesehen hatte war dieser Stadt, damals, noch die ganze Verwüstung anzusehen. Und das hat bei mir unglaublichen Eindruck gemacht. Das war die eine Seite. Die andere Seite: Mir hat es unglaublich gefallen, wie die West-Berliner und die Ost-Berliner miteinander umgegangen sind. Berlin hat etwas, was keine andere Stadt hat in Deutschland. Und diesen Blick für Berlin, den habe ich damals bekommen, als ich aus der Provinz kam. Heute würde ich das nicht mehr sehen, weil ich zu nahe dran bin. Dieser Umgang der Ost-Berliner mit den West-Berlinern: Es war nicht so; wie nach dem Mauerfall, da war es ja so, dass die sich oft zugemacht haben. Damals war das nicht so, die haben sich gegenseitig ausgetauscht und befruchtet. Und das, obwohl die West-Berliner ‚Eintritt’ bezahlen mussten. Sie sind in den Osten gekommen, wir waren gut befreundet und haben uns sehr gut ausgetauscht. Es war wirklich zauberhaft. Damals hatte auch West-Berlin so einen Inselcharakter, das war eine anarchistische Stadt, wo jeder machen konnte, was er wollte. Und das war in gewissem Sinne auch Ost-Berlin. Es war alles improvisiert, es war nicht so perfekt organisiert und so funktional, wie es heute ist, seitdem die Regierung wieder in Berlin ist. Damals waren die Lebensverhältnisse einfach und schlichter, und deshalb vielleicht auch, wo mehr Improvisation ist, da ist auch mehr Poesie, und so sind dann meine Bilder entstanden: ‚Berlin. In einer Hundenacht’.
Berlin glich damals einer untergegangenen Stadt, hatte etwas von einer archäologischen Stätte, es war einfach unglaublich der Anblick. Für jemanden, der nie etwas von Krieg gesehen hatte war dieser Stadt, damals, noch die ganze Verwüstung anzusehen. Und das hat bei mir unglaublichen Eindruck gemacht. Das war die eine Seite. Die andere Seite: Mir hat es unglaublich gefallen, wie die West-Berliner und die Ost-Berliner miteinander umgegangen sind. Berlin hat etwas, was keine andere Stadt hat in Deutschland. Und diesen Blick für Berlin, den habe ich damals bekommen, als ich aus der Provinz kam. Heute würde ich das nicht mehr sehen, weil ich zu nahe dran bin. Dieser Umgang der Ost-Berliner mit den West-Berlinern: Es war nicht so; wie nach dem Mauerfall, da war es ja so, dass die sich oft zugemacht haben. Damals war das nicht so, die haben sich gegenseitig ausgetauscht und befruchtet. Und das, obwohl die West-Berliner ‚Eintritt’ bezahlen mussten. Sie sind in den Osten gekommen, wir waren gut befreundet und haben uns sehr gut ausgetauscht. Es war wirklich zauberhaft. Damals hatte auch West-Berlin so einen Inselcharakter, das war eine anarchistische Stadt, wo jeder machen konnte, was er wollte. Und das war in gewissem Sinne auch Ost-Berlin. Es war alles improvisiert, es war nicht so perfekt organisiert und so funktional, wie es heute ist, seitdem die Regierung wieder in Berlin ist. Damals waren die Lebensverhältnisse einfach und schlichter, und deshalb vielleicht auch, wo mehr Improvisation ist, da ist auch mehr Poesie, und so sind dann meine Bilder entstanden: ‚Berlin. In einer Hundenacht’.
Es macht schon Spaß, dir zuzuhören, ich gehe mit dir in eine andere Zeit und ich frage mich gerade, warum wollten wir eigentlich so gerne eine Änderung?
Warum? Ich glaube auch deshalb, weil es ein Land war, dass alle Schotten dicht gemacht hatte. Es war peu à peu ja so, dass nicht nur die Westgrenze dicht gemacht wurde, sondern dann auch, ich glaube ab 1982, die Ostgrenze. Wir kamen nicht mehr nach Polen, wir kamen nicht mehr in die Tschechei und auch nicht mehr nach Ungarn, wir brauchten eine Sondergenehmigung. Nach Norden, nach Schweden, ging es auch nicht. Es war absurd, es war vollkommen absurd. Da hatten sich einige Leute in ihre Idee eingeschlossen, die nannten sich Zentralkomitee und Politbüro, und alle mussten dann nach ihrer Idee, nach ihrer Pfeife tanzen. Das Leben an und für sich ist ein Fluss, es ist eine Illusion, es anhalten zu wollen, das weiß ich ja auch als Fotografin: Wir können den Fluss nicht anhalten, das einzig Bleibende ist das Bewegliche. Der Baum der Verwandlung blüht ewig, sage ich. Das Bewegliche ist das Bleibende, wir verändern uns, so wie auch Herakles in der griechischen Sage: Niemand steigt zweimal in denselben Fluss. Der Fluss bewegt sich und wir auch. Und wer immer den Versuch macht, diesen Fluss anhalten zu wollen, der scheitert. Das ist einfach ein universales Gesetz.
Du hast es jetzt mit ganz anderen Worten erklärt, als ich es bisher von jemand anderem gehört habe. Das heißt, für dich war es ganz klar, es gibt immer die Veränderung im Fluss des Lebens?
Ich gehöre zu den Menschen, die sich verändern, die loslassen können, die akzeptieren können, dass eine gewisse Zeit vorbei ist, die mich vielleicht einmal inspiriert hat und die ich mochte. Ich kann loslassen und gehen, akzeptieren, dass etwas zu Ende gegangen ist und woanders neu anfangen. Ich weiß aber auch, dass es sehr viele Menschen gibt, die das nicht können, für die das ein Problem ist und die Angst haben vor Veränderung. Das war nicht nur ein Problem der DDR, das ist auch heute ein großes Problem in Deutschland. Ich weiß nicht warum, aber es ein ganz spezielles Problem von Deutschland, Veränderungen zu scheuen, mehr zurück zu schauen als vorwärts.