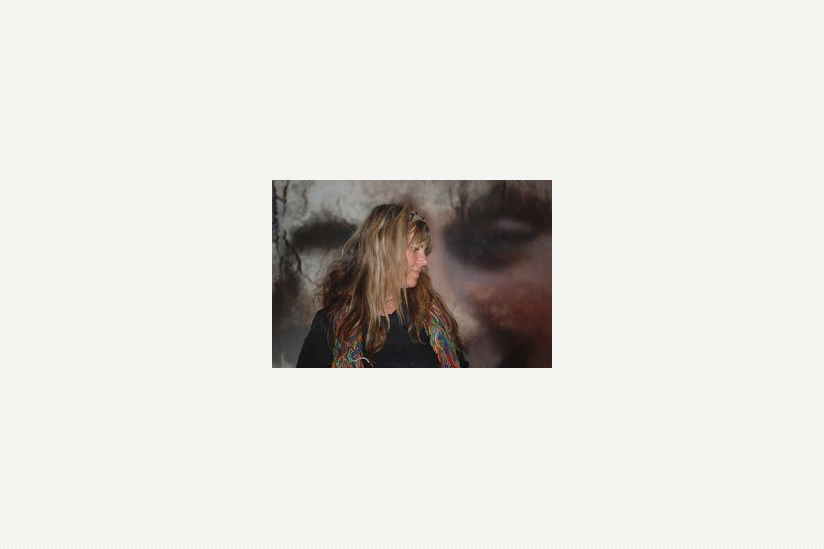BERLIN. (hpd) Ein Weg durch die Jahre: 20 Jahre Mauerfall – ein Grund, Menschen zu treffen, mit ihnen zu sprechen. Hier das fünfte (und letzte Gespräch): Über den Alltag in Berlin-Mitte, die Faszination des Scheunenviertels, Veränderungen und Gebliebenes. Wir treffen die Fotografin Gundula Schulze Eldowy, die von 1979 bis 1989 Alltagsszenen in Ost-Berlin dokumentiert hat.
hpd: Ich bin hier in der Schönholzer Straße und vor mir sitzt Gundula Schulze Eldowy. Woher kommt dieser schöne Name?
Gundula Schulze Eldowy: Er kommt aus Ägypten. Ich war dort von 1993 bis 2000. Dort hatte ich neben der Cheops-Pyramide eine Wohnung, ein Kamel vor der Tür, ein Pferd und „Dauy“ heißt das Licht. Und da ich Fotografin bin und mit Licht arbeite, dachte ich, „Das Licht“ wird nicht gehen, aber „Eldowi“, das klingt gut.
Es klingt großartig und hört sich auch gut an. Gundula, wir sind ja hier, um über deine alte Heimat zu sprechen. Du bist Ost-Berlinerin?
Ich bin seit 1972 in Berlin.
Wo kommst du eigentlich her?
Aus Erfurt in Thüringen. Ich bin dort aufgewachsen, in einer zauberhaften Gegend am Stadtrand und hatte eine wunderschöne Kindheit. Aber dann hat es mir irgendwie nicht gefallen, dass ich da in der Provinz war und als ich das erste Mal nach Berlin kam, war ich fünfzehn.
 Berlin glich damals einer untergegangenen Stadt, hatte etwas von einer archäologischen Stätte, es war einfach unglaublich der Anblick. Für jemanden, der nie etwas von Krieg gesehen hatte war dieser Stadt, damals, noch die ganze Verwüstung anzusehen. Und das hat bei mir unglaublichen Eindruck gemacht. Das war die eine Seite. Die andere Seite: Mir hat es unglaublich gefallen, wie die West-Berliner und die Ost-Berliner miteinander umgegangen sind. Berlin hat etwas, was keine andere Stadt hat in Deutschland. Und diesen Blick für Berlin, den habe ich damals bekommen, als ich aus der Provinz kam. Heute würde ich das nicht mehr sehen, weil ich zu nahe dran bin. Dieser Umgang der Ost-Berliner mit den West-Berlinern: Es war nicht so; wie nach dem Mauerfall, da war es ja so, dass die sich oft zugemacht haben. Damals war das nicht so, die haben sich gegenseitig ausgetauscht und befruchtet. Und das, obwohl die West-Berliner ‚Eintritt’ bezahlen mussten. Sie sind in den Osten gekommen, wir waren gut befreundet und haben uns sehr gut ausgetauscht. Es war wirklich zauberhaft. Damals hatte auch West-Berlin so einen Inselcharakter, das war eine anarchistische Stadt, wo jeder machen konnte, was er wollte. Und das war in gewissem Sinne auch Ost-Berlin. Es war alles improvisiert, es war nicht so perfekt organisiert und so funktional, wie es heute ist, seitdem die Regierung wieder in Berlin ist. Damals waren die Lebensverhältnisse einfach und schlichter, und deshalb vielleicht auch, wo mehr Improvisation ist, da ist auch mehr Poesie, und so sind dann meine Bilder entstanden: ‚Berlin. In einer Hundenacht’.
Berlin glich damals einer untergegangenen Stadt, hatte etwas von einer archäologischen Stätte, es war einfach unglaublich der Anblick. Für jemanden, der nie etwas von Krieg gesehen hatte war dieser Stadt, damals, noch die ganze Verwüstung anzusehen. Und das hat bei mir unglaublichen Eindruck gemacht. Das war die eine Seite. Die andere Seite: Mir hat es unglaublich gefallen, wie die West-Berliner und die Ost-Berliner miteinander umgegangen sind. Berlin hat etwas, was keine andere Stadt hat in Deutschland. Und diesen Blick für Berlin, den habe ich damals bekommen, als ich aus der Provinz kam. Heute würde ich das nicht mehr sehen, weil ich zu nahe dran bin. Dieser Umgang der Ost-Berliner mit den West-Berlinern: Es war nicht so; wie nach dem Mauerfall, da war es ja so, dass die sich oft zugemacht haben. Damals war das nicht so, die haben sich gegenseitig ausgetauscht und befruchtet. Und das, obwohl die West-Berliner ‚Eintritt’ bezahlen mussten. Sie sind in den Osten gekommen, wir waren gut befreundet und haben uns sehr gut ausgetauscht. Es war wirklich zauberhaft. Damals hatte auch West-Berlin so einen Inselcharakter, das war eine anarchistische Stadt, wo jeder machen konnte, was er wollte. Und das war in gewissem Sinne auch Ost-Berlin. Es war alles improvisiert, es war nicht so perfekt organisiert und so funktional, wie es heute ist, seitdem die Regierung wieder in Berlin ist. Damals waren die Lebensverhältnisse einfach und schlichter, und deshalb vielleicht auch, wo mehr Improvisation ist, da ist auch mehr Poesie, und so sind dann meine Bilder entstanden: ‚Berlin. In einer Hundenacht’.
Es macht schon Spaß, dir zuzuhören, ich gehe mit dir in eine andere Zeit und ich frage mich gerade, warum wollten wir eigentlich so gerne eine Änderung?
Warum? Ich glaube auch deshalb, weil es ein Land war, dass alle Schotten dicht gemacht hatte. Es war peu à peu ja so, dass nicht nur die Westgrenze dicht gemacht wurde, sondern dann auch, ich glaube ab 1982, die Ostgrenze. Wir kamen nicht mehr nach Polen, wir kamen nicht mehr in die Tschechei und auch nicht mehr nach Ungarn, wir brauchten eine Sondergenehmigung. Nach Norden, nach Schweden, ging es auch nicht. Es war absurd, es war vollkommen absurd. Da hatten sich einige Leute in ihre Idee eingeschlossen, die nannten sich Zentralkomitee und Politbüro, und alle mussten dann nach ihrer Idee, nach ihrer Pfeife tanzen. Das Leben an und für sich ist ein Fluss, es ist eine Illusion, es anhalten zu wollen, das weiß ich ja auch als Fotografin: Wir können den Fluss nicht anhalten, das einzig Bleibende ist das Bewegliche. Der Baum der Verwandlung blüht ewig, sage ich. Das Bewegliche ist das Bleibende, wir verändern uns, so wie auch Herakles in der griechischen Sage: Niemand steigt zweimal in denselben Fluss. Der Fluss bewegt sich und wir auch. Und wer immer den Versuch macht, diesen Fluss anhalten zu wollen, der scheitert. Das ist einfach ein universales Gesetz.
Du hast es jetzt mit ganz anderen Worten erklärt, als ich es bisher von jemand anderem gehört habe. Das heißt, für dich war es ganz klar, es gibt immer die Veränderung im Fluss des Lebens?
Ich gehöre zu den Menschen, die sich verändern, die loslassen können, die akzeptieren können, dass eine gewisse Zeit vorbei ist, die mich vielleicht einmal inspiriert hat und die ich mochte. Ich kann loslassen und gehen, akzeptieren, dass etwas zu Ende gegangen ist und woanders neu anfangen. Ich weiß aber auch, dass es sehr viele Menschen gibt, die das nicht können, für die das ein Problem ist und die Angst haben vor Veränderung. Das war nicht nur ein Problem der DDR, das ist auch heute ein großes Problem in Deutschland. Ich weiß nicht warum, aber es ein ganz spezielles Problem von Deutschland, Veränderungen zu scheuen, mehr zurück zu schauen als vorwärts.

Du bist Fotografin, du hast in Ost-Berlin, in der DDR gearbeitet, mehr und speziell in Ost-Berlin...?
Anfangs nur in Ost-Berlin. Aber dieses Ost-Berlin, an welches ich mich erinnere, ist nicht das Ost-Berlin nach dem gängigen Klischee. Es war die Mitte von Berlin, das Herzstück Berlins, aber auch Deutschlands und Europas. Und dieses Herz war der Alexanderplatz. Die Friedrichstraße, die Potsdamer Straße, der Potsdamer Platz, das waren alles Ruinen. Die Ruinen haben mir damals gesagt: „Gut, magst du auch eine Ostlerin sein, du lebst jetzt hier im Herzen Berlins, im Herzen Europas, und wenn es eben so ist, dann ist es eben so, akzeptiere, wie es ist.“
Haben die Menschen hier in Berlin deine Arbeiten gesehen?
Anfang der 80er Jahre bin ich davon ausgegangen, dass ich meine Art der Fotografie nicht zeigen kann, weil ich ja das Menschenbild der DDR-Behörden und der Funktionäre total unterwandert habe. Die waren der Meinung, dass sie alle sozialen Probleme gelöst hätten und wir im Schlaraffenland lebten, in einer Art Paradies. Ich muss sagen, mein Naturell ist schon immer etwas anders gewesen, ich war immer schon eine Einzelgängerin. Immer bin ich aus der Reihe getanzt, habe so geredet, wie mir der Schnabel gewachsen war. Ich habe mich nicht bevormunden lassen, und merkwürdigerweise haben das viele Menschen in der DDR akzeptiert und sogar toll gefunden.
Ich habe mich immer gefragt, in was für eine Welt ich hineingeboren worden bin, was die Menschen sich zumuten lassen und ertragen, und wohin man eigentlich Menschen bringt? Ich habe oft gedacht, das halte ich nicht lange aus. Die französischen Romanciers - dazu gehörten beispielsweise Balzac, Zola, Stendal, und Flaubert -, haben einen so wunderbar klaren Blick auf ihre Zeit und die sozialen Verhältnisse gehabt. Sie haben mich beeinflusst. Wesentliches Gedankengut habe ich von ihnen übernommen. Schon als Kind habe ich sie gelesen. Mein Blick wurde geprägt. Ich wollte mich fotografisch so artikulieren, wie sie es mit dem Wort getan haben. Ich habe hier von Anfang eine Welt gesehen, die absolut überhaupt nicht paradiesisch war, in der nichts gelöst war, es waren Seifenblasen.
Frappierend war: Die DDR hat jedes Jahrzehnt - wenn sich wieder einmal ein Jubiläum ergab -, 20, 30, 40 Jahre DDR gefeiert, als würde sie bis zur Unendlichkeit bestehen. Tatsächlich wurden es vierzig Jahre und ich habe gedacht, seltsam, hier in Deutschland und in Berlin hält sich nichts lange, alles geht nach kurzer Zeit sang- und klanglos unter. Wie ist denn der Anfang gewesen, wie hat sich dieses Deutschland das erste Mal vereinigt? Das war in Versailles! In Versailles, am Königssitz von Frankreich, ist der deutsche Kaiser gekrönt worden. Für mich vollkommen absurd. Dahinter steckt eine so anmaßende Machtpolitik: Der momentan Siegreiche zwängt dem momentanen Verlierer seine Prämissen auf. So ist es 1989 auch mit der DDR gemacht worden. Und da ja alles dual ist im Leben, polar, und alles zwei Seiten hat, müssen wir uns heute nicht wundern, wenn wir jetzt das Gegenteil ausleben. Wir sind die Gemolkenen und im Hintergrund ziehen ganz andere die Fäden, von denen wir gar nichts mitkriegen. Wir merken nur, dass wir unsere ganze Kreativität und Potenz nicht ausleben können in diesem Land, sie wird bewusst gebremst.
Wie waren anfangs die Reaktionen auf deine Fotografie?
In der DDR?
Ja. Wem hast du zuerst deine Bilder gezeigt?
Ich war jung, ich war hübsch und stand mit beiden Beinen auf der Erde, habe meine Weiblichkeit auch ausgekostet. Von Anfang an hatte ich diesen klaren Blick. Auch mit meinen Worten habe ich klar gesagt, was ich denke. Mein Äußeres und diese Attitüde passten aber irgendwie nicht zusammen. Oft wurde mir von Hausfrauen gesagt: „Ja, Gundula, du kannst doch alles haben im Leben, warum musst du denn diese schrecklichen Bilder machen? Du siehst so toll aus, die Welt würde dir zu Füßen liegen.“ Ja, das waren noch die harmlosen Reaktionen. Die schärfere war, dass Leute regelrecht bösartig und hysterisch wurden, mich verleumdeten und die übelsten Gemeinheiten über mich erzählten. Das war Krieg. Es war so, als wären meine Bilder eine Kriegserklärung. Diese harten Reaktionen hatte ich nicht erwartet. Es gab aber auch Menschen, die begeistert waren, die genau so empfunden haben wie ich. Sie haben mich dann ein bisschen beschützt.
Du hast für deine Arbeit einen Preis bekommen?
In Japan: "The 12th Prize for Overseas Photographers of Higashikawa Photo Fiesta". Dort hin werden weltweit Fotografen eingeladen. Vor mir war Robert Frank da. Ich habe die Bilder gezeigt, die zuletzt in der DDR entstanden sind: „Der große und der kleine Schritt“ und dafür habe ich diesen Preis bekommen.
Das war noch zu DDR-Zeiten oder danach?
Das war 1996. In der DDR hat mir niemand einen Preis zugesprochen. Im Gegenteil. 2005 hat eine englische Kunsthistorikerin über Aktfotografie recherchiert und war erstaunt, dass es mich augenscheinlich nicht gibt: „Wie kann es sein, dass Sie als wichtigste Protagonistin dieses Genres in den DDR-Medien nur mit ein oder zwei negativen Nebensätzen auftauchen?“ 2009 passiert noch dasselbe. Die Recherche einer Galeristin endete für sie verblüffend. Obwohl ich schon ein großes Lebenswerk mit 20 Serien, 20 Kurzgeschichten und vielen Filmen habe, gibt es weder eine Monographie noch ein Buch über mich. In den Bibliotheken oder über den Buchhandel Informationen über mich einzuholen, ist sozusagen erfolglos. Da wundern sich viele.
Es ist eine Aufforderung, die du so aussprichst?
Ja?
 Gundula, Aktfotografie? Menschen sind im Prinzip ja gleich. Was hast du so anders dargestellt?
Gundula, Aktfotografie? Menschen sind im Prinzip ja gleich. Was hast du so anders dargestellt?
Es gibt einige Unterschiede zwischen dem Osten und dem Westen, die grundsätzlich sind oder waren. Das Verhältnis zum eigenen Körper, wie ich mich sehe, auch in der Nacktheit anderen gegenüber trete, das war bei uns unbekümmert. Unsere Nacktheit war nicht okkupiert vom negativen Denken. Wir waren vollkommen ausgelassen in unserer Nacktheit, wir hatten nicht die strengen Standards. Wir waren nicht auf das Äußere festgelegt, hatten nicht die Models als Idol im Kopf. Es war eher so, wie ich es heute in Südamerika empfinde: Jeder gibt sich so wie er ist. Die Südamerikaner sagen, die Gefühle sind wie der Saft einer Pflanze. Wenn wir nackt waren, dann haben wir uns wie die Kinder verhalten, haben uns nicht geschämt. Es war schön, befreit von allen Klamotten und Masken und einfach bloß Natur zu sein. Die ganze Erotik und Sexualität war in der DDR unbekümmert. Jemand sagte mal, „Ja mein Gott, ihr kanntet keine Pornografie?“. Ich fragte: „Warum besetzen Sie das so negativ, wenn ich nur über eine unbekümmerte Erotik, Sexualität und Sinnlichkeit spreche? Sie hat doch gar nichts mit Pornografie zu tun!“ Pornografie ist das Gegenteil davon. Der ganze Osten, nicht nur die DDR war so. Ich meine nicht nur die Frauen auch die Männer waren so. Auch in Polen, in Ungarn, in Russland. Bis heute ist es so geblieben.
Wenn ich in diese Länder fahre und sehe, wie Mann und Frau miteinander umgehen, habe ich großen Spaß, ihre schöne, reinherzige und sinnliche Art zu beobachten. Das ist einfach zauberhaft.
Gundula, ich habe mir immer schon Gedanken gemacht: Wie wird man in diesem Land mit deinen Arbeiten und der Fotografin dazu umgehen? Das hast du erzählt. Wie hast du damals deine Motive gefunden? Wie erreichten sie dich und wie war die Reflexion?
Ich bin 1969 als Fünfzehnjährige zum ersten Mal nach Berlin gekommen und war vom „Scheunenviertel“ in Berlin Mitte begeistert. Nur dort wollte ich wohnen und später hat es sich so ergeben. Ich wohnte, wie auch Regine Hildebrand, in der Rosa Luxemburg Straße 1. Nicht weit vom Alex also. Ich hatte damals, wie jedes junge Mädchen, Mode, Klamotten und Männer im Kopf. Ich war nicht so ehrgeizig und systematisch, wie das vielleicht heute aussehen mag, wenn man meine Fotos sieht. Ich fotografierte das normale Leben. Die Menschen, denen ich dort begegnete, haben fast alle den Krieg erlebt. Das Seltsame war, dass sie aus ihren Wohnungen nicht weg wollten. Sie sind alle in Mitte geblieben. Das war damals die Max-Beer-Straße, die Almstädtstraße. Die Torstraße hieß Wilhelm-Pieck-Straße.
Alle, die da wohnten, wollten nicht weg. Ich kam hinzu und sie hatten alle eine Geschichte zu erzählen. Ich wollte sie anfangs gar nicht hören. Doch man kann nicht in einer Gegend wohnen und dort die Einwohner, ihre Lebensgeschichten und ihre Lebensart ignorieren. Vielleicht vergingen drei, vier Jahre und dann war ich plötzlich mittendrin. Ich hatte viel Zeit. Das war ein Vorteil. Eigentlich bin ich fast jeden Tag durch die Straßen gewandert. Ich habe mich einfach treiben lassen durch die Schönhauser, durch die Gipsstraße oder Mulackstraße und fast jeden Tag passierte etwas und für mich war es ein unglaubliches Abenteuer.
Im Nachhinein lässt sich ja alles viel leichter begreifen. 1977 bin ich in die Rosa-Luxemburg-Straße gezogen und hatte keine Ahnung davon, dass sich 1989 die Grenze auflösen würde. Gerade auf den letzten Drücker habe ich das Berliner „Milieu“ in seinen letzten Zügen erkennen können. Ein perfektes Timing, es hätte perfekter nicht sein können. Heute habe ich diese wunderbaren Bilder und habe damit quasi die letzten Tage einer Lebensweise eingefangen, die es heute nicht mehr gibt. Es war nicht nur Ost-Berlin, es war das gesamte Berliner Milieu und eben die Zeit der Zwanziger Jahre, eine Zeit, die sich so lange in den Gemäuern bewahrt hat. Diese Art von Leben ist vollkommen vorbei. Ich kann mich erinnern, in einer Kneipe hörte ich ein zauberhaftes Lied aus den alten Tagen des Cabarets. Ich habe gedacht, was weht mir hier der Wind der alten Zeit herüber? Woher kommt diese zauberhafte Stimme?

Sie sang:
„Wenn ich nach Hause geh,
wer ist in meiner Näh?
Ein netter junger Mann
bietet mir Begleitung an.
Ich aber voll verschneit
sage: „Ach es tut mir herzlich leid,
was Sie wollen tu ich nicht,
ich hab noch nie geliebt,
noch nie ein Herz betrübt,
noch nie einen Mund geküsst,
weiß nicht, was Liebe ist.

Dein falsches Männerherz ,
es stillt ja nicht den Schmerz.“
Falsch sind sie alle,
bitter wie Galle:
Den ich nicht leiden mag,
den seh ich alle Tag,
den ich so gerne,
weit in der Ferne.
Wenn doch das Rote Meer
alles Champagner wär,
und ich ein Goldfisch klein
oh glücklich wäre ich dann.“
Wunderbar.
Eine alte Frau hatte gesungen. Einige Tage später kam jemand und bat mich: „Hol’ Margarethe runter“. Sie war über achtzig und konnte nicht mehr alleine die Treppenstufen überwinden. Jeder von uns Jüngeren ging hoch und half ihr. Irgendwann war ich an der Reihe. Sie wohnte auf den Hinterhof in der Lychener Straße. Wie alle anderen alten Leute - mit kahlen Dielen, keinem Teppich, ein Raum, Toilette eine halbe Treppe tiefer -, aber sie hatte ein so sinniges Gemüt. Ich brachte sie in die Kneipe, dort hat sie gesungen. In den zwanziger Jahren war sie Cabaret-Sängerin gewesen.
Eines Tages, als ich wieder bei ihr war, zeigte sie mir die gefallenen Söhne, Fotos von ihren beiden gefallenen Söhnen. Stell Dir vor, ich, ja jung wie alle Frauen um mich herum, die gerade ihre Kinder bekamen, hatte einen Déjà Vu. Ich dachte, wenn ich fünfundachtzig bin, kommt zu mir ein junges Mädchen. Sie ist Fotografin, sie weiß nichts von Berlin. Ich zeig ihr die Fotos von meinen beiden gefallenen Söhnen…. Es war, als würde sich alles wiederholen.
Solche zauberhaften Geschichten sind es gewesen, die mich in Berlin faszinierten. Wie schön die Menschen damals noch sein konnten! In diesen Trümmerhaufen, den die Generation unserer Väter hinterlassen hatte.
Wenn ich heute in Peru den Menschen erzähle, es sind die Frauen gewesen, die die deutsche Hauptstadt wieder mit aufgebaut haben, dann lachen sie und ich frage: „Was lacht ihr?“ Sie lachen weil sie denken, ich wolle sie veralbern. Ich antworte: „Ja mein Gott, die Männer waren alle gefallen oder in Kriegsgefangenschaft, es gab da kaum Männer mehr, die da waren. Es waren die Frauen, die von jedem einzelnen Stein Putz und Zement abgeklopft haben und Stein auf Stein die Häuser wieder aufbauten. Da lachten die Peruaner noch mehr. Für sie war es ein unfassbares Bild. Deutschland, das starke Land. In Peru bauen die Frauen keine Häuser. Als die Häuser in Deutschland wieder fertig waren, zogen die Männer wieder ein und das ganze Spiel begann von vorn.
Nun lief die Zeit, sie lief und es kam das Jahr 1989. Wie war das für dich?
Ich ging mir damals so, wie auch heute. Ich sage, die Idee von Globalismus funktioniert nicht. An jeder Kleinigkeit sehe ich das.
Wir stehen einem Papierwust gegenüber. Formulare, die man ausfüllen muss und was man alles zu erklären hat, diese ganzen Kreditkarten. Nein, das funktioniert so nicht auf Dauer. Die ganzen Nummern, die man zu behalten hat. Die Leute sind restlos in allem überfordert. Ich sage voraus, dass genau dieses System, dieser Globalismus, gerade dabei ist, sang- und klanglos unterzugehen.
Es ist ja auch nicht so gewesen, dass mit dem Herrn Schabowski am 9. November 1989 plötzlich die Grenze aufging. In den achtziger Jahren habe ich gesagt: „Seht mal meine Bilder und die der anderen Fotografen an.“ Die Agonie war schon zu sehen. Dass die Grenze aufging war also kein Wunder, ich hatte es nur schon eher erwartet und mich nur gewundert, wie lange man das den Menschen zumuten konnte. Ich wundere mich auch, wie heute eine Frau Margot Honecker, das einfach profan als ‚Verrat’ abtun kann. Ich habe den Eindruck - im Vergleich zu meinem Leben in Peru -, dass die Menschen hier kopflastiger sind. Sie lassen sich von Ideen tragen und landen in einer Obsession, einem Fanatismus. Und durch die ewige Wiederholung desselben, kann man nicht mehr neben sich stehen bleiben. Ich merke es auch an mir, der Alltag macht blind. Ich frage mich oft und begreife gar nicht, „Warum machst du das eigentlich jetzt? Tut dir das gut?“ Es geht um die eine Frage: Dient mir meine Arbeit oder diene ich meiner Arbeit? So einfach ist es. Natürlich muss es so sein, dass meine Arbeit mir dient, mir gut tut, mich fröhlich macht, mich schön sein und aufblühen lässt. Nicht ich bin die Dienerin von Normen, Regeln oder Gesetzen, die aufgestellt wurden, mir aber nicht gut tun. So kann es nicht sein.
Gundula, was für Fotografien entstehen jetzt? In dieser Zeit, in diesem Jahr, in den nächsten Jahren?
Ganz konkret: Die Ausstellung „Eulenschrei des Verborgenen“ ist bis zum 18. November bei Pixel Grain, dem Labor in der Rosenstraße in Mitte, direkt gegenüber der Marienkirche zu sehen. Das sind Fotos, die in den tiefsten Anden entstanden sind. Man kann sich keinen größeren Kontrast zwischen meiner Berliner Welt und der vollkommen von Menschen unberührten Welt in den Anden vorstellen. Dort lebe ich mit Condoren, Wasserfällen, die aus höchsten Höhen in die Schluchten stürzen. Dschungelpflanzen sind gigantisch groß wie hier Ulmen oder Buchen. Eine Pracht und Üppigkeit wie am ersten Tag der Schöpfung. Dort habe ich eine Geisterwelt angetroffen, die Naturgeister. Die Berliner sagen, es seien malerische Fotos, sehr archaisch und fragen: „Warum malst Du nicht?“ Ich antworte: „Das dauert mir zu lange. Ich kenne Maler gut. Bevor sie ein Wort herauskriegen vergehen Jahrhunderte, so introvertiert sind sie. Das ist nicht meine Mentalität.


Ich habe vorhin eines vergessen zu fragen, wovon hast du in der DDR gelebt?
Seltsamerweise habe ich eine Beständigkeit, die mich selbst verblüfft. Im Prinzip habe ich damals genau so gelebt wie heute. Seit 1987 bin ich in dem Atelier in Pankow und damals mit Slide-Shows von Wismar bis nach Karl-Marx-Stadt gefahren und habe meine Bilder gezeigt. Publikum, Interessierte gab es zahlreich. Danach fand meist ein Künstler-Gespräch statt, das sehr gut bezahlt wurde. So habe ich gelebt und gar nicht schlecht.“
Gundula, willst Du Adressen nennen, unter denen Bilder von Dir zu finden sind?
Die Ausstellung „Kunst und Kalter Krieg“ im Deutschen Historischen Museum, Berlin geht noch bis Januar 2010. Dort habe ich eine wunderbare Installation aus „Der Große und der kleine Schritt“ und aus „Berlin. In einer Hundenacht“.


 Dann beginnt Ende November die Ausstellung „BLICK ZURÜCK NACH VORN“ mit dem Untertitel ‚Künstler reagieren auf das Ende der Mauerzeit’ in der Galerie Pankow, Breite Straße 8. Ich bin auch dabei. Verschiedene Künstler aus der späten DDR werden gezeigt. Dichter sind dabei. Christoph Hein, Durs Grünbein beispielsweise lesen. Auch Bilder von Lutz Dammbeck und Ralf Kerbach werden ausgestellt.
Dann beginnt Ende November die Ausstellung „BLICK ZURÜCK NACH VORN“ mit dem Untertitel ‚Künstler reagieren auf das Ende der Mauerzeit’ in der Galerie Pankow, Breite Straße 8. Ich bin auch dabei. Verschiedene Künstler aus der späten DDR werden gezeigt. Dichter sind dabei. Christoph Hein, Durs Grünbein beispielsweise lesen. Auch Bilder von Lutz Dammbeck und Ralf Kerbach werden ausgestellt.
Am 26. November beginnt die Ausstellung „Und jetzt“ im Künstlerhaus Bethanien Gezeigt werden Künstlerinnen aus der DDR, Tina Bara, Verena Kyselka, Gabriele Stötzer, Erika Stürmer-Alex, Ramona Welsh, Cornelia Schleime, Annemirl Bauer, Else Gabriel, Angela Hampel. Christine Schlegel, Erika Stürmer, Karla Woisnitza . Die Ausstellung geht bis zum 20. Dezember 2009.
„Eulenschrei des Verborgenen“, Bilder aus den Anden bei Pixel Grain in der Rosenstraße hatte ich schon erwähnt. Die Ausstellung ist bis zum 18. November 2009 geöffnet.
Ja. Das sind die Ausstellungen in Berlin.
Von Dir sind in London Bilder zusehen. Wie hat sich der Weg dorthin geebnet?
„Die britische EU-Vertretung zeigt „Berlin. On the dogs Night“. Die Ausstellung begann am 3. November. Wie das kommt, das weiß ich auch nicht. Die Briten haben mehr Interesse an dem Mauerfall und wollen den Anlass nutzen, zu feiern. Ich habe zu England eine sehr gute Verbindung. Ich werde jedes Jahr nach England gerufen und ich fühle mich sehr wohl da.
Welches Bild möchtest Du am liebsten unseren Lesern zeigen?
Das weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht aus den letzten Tagen, aus der Hundenacht – oder eine Ruine? Such Dir aus ….


„ …man kann einen Fluss nicht anhalten.“
Wie sah bei Dir der 9. November vor 20 Jahren aus?
„Am 9. November 1989 bin ich aus Amsterdam nach Berlin gekommen. Dort war ich in der New Kerk an einer Ausstellung beteiligt. Ich war also in Berlin aus Amsterdam angekommen und hörte dort, in West-Berlin, dass die Mauer offen sei. Das habe ich natürlich erst nicht geglaubt. Aber dann war die ganze Stadt voller Menschen und wir sind zum Brandenburger Tor gegangen und ich habe dann nur noch als Fotografin reagiert. Ich hatte davor ja schon die ganzen Montags-Demonstrationen in Leipzig fotografiert.
Bist Du bei den Montags-Demonstrationen mitgegangen oder hast Du dort gearbeitet?
„Ich habe dort gearbeitet u n d ich bin mitgegangen. Es war für mich dasselbe. Es war schon ein Risiko. Keiner wusste, was dort passierte und jeder, der dahin gegangen ist, dem war klar, das es auch gefährlich werden kann.“
Heute nach 20 Jahren sagen die Künstler wie auch die Bürger und die Politiker – WIR haben es erreicht. Wir haben die Regierung so bewegt, dass die Erklärung am 9. November 1989 von Schabowski zwangsläufig kommen musste, wenn gleich der Termin unklar war, aber: „Wir haben die Mauer geöffnet.“
„Ja; das habe ich ja schon gesagt, man kann einen Fluss nicht anhalten. Ich kann mich nicht wehren gegen universelle Gesetze, das geht nicht. Und die konnten das auch nicht.“
Danke schön an Gundula Eldowy.
Interview Evelin Frerk
Reproduktionen der Fotografien aus dem Werk von Gundula Schulze Eldowy nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Künstlerin.
Das gilt auch für die aktuelle Fotografie von Gundula Eldowy von Evelin Frerk.
Aktuelle Ausstellungen
mit Beteiligung von Gundula Schulze Eldowy
Dresden: Hab ich Euch nicht blendend amüsiert? Weibliche Subversionen in der späten DDR-Kunst.
London (Einzelausstellung): „Berlin. On a Dog’s Night.“
Frankfurt: „Denk ich an Deutschland...“ Positionen ostdeutscher Fotografie
Berlin: „blick zurück nach vorn“ – Künstler reagieren auf das Ende der Mauerzeit
Berlin: „Und jetzt - Künstlerinnen aus der DDR“
___________________________________________________
Das Gespräch als Videos auf hpdvideo von YouTube:
___________________________________________________
Die anderen Gespräche:
Gespräch (4): „...und irgendetwas gab es immer nicht.“
Gespräch (3): „Findet eine Revolution statt, wird doch gearbeitet“
Gespräch (2): „Wir waren zwar alle aufgeklärte Marxisten...“
Gespräch (1): „Leben im Wandel des ‚Systems'"