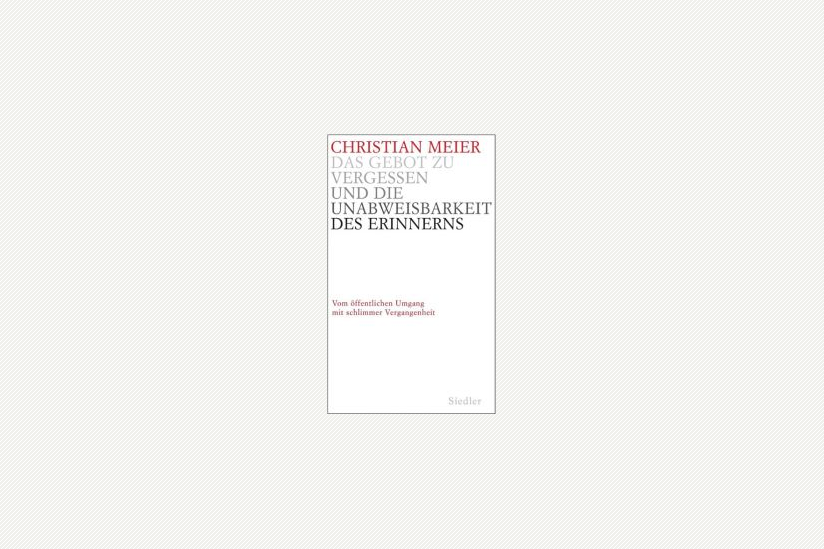(hpd) Der Althistoriker Christian Meier erörtert die Frage, ob der „öffentliche Umgang mit schlimmer Vergangenheit“ eher von Erinnerung oder Vergessen geprägt sein soll. Aus der historischen Betrachtung plädiert er für Letzteres, macht bezüglich der NS-Vergangenheit aber eine Ausnahme, die aber nur ab den 1960er Jahren gelten soll.
Was soll den öffentlichen Umgang mit früheren schlimmen Verbrechen politischer Art prägen: Erinnerung oder Vergessen? Für die erste Antwort votiert man gegenwärtig in Deutschland bezogen auf Holocaust und Kriegsverbrechen während der NS-Herrschaft. Nur so, lautet eine häufig geäußerte Begründung, könne das Entstehen neuer Ansteckungsherde für die Unmenschlichkeit verhindert werden. In der historischen Gesamtschau handelt es sich bei dieser Position allerdings um eine Ausnahme. Seit der Antike dominierte die gegenteilige Antwort: Durch das Vergessen sollten neue Konflikte innerhalb der Gesellschaft eingedämmt werden. Auf diese Tradition macht der renommierte Althistoriker Christian Meier, Autor zweier Standardwerke zu „Cäsar“ (1982) und „Athen“ (1993), aufmerksam. In seinem Essay „Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns“ heißt es mit Blick auf die Geschichte: „Immer wieder wird beschlossen, vereinbart, eingeschärft, dass Vergessen sein soll, Vergessen von vielerlei Unrecht, Grausamkeit, Schlimmem aller Art“ (S. 10).
Diese Einschätzung belegt der Autor nach Betrachtungen zu fast zweieinhalb Jahrtausende europäischer Geschichte: Sie setzen ein in der griechischen und römischen Antike, wo man mehrmals aus Angst vor einem blutigen Bürgerkrieg und um der Gewährung des inneren Friedens willen eine Amnestie für politische Morde erließ. Denn, so Meier, „die Erinnerung an Schlimmes erzeugt gern den Drang zur Rache; was zugleich heißen kann: zu Gerechtigkeit, einer Gerechtigkeit freilich, die allzu leicht auf parteiliche Weise gesucht wird, so dass das Bedürfnis nach Widerrache entsteht“ (S. 13). Ähnliche Motive werden für Verdrängen und Vergessen auch für spätere historische Ereignisse im Mittelalter und der Neuzeit ausgemacht. Ihnen widmet der Althistoriker indessen nur geringe Aufmerksamkeit. Als Lehre aus dieser geschichtlichen Betrachtung formuliert Meier: „Indem man die Fähigkeit hat, einen Schlusspunkt zu setzen, verzichtet man bewusst um des Friedens willen auf die Ahndung von vielerlei Unrecht“ (S. 45).
Bezüglich des öffentlichen Umgangs mit dem Holocaust habe sich nach 1945 in der Hinsicht aber ein anderes Bild ergeben: Gerade die besondere Dimension dieses Genozids unterscheide die gemeinte Untat von den vorher behandelten Verbrechen. Zunächst ging man aber auch hier den bekannten Weg, der von Amnestie, Verdrängung und Vergessen geprägt war. Erst Jahrzehnte später geriet die Dimension der Massenvernichtung der Juden stärker ins öffentliche Bewusstsein. Meier fragt sich hier, „ob in den fünfziger Jahren ... die Wahrheit über die NS-Vergangenheit wirklich zumutbar war“ (S. 68). Erst durch die zeitliche Distanz sei der kritische Umgang mit der Erinnerung an den Holocaust möglich geworden. Derartige Prozesse bedürften offenbar einer neuen Generation. Meier schließt seine Betrachtung mit den Worten: „Die uralte Erfahrung, wonach man nach solchen Ereignissen besser vergisst und verdrängt als tätige Erinnerung walten zu lassen, ist noch keineswegs überholt. Und es ist keineswegs ausgemacht, dass tätige Erinnerung Wiederholung ausschließt“ (S. 97).
Damit solle aber nicht pauschal für die Option „Vergessen statt Erinnerung“ votiert werden: Der Autor macht klar, dass es keinen abstrakten Maßstab gebe und jeder Fall anders liege. Gleichwohl neigt er in die vorgenannte Richtung - ganz im Sinne der Amnestie-Positionen aus der Antike. Sie gingen übrigens nicht mit dem Verzicht auf Aburteilung der Hauptverantwortlichen einher, worauf anhand einer Reihe von Beispielen verwiesen wird. Für die Nachkriegszeit beruft Meier sich auf eine Formel des ehemaligen KZ-Häftlings Eugen Kogen: Die Nazis könne man „’nur töten oder gewinnen, anders sollten nach den Erfahrungen der Weltgeschichte Feinde nie behandelt werden’“ (S. 54). Diese Perspektive, die auch vom „Recht auf Irrtum“ ausgeht, mag überaus realistisch sein. Sie nimmt die Entwicklung aber primär bezogen auf die Täter und nicht auf die Opfer wahr. Hinzu kommt noch eine bedenkliche „Logik“: Je mehr Personen sich schuldig gemacht haben, desto geringer ist die Gefahr einer späteren Konsequenz – gefährdet diese doch den gesellschaftlichen Frieden.
Armin Pfahl-Traughber
Christian Meier, Das Gebot zu vergessen und die Unabweisbarkeit des Erinnerns. Vom öffentlichen Umgang mit schlimmer Vergangenheit, München 2010 (Siedler-Verlag), 159 S., 14,95 €