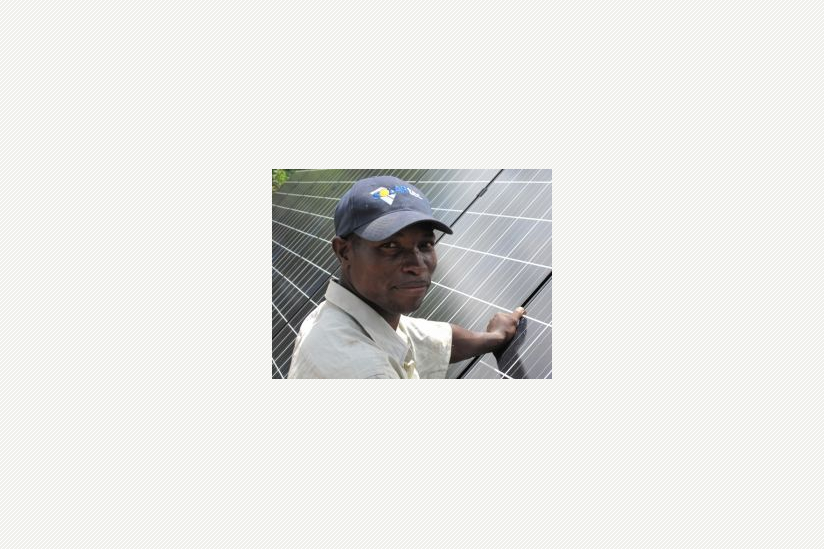TRIER. (hpd) Jürgen Schopp elektrifiziert in Afrika mit Solaranlagen. Der hpd sprach mit ihm über Landflucht, die hohe Schulbildung von Viehzüchter-Kindern, neue infrastrukturelle Möglichkeiten und Arbeitsstellen durch Strom sowie die Förderung der Kommunikation unter Dorfbewohnern durch die Einführung der Solartechnik. Ein interessantes Konzept.
hpd: Jürgen Schopp ist heute da, um darüber zu sprechen, wie man elektrische Energie über Solarenergie nach Afrika bringt.
Jürgen Schopp: Dezentrale, netzunabhängige, autarke Energieversorgung, eigenverwaltet.
hpd: Eigenverwaltet von den Menschen, in deren Dörfern die Energieversorgung aufgebaut wird.
Schopp: Genau.
hpd: Wie groß sind die Dörfer, in denen die Container stehen?
Schopp: Typischerweise 50-70 und 70-160 afrikanische Haushalte.
hpd: Also gibt es zwei verschiedene Größen?
Schopp: Ja, in verschiedenen Regionen. Es hängt ein wenig davon ab, wo diese Dörfer sich befinden. Ein Dorf in einer Plantage hat etwa 30-50 Haushalte, wobei in einem Haushalt, je nach afrikanischem Land, sechs bis maximal 12 Menschen leben. Und ein Plantagendorf kann sich gut selbst verwalten. Es gibt so etwas wie einen Dorfältesten, einen Bürgermeister und eine gewisse Struktur, um dieses Dorf zu organisieren. Und das ist meist selbstverwaltet.
Wenn die Dörfer größer werden, 70 bis 100 oder sogar 160 Haushalte, dann wird dieser Bürgermeister eine gewisse Institution. Seine Aufgabe besteht also darin, Bürgermeister zu sein.
In einem Plantagendorf ist der Bürgermeister aber Teil der Bevölkerung, der für seinen Lebensunterhalt anderweitig, in der Plantage arbeitet. Dann macht er nebenbei die Verwaltung des Dorfes. Wenn die Dörfer größer werden, hat der Bürgermeister mehr Aufgaben und Funktionen, die er während seiner gesamten Tageszeit zu leisten hat. Um sich um die Lokalpolitik zu kümmern, um die Versorgung des Dorfes mit Gütern, Straßenverkehr, Busanbindung, unter Umständen auch Krankentransport zu organisieren. Da entsteht eine größere Infrastruktur. Und dementsprechend ist die Administration, die dadurch entsteht, auch größer.
hpd: Verhandelst du dann mit dem Bürgermeister in dem Dorf, wenn du einen Container aufstellen willst, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Schopp: Zurzeit machen das für uns NGOs (nicht-staatliche Organisationen) – Organisationen, die über irgendwelche Wege Kontakt zu solchen Dorfgemeinschaften hergestellt haben. Es gibt verschiedene Verbände, die in diesem Bereich tätig sind, die sich dort engagieren.
hpd: Was sind das für Organisationen?
Schopp: Zum Beispiel der Club der Ländlichen Elektrifizierung, CLE genannt. Der ist in Freiburg, Deutschland, ansässig. Der Club ist vor vielen Jahren ins Leben gerufen worden. Es handelt sich um eine von Firmen aus der Solarszene organisierte Interessensvertretung. Aber dann gibt es auch den Bundesverband Solarwirtschaft, BSW, in Berlin. Und auch in diesem durch Firmen organisierten Verband gibt es Initiativen, Aktivitäten mit dem Ziel der ländlichen Elektrifizierung, das heißt, Photovoltaik oder Energieversorgung allgemein auf möglichst ökologische Art nach Afrika zu bringen.
hpd: Handeln diese Firmen eigennützig, weil sie Geld verdienen wollen mit den Solarzellen in Afrika?
Schopp: Ja.
hpd: Das heißt, sie stellen in Afrika die Solarzellen auf und bekommen dann von den Dorfbewohnern Geld?
Schopp: Oder über Zuschüsse, die ein Staat leisten kann. Staaten wie Deutschland, Luxemburg, aber auch afrikanische Staaten wie Tansania. Jeder Staat hat ein Budget, um Förderhilfe zu betreiben. Es steht in der Regel ein Prozent vom Bruttosozialprodukt zur Verfügung, um Fördermaßnahmen in Ländern wie Afrika zu unterstützen.
Über viele Jahre waren Dieselgeneratoren die Technik der Wahl. Aber mittlerweile – seit mindestens 15 Jahre schon – sollte es klarer sein, dass die photovoltaische Energiegewinnung und Speichertechnik in Verbindung mit Dieselgeneratoren sinnvolle Konzepte sein können, um den Betrieb von Dieselgeneratoren auf ein Minimum zu reduzieren.
hpd: Weshalb hat man sich vom Dieselgenerator als Energielieferant verabschiedet?
Schopp: Der Dieselgenerator verursacht natürlich Kosten – durch Treibstoffbedarf, Wartung – der Treibstoff muss in der Tat dorthin transportiert werden, die Sonne ist aber schon da. Ein Liter Dieselöl an Ort und Stelle transportiert, kann leicht 1,70 bis 2,50 € pro Liter kosten. Denn das sind doch große Entfernungen und Aufwendungen, um eine größere Menge Treibstoff vor Ort zu schaffen, um damit nur einen Dieselgenerator zu betreiben.
Das Szenario einer ländlichen Elektrifizierung mit Dieselaggregaten, das ich am besten aus dem Senegal kenne - da liegen mir die meisten Zahlen vor, fundiertes Material - funktioniert etwa so: Ein Dieselgenerator wird in einem Projekt finanziert von irgendeinen Staat, von irgendeiner Organisation, die denken, das ist eine gute Sache, wenn ein Dorf in Afrika, zum Beispiel im Senegal, mit 150 Haushalten, damit ohne Weiteres 800 bis 1000 Menschen eine Stromversorgung bekommt, damit abends das Licht angeht, damit mit elektrischem Strom Wasser gepumpt werden kann und der elektrische Strom wird über einen Dieselgenerator geliefert.
Dieser Dieselgenerator ist schnell angeschafft, ist auch eine überschaubare Summe. Dann wird ein Haus gebaut, dort wird der Dieselgenerator eingebaut, und irgendjemand fängt dann an, Stromkabel zu verlegen, damit die Häuser in den Nutzen der elektrischen Energieversorgung kommen. Zu Beginn läuft so ein Dieselgenerator 24 Stunden am Tag, weil es ja nur elektrischen Strom gibt, wenn der Dieselgenerator auch arbeitet. Ob viel oder wenig Strom benötigt wird, das interessiert den Dieselgenerator nicht. Er muss laufen, damit Spannung da ist.
hpd: Aber es gibt keine Speicher?
Schopp: Es gibt keine Speicher. Man könnte theoretisch Speicher bauen. Dafür sind noch andere Komponenten erforderlich. Das kostet deutlich mehr Geld und ist auch mehr Technik.
So ein Dieselgenerator ist doch relativ einfach: Einschalten und dann knattert der und läuft. Das funktioniert ganz gut.


 hpd: Ich nehme an, das ist auch sehr laut.
hpd: Ich nehme an, das ist auch sehr laut.
Schopp: Das kommt auf das Modell an. Er kann sehr laut sein, kann aber auch leise sein. In der Regel befinden sich die Dieselgeneratoren 50 bis 100 Meter vom Zentrum eines Dorfes entfernt.
Es freuen sich natürlich dann alle, wenn abends das Licht angeht. Allerdings wird er nur wenige Tage lang 24 Stunden am Tag laufen. Weil die Betreiber schnell feststellen: Ja, warum muss denn der Dieselgenerator denn die ganze Zeit laufen, auch wenn wir keinen oder nur sehr wenig Strom verbrauchen? Denn was sie sehr schnell merken, ist, dass dieser Dieselgenerator pro Tag eine ganz erhebliche Menge an Treibstoff benötigt. Und nach wenigen Tagen lässt sich feststellen, dass der Treibstoffvorrat im Tank doch schon deutlich zurückgegangen ist. Das dauert wirklich nicht lange.
Daraufhin wird dieser Dieselgenerator wenige Zeiten am Tag eingeschaltet. Vielleicht geht man von 24 Stunden auf 16 Stunden zurück. Das heißt, er wird nachts ausgeschaltet. Gegen sechs Uhr morgens wird er eingeschaltet - die Dämmerung dauert in Afrika etwa eine halbe Stunde. Der Dieselgenerator läuft den ganzen Tag über, 16 Stunden. Auch dann wird festgestellt, dass eine Menge Treibstoff verbraucht wird, obwohl vielleicht wenig Strom benötigt wird.
An der Stelle setzt ein: Wir müssen Strom sparen. Oder: Ihr sollt Strom sparen! Dann wird der Dieselgenerator noch weniger Stunden eingeschaltet. Frühmorgens bis gegen neun Uhr. Und dann wird er ausgeschaltet. Dann in der Mittagszeit nochmal. Nachmittags und abends bis zehn Uhr läuft der Dieselgenerator. Dann sind wir schon bei 12 Stunden.
Das setzt sich dann so fort über die Wochen und Monate, bis der Dieselgenerator zum Schluss nur noch zwei Tage in der Woche läuft. Und dann für wenige Stunden. Weil die Kosten einfach explodieren. Es wird auf Dauer immer mehr Treibstoff benötigt für ein bisschen elektrischen Strom. Der Nutzen, der damals versprochen wurde – „Es gibt elektrischen Strom“ -, der relativiert sich. Weil die Kosten steigen. Die Kilowattstunde Dieselstrom kostet ohne weiteres 15 Euro.
Das lässt sich auch sehr leicht ausrechnen. Darin sind nicht enthalten: Reparaturen, Wartungen, sonstige Dinge. Sondern nur der Treibstoffbedarf. Nur der Treibstoff kostet dann pro Kilowattstunde 15 Euro.
hpd: Wieso wird der Treibstoff immer teurer?
Schopp: Die Menschen fangen an, immer mehr Strom zu sparen. Weil irgendjemand ja die Kosten übernehmen muss. Wenn das ein Dorf ist, das dazu angehalten werden soll, für seine eigene Energie aufzukommen, wird es schnell an finanzielle Grenzen herankommen. Weil ja jederdann, wenn er etwas für das Produkt Strom zu bezahlen hat, versucht zu sparen. Aber der Dieselgenerator verbraucht eine bestimmte Menge Treibstoff, wenn er eingeschaltet ist. Ob Strom genutzt wird oder nicht. Die Menge Treibstoff, die letztendlich nur dafür nötig ist, dass die Maschine überhaupt dreht, verursacht ja Kosten. Das summiert sich, und dadurch entsteht nachher ein Preis pro Kilowattstunde von 15 Euro.
hpd: Und was passiert dann?
Schopp: Jeder versucht, für den elektrischen Strom immer weniger bezahlen zu müssen. Irgendwann ist der Dieselgenerator im Unterhalt so teuer, dass er lieber ausgeschaltet wird. Damit kommen wir wieder zum ursprünglichen Zustand: Die Haushalte betreiben ihre Kibataris, das sind kleine Öllampen, die mit Petroleum – natürlich kein Duftpetroleum, das gibt’s dort nicht – betrieben werden. Also Petroleum ist Benzin gemischt mit Öl. Diese Lämpchen rußen sehr stark, das ist nicht gut für die Atemwege. Und die Kosten, die da entstehen, entsprechen etwa 20 bis 25 Prozent des Tageseinkommens. Um vier bis sechs Kibataris zu betreiben.
Also: Man hat mit ganz viel Engagement einen Dieselgenerator in ein afrikanisches Dorf geschafft, hat dafür Sorge getragen, dass Lampen, elektrische Geräte, zinsgünstig angeschafft wurden, hat dafür Sorge getragen, dass elektrische Leitungen verlegt wurden, hat die Dorfbevölkerung vielleicht mit einbezogen, um an dieser Infrastrukturmaßnahme teilzunehmen - und dann...
hpd: Was dann?
Bevor man neue Projekte installiert, sollte immer gefragt werden: Möchtet ihr das überhaupt? Möchtet ihr das haben? Möchtet ihr das nutzen? Das muss man aber sehr differenziert angehen. Man kann also nicht hingehen zu einem afrikanischen Familienvater und ihm sagen: Ich komme aus Deutschland, dort gibt es Strom, willst du auch Strom? Ich kann mir kaum vorstellen, dass der afrikanische Familienvater oder die Familie sagt: Och ja, ist ja nett, wir überlegen uns das mal. Kommen Sie nächste Woche wieder. Das Fragen sollte also auf einer anderen Basis stattfinden.
hpd: Auf welcher? Wie sieht das in der Wirklichkeit Afrikas aus?
Schopp: Es ist schwierig, das auf den Punkt zu bekommen...
hpd: Du gehst jetzt dahin, nach Afrika?
Schopp: Wir werden von einer NGO gefragt: Wir haben hier ein Dorf, haben hier verschiedene Pläne, haben Fotos gemacht, es gibt eine Menge Haushalte in diesem Dorf, vielleicht eine Klinik, eine Kirche, was auch immer. Dieses Dorf hat keine Stromversorgung, aber eine wichtige Funktion in der Region, so dass die Menschen nicht wegziehen sollen. Landflucht ist in der Regel das Thema.
hpd: Das heißt, die Leute sollen in ihren Dörfern bleiben, dort ihr Auskommen haben und leben können, ohne dass sie in die großen Städte abwandern.
Schopp: Genau. Weil sich die Situation in den großen Städten wahrscheinlich nicht verbessern wird. Die Menschen leben in der Regel dann in Slums, das passiert sehr schnell. Denn ein Jugendlicher, der auf dem Land großgeworden ist und von seinen Eltern vielleicht Viehzucht gelernt hat, der möchte jetzt in die Stadt ziehen – was nimmt er mit, um in der Stadt existieren zu können?
hpd: Das ist zwar im Grunde genommen nicht dein Thema, aber wie sieht es mit der Schulbildung aus?
Schopp: Schulbildung ist genau der springende Punkt. Als ich in dem Projekt Nyacaiga in Tansania war, beim ersten oder zweiten Besuch, da war ich auch in der Schule. Das Projekt liegt im Westen von Tansania, in Bukoba, beim Viktoria-See, etwa 200 Kilometer weiter westlich, Richtung Ruanda. Dort ist das Dorf Nyacaiga in der Region Ugene und etwa drei bis vier Kilometer außerhalb von dem Dorf gibt es eine Schule, einesecondaryschool. Diese Schule ist auch von uns verstromt worden und in dieser Schule gibt es Mädchen und Jungen, die Schulabgänger sind 16 bis 17 Jahre alt. Sie können Englisch lesen, schreiben sprechen, sie können Mathematik...


hpd: Wie weit können sie Mathematik?
Schopp: Funktionsgleichungen mit zwei Unbekannten und trigonometrische Funktionen sind überhaupt kein Problem. Mathematik ist also ein Schwerpunkt. Geschichte, Geographie sind auch Schwerpunkte.
Jetzt fängt ein kleines Problem an, wenn die Jugendlichen mit ihrer Schule fertig sind. Was machen sie? Wo gehen sie hin? Mit ihrer Schulausbildung könnten sie in die nächstgrößere Stadt ziehen. Dort gibt es aber schon viele Leute. Und dann könnten sie in die nächste noch größere Stadt ziehen. Bis zum Indischen Ozean, Daressalam oder andere Städte. Mit der Ausbildung, die sie ein paar Hundert Kilometer im Hinterland des Landes genossen haben, landen sie in der Stadt, haben aber keine Berufsausbildung. Jetzt könnten sie das Glück haben, eine Berufsausbildung zu bekommen, weil sie ja etwas gelernt haben. Aber wirklich nur ein Bruchteil dieser Kinder und Jugendlichen wird das Glück haben, aufgrund der schulischen Leistungen eine Ausbildung in der Stadt zu bekommen.
Die meisten dieser Kinder bleiben auf dem Land und betreiben dort Viehwirtschaft und Landwirtschaft bei ihren Eltern, bei Verwandten, und versuchen, ihre Existenz aufzubauen. Mit einer hohen Schulbildung.
hpd: Aber als Viehzüchter?
Schopp: Als Viehzüchter.
hpd: Was bringt das dann? Müssen sie dann versuchen, sich andere berufliche Bereiche aufzubauen?
Schopp: Genau, und da ist wieder etwas von Außen nötig. Und an der Stelle setzt Energieversorgung ein. Das ist ein Element von vielen. Wenn in einem Dorf wie Nyacaiga elektrischer Strom zur Verfügung steht, was vorher nicht war, dann besteht – so sagen mir das die Leute – ein höherer Anreiz, dort zu bleiben, weil dann dort mit einer höheren Schulbildung als die Eltern genossen haben, etwas aufgebaut werden kann. Aufgrund der Infrastruktur, die zum Beispiel aus elektrischem Strom besteht. Elektrischer Strom ist eine Edelenergieform, mit der es möglich ist, viele Dinge zu tun.
hpd: Eine Edelenergieform. An dieser Stelle möchte ich noch einmal nachfragen: Die Dieselgeneratoren wurden irgendwann abgestellt, wegen der Kosten nicht mehr in Betrieb genommen. Aber die mit Solarstrom betriebenen Generatoren können rund um die Uhr laufen? Es gibt Akkumulatoren, die die Energie speichern, die abgerufen werden kann, wenn sie gebraucht wird, ansonsten bleibt die Energie in den Akkus quasi „stecken“?
Schopp: Genau, als Vorrat.
hpd: Und diese Energie ist günstiger als diejenige, die über Dieselgeneratoren gewonnen wird?
Schopp: Wenn ich das auf die Kilowattstunde beziehe, wird der Strom sogar dreißigmal günstiger sein.
hpd: Er kostet demnach 50 Cent die Kilowattstunde.
Schopp: Genau. Die Kilowattstunde photovoltaisch zur Verfügung gestellter Strom, mit diesem Konzept, das ich erarbeitet habe, wird etwa 50 Cent kosten. Aber der Strom steht Tag und Nacht zur Verfügung, 365 Tage im Jahr. Und dieser Strom verursacht keine Betriebskosten.
Das Konzept verursacht erst einmal Investition. Aber die Investition hatte ich auch beim Dieselgenerator. Die Investition ist beim Dieselgenerator deutlich preiswerter, aber der Betrieb, der ist enorm teuer. Und ein autarkes Containerkonzept, das IPS (Independent Power System – Unabhängiges Stromsystem), lässt sich in drei Jahren amortisieren. Wenn man nur mit einem Dieselgenerator vergleicht.
hpd: Jetzt gibt es zwei Richtungen, in die ich gerne gehen würde. Als einen der Punkte könnten wir nehmen: Welche Berufe lassen sich dadurch aufbauen? Wichtiger ist jedoch die Frage: Was macht jeder Haushalt und wie kann man erfassen, wie viel die Haushalte verbrauchen und ob die Leute dafür bezahlen? Und wie viel bezahlen sie dafür? Das sind etwa 50 Cent pro Kilowattstunde. Welche Auswirkungen hat das denn? Die Leute müssen das Geld ja irgendwoher bekommen, sie müssen es also haben. Inwieweit ist dort eine Geldwirtschaft überhaupt möglich? Was für Geräte werden angeschlossen? Es gibt ja Geräte, die mehr Strom verbrauchen und Geräte, die weniger Strom verbrauchen. Vielleicht kannst du darüber etwas erzählen, wie es in den individuellen Haushalten aussieht.
Schopp: Wenn in einem Dorf elektrischer Strom zur Verfügung steht und dort Menschen sind, die in der Schule etwas gelernt haben, können sie mithilfe des elektrischen Stromes einen Teil ihrer Existenz aufbauen. Also ein Handwerk lernen und ausüben. Schneidern, Schreinern, Unterrichten – elektrische Energie ist ein Entwicklungsmotor.
Der andere Aspekt ist, dass ein gewisser Komfort entsteht. Das Wichtigste ist Licht. In Afrika ist es manchmal sehr schnell sehr dunkel. Wenn elektrischer Strom zur Verfügung steht, um damit Licht zu machen, steigen die Lebensqualität, das Wohlbefinden und zum Teil auch die Sicherheitextrem.
Von der GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) gibt es verschiedene Studien. Dann gibt es noch eine weitere Institution, die GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).
Auf den Webseiten dieser Organisationen gibt es Informationen über ländliche Elektrifizierung. Dort habe ich eine Studie entdeckt, in der analysiert wird, welche typischen afrikanischen Haushalte existieren und in welcher Art diese Haushalte mit Elektrogeräten ausgestattet sind.
hpd: Wobei das sicher von Land zu Land unterschiedlich sein wird.
Schopp: Ja, sehr. Aber die Struktur ist ähnlich.
hpd: Für ganz Afrika, von Marokko bis Südafrika?
Schopp: Ja. In den ländlichen Gegenden. Es gibt strukturell vier Haustypen, Typ 1 bis 4.
Typ 1 ist ein fest gebautes Haus, dort können ohne weiteres sechs, sieben, acht, bis zu zehn Menschen leben und die Familie verfügt über ein gewisses Einkommen. In meinem Beispiel eines Dorfes mit 162 Haushalten, würden 28 Prozent der Haushalte, mehr als ein Viertel, Typ 1 entsprechen.
Typ 2: 31 Prozent, Typ 3: 26 Prozent und Typ 4, die größeren Häuser, also mehr Vermögen: 12 Prozent.
hpd: Das heißt, die reichsten Leute sind diese 12 Prozent.
Schopp: Ja.
hpd: Das sind mehr Leute als hier in Deutschland. Hier sind anteilig weniger Menschen sehr reich. Die Einkommensunterschiede sind dort nicht so groß?
Schopp: Speziell gesehen nicht. Es gibt zwar einen Unterschied, aber der ist unter Umständen nicht so gravierend. In den Dörfern. In den Städten sieht das vollkommen anders aus.
hpd: Wie hoch ist das Pro-Kopf-Einkommen? Es gibt ja das Armutsmaß von unter einem Dollar am Tag.
Schopp: In Nyacaiga liegt das Tageseinkommen bei etwa vier bis sechs Euro. Das ist relativ viel. Weil dieses Dorf im Hochland liegt, das ist sehr grün, dort wird sehr viel angebaut: Bohnen, Mais, Kaffee, Bananen. Die Landwirtschaft ist dort sehr stark. Es gibt Niederschläge, die Gegend ist eine sehr fruchtbare. Sie liegt 1700 Meter hoch und ist dementsprechend feucht. Aus diesen Gründen ist das Einkommen in der Gegend doch recht hoch.


hpd: Werden Monokulturen angebaut oder weniger störanfällige Mischkulturen?
Schopp: Es sind eher Mischkulturen. Wenn es also gut läuft, verdienen die Leute vier bis sechs Euro. So ein HausTyp 1 mit ohne weiteres acht Einwohnern wird sich am Anfang über zwei Energiesparlampen freuen.
hpd: Wo kommen diese Energiesparlampen her?
Schopp: Aus dem Konzept, aus dem Projekt. Wir bringen sie mit.
hpd: Ihr bringt sie mit und verkauft sie an die Leute?
Schopp: Ja genau. Männer aus der Dorfgemeinschaft, die für die Energieversorgung zuständig sind, die letztendlich auch die Verwaltung übernehmen sollen, werden diese Lampen dann verkaufen. Aber diese Lampen sind nicht einfach irgendwoher mitgebracht worden, diese Lampen sollen aus Afrika kommen. Ich möchte keinen Export von europäischen Gütern verursachen, die man vor Ort auch bekommen kann.
hpd: Das heißt, es gibt Energiesparlampen, die in Afrika produziert werden?
Schopp: Ja, allerdings aus größerer Entfernung, unter Umständen genauso weit weg wie von Deutschland nach Afrika. Qualität und Güte sind natürlich zu prüfen und in der Regel haben wir nicht so viele Möglichkeiten, die Alternativen afrikanischer Produkte im Vorfeld zu prüfen – aber dafür haben ja solche Projekte zweite, dritte, vierte Phasen.
So ein Haus hat also zwei Energiesparlampen, weil sie sich das leisten können. Wichtig an der Stelle ist: Ich möchte versuchen, den Unterschied deutlich zu machen, für das Produkt Strom etwas zu bezahlen oder für die Zurverfügungstellung der Technik. Für die Nutzung der Technik soll gezahlt werden und nicht für den Strom als Produkt. Das Benutzen der Technik, die geliefert wird.
hpd: Wenn ich die Lampe einschalte, nutze und dann wieder ausschalte, würde ich den Strom bezahlen?
Schopp: Es geht um die Menge der Geräte, die ich betreibe.
hpd: Also zahle ich zwei Energiesparlampen?
Schopp: Im Prinzip zwei Energiesparlampen.
hpd: Die Nutzung zweier Energiesparlampen, unabhängig davon, wie lange ich diese einschalte? Auch wenn ich die Lampen die ganze Nacht laufen lasse, jemand anderer aber nur ein paar Minuten am Abend.
Schopp: Genau. Das ist der springende Punkt. Und wenn das alle so machen, dann wird das System nicht kaputtgehen, aber das System kann dann nicht soviel Energie zur Verfügung stellen, damit alle Leute das Licht eingeschaltet lassen könnten – was ja nicht sinnvoll ist. Und da setzt ein Lerneffekt ein: Wenn alle einfach verschwenderisch mit dem Strom umgehen, weil sie alle ihre Lampen oder andere Geräte, die sie ja gekauft haben, die ganze Nacht oder den ganzen Tag in Betrieb halten, dann wird irgendwann der Speicher leer sein, die Akkumulatoren. Die Sonne reicht nicht aus, um diesen Strom zur Verfügung zu stellen, es wird verschwendet.
hpd: Das passiert dann in der Regel?
Schopp: Das passiert auch. So wie ich am Anfang beim Dieselgenerator gesagt hatte, sind alle Leute froh: „Jetzt haben wir endlich Strom!“ Das läuft und der Dieselgenerator ist 50 bis 100 Meter vom Dorf weg, ich höre den ja gar nicht. Ich weiß nur, wenn ich mein Licht einschalte, dann habe ich Strom, die Lampe geht an.
hpd: Soweit finde ich das ein kluges Konzept. Man kauft ein Produkt, es wird bezahlt, dann kann man es laufen lassen, solange man will. Die Leute lernen aber, wenn sie das rund um die Uhr laufen lassen, flackert das Licht und ist irgendwann weg. Und dann muss man eine ganze Weile warten, bis die Sonne die Akkus wieder aufgeladen hat. Das werden sie also nicht mehr tun. Andererseits werden sie ermutigt, weil sie nicht pro verbrauchter Einheit bezahlen, sondern für die Anzahl ihrer Elektrogeräte.
Schopp: Da setzt ein Gruppenzwang ein.
hpd: Ja, sie müssen nicht sparen, um weniger zu bezahlen, sondern weil sonst der Strom-Akku leer ist.
Schopp: Genau das ist der springende Punkt. Und das Ganze geht auch mit Wasser. Wasser sollte auf der ganzen Welt jedem Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Aber die Bereitstellung des Wassers, die Technik, die dafür notwendig ist, die habe ich zu bezahlen.
Bei diesem Gedanken, nicht den Strom in Kilowattstunden bezahlen zu müssen oder zu sollen, weil die Leute, die mehr Geld haben, die zum Beispiel das Haus Typ 4 bewohnen, die können ohne weiteres sagen: Wir können alles einschalten! Wir haben soviel Geld, das ist uns vollkommen egal!
Dadurch verliert der Nutzer die emotionale Verbindung zu dem Strom an sich, zu der Nutzung an sich. Wäre der Strom immer da, warum sollte ich denn sparen? Ich kann es auch bezahlen, ich habe dafür bezahlt! Wenn ich aber nicht für die Kilowattstunde, für den Strom, bezahle, und aufgrund meines Verhaltens und des Verhaltens vieler anderer in dem Dorf der Strom ausfällt, dann kann man ganz anders ansetzen und sagen: Stimmt euch bitte ab! Es gibt nur eine bestimmte Menge Strom pro Tag zur Verfügung. Setzt euch mit euren Gremien zusammen, wie ihr den Strom gerecht verteilt, damit jeder was davon hat.
Es ist schwierig gewesen, das zu vermitteln. Das hat etwas mit der afrikanischen Mentalität zu tun. Wenn ich an einer Quelle Wasser holen kann, dann läuft die Quelle Tag und Nacht, je nachdem, zu welcher Jahreszeit ich dahin komme. Die Quelle tropft auch, wenn ich keinen Eimer drunter stelle. Und wenn ich jetzt an dieser Stelle einen Wasserhahn habe, den ich auf- und zudrehen kann, und das Wasser wird gefördert, es ist in einem Speicher vorhanden, weil es sonst nicht reicht, weil es nicht immer Wasser gibt, dann kann man beobachten, dass dieser Wasserhahn immer läuft. Der ist immer aufgedreht und solange Wasser aus diesem Wasserhahn rauskommt, wird Wasser geschöpft. Da kommen Eimer und Eimer und Eimer drunter – und irgendwann ist der Wasserspeicher leer.
Und dann sagen die meisten aus der Bevölkerung – das hat überhaupt nichts mit Dummheit zu tun, sondern das ist die Erfahrung – solange etwas da ist, kann ich es ja nutzen. Obwohl ich es ja nicht brauche, aber ich kann es ja schon mal mitnehmen. Beim Wasser wird das ganz deutlich.
hpd: Ja, das ist ein Land, indem es immer wieder Dürren gibt. Wenn es schon einmal Wasser gibt, nimmt man es eben vorsichtshalber mit und bunkert es irgendwo, damit man für die schlechten Zeiten etwas vorrätig hat. Das ist ja nachvollziehbar.
Schopp: Und jetzt wird Technik zur Verfügung gestellt, die es ermöglicht, dass ich 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, Strom zur Verfügung habe. Aber zu verstehen, dass dieser Strom auch in schlechten Zeiten zur Verfügung steht, weil er ja gespeichert wurde, das ist sehr schwierig.


hpd: Das ist ein Umlernprozess.
Schopp: Ein Umlernprozess kann, finde ich, nicht über Geld gemacht werden, sondern über die Konsequenz: Wenn wir verschwenderisch damit umgehen, ist irgendwann der Speicher leer und wir müssen alle warten, bis dieser Speicher wieder gefüllt ist. Das ist mein Konzept für IPS Village, also Independent Power Systems für Dörfer, in dieser Art und Weise den Strom zu verteilen, natürlich auch da gerecht zu verteilen. Und auch elektrotechnische Hilfsmittel, um feststellen zu können, ob Strom massiv verschwendet oder ob er sinnvoll eingesetzt wird. Also da lässt sich was steuern und regeln. Das ist nicht dem Zufall überlassen. Die Benutzung beim Anwender in der Hütte erfordert einen gewissen Lernprozess.
hpd: Und Absprachen miteinander. Die Leute müssen kommunizieren und aushandeln, wie sie die Stromverteilung regeln. Das dürfte für die Kommunikation untereinander sehr förderlich sein. Wenn sie gemeinsam Regeln aufstellen ist das möglicherweise ein demokratischer Prozess, je nachdem, wie sie sich organisiert haben.
Schopp: Genau. Das ist in dem Projekt Nyacaiga sehr schön deutlich geworden. Dieser Prozess des Umdenkens, des Lernens, braucht mehr als ein Jahr. Das geht nicht von heute auf morgen.
Im Prinzip zeigen uns die Leute in Afrika, wie wir hier handeln sollten. Denn hier wird sehr viel Energie verschwendet.
hpd: Klar, ist immer da, also wird sie verschwendet. Vielen Menschen ist auch nicht klar, wie viel Strom ihre Geräte verbrauchen. Wenn man den Leuten vor die Augen führt, welche Geräte Strom viel Strom verbrauchen, ändern sie oftmals schlagartig ihr Verhalten.
Schopp: Aber dafür muss das Bewusstsein geschaffen werden.
hpd: Ja, es sind sehr viele Faktoren notwendig, um zu wissen, was man wissen muss, um eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Um uns herum sind so viele Neuerungen, die wir in ihrer Summe nicht prozessieren, nicht verarbeiten können. Im Grunde genommen geht es uns genauso wie den Leuten in Afrika...
Schopp: ...nur auf einem anderen Level.
hpd: Ich weiß nicht einmal, ob das auf einem anderen Level ist oder ob wir uns nur einbilden, das sei auf einem anderen Level. Das Konzept ist also sehr interessant, finde ich. Was für Geräte haben denn die Leute in Afrika? Es gibt ja anscheinend mehrere unterschiedliche Geräte.
Schopp: In der ersten Reihe gibt es die Beleuchtung, Lampen.
hpd: Da wollte ich nochmal nachfragen, weil eine Lampe wahrscheinlich nicht nur drei oder vier Euro kostet, wenn man die Benutzung zahlt, sondern wahrscheinlich kostet die mehr. Sonst würde sich die Stromversorgungsanlage ja nicht amortisieren.
Schopp: Ja. Eine Lampe in Afrika. Wo kann die herkommen? Eine Glühbirne in einem autarken Stromversorgungskonzept wie hier, welches so groß ist, dass damit 162 Haushalte elektrifiziert werden können, ob Typ 1 oder 4, vollkommen egal, ist mit Sicherheit nicht die sinnvolle Lösung, weil eine Glühbirne nur fünf Prozent Licht zur Verfügung stellt und 25 Prozent Wärme. Die werden sehr heiß.
In Afrika gibt es natürlich auch Leuchtstoffröhren. Die haben schon einen besseren Wirkungsgrad. Und aufgerollte Langfeldleuchten sind Energiesparlampen oder Kompaktleuchtstofflampen. Diese Lampen werden natürlich teurer als Glühbirnen.
Wenn jetzt eine afrikanische Familie, die das Haus Typ 1 bewohnt, eine Energiesparlampe kaufen soll, ohne weiteres in einer guten Qualität, damit sie auch lange funktioniert, wird diese – in großen Stückzahlen eingekauft – etwa vier Euro kosten.
hpd: Aber dann hat sie ja nur acht Kilowattstunden bezahlt. Wie wird dann die Bezahlung des Projekts umgesetzt? Wie kommt es zur Deckung der Kosten für den Container?
Schopp: Ach! Okay. Die Leute besitzen eine Kibatari, das ist eine Blechlampe.
 hpd: Das ist diese Funzel...
hpd: Das ist diese Funzel...
Schopp: ...wo das Petroleum reinkommt. Von diesen Kibatari braucht man, um einigermaßen Licht zu machen, vier bis sechs. Die brauchen bis zu vierzig Cent Lampenöl am Abend und in der Nacht. Und wenn jetzt ein afrikanisches Dorf, bestehend aus diesen Haustypen 1 bis 4 jeweils mindestens zwei Energiesparlampen hat, dann hätte jeder Haushalt im Durchschnitt in der Nacht 38 Cent nur für Lampenöl ausgegeben. 38 Cent mal 162 Haushalte mal 365 Tage – das sind so um die 60 Euro am Tag mal 365 sind 24.000 Euro im Jahr, mal zehn Jahre sind 240.000 Euro. Die in zehn Jahren nur für Lampenöl ausgegeben werden, mit schlechterem Licht.
hpd. Worden wären. Jetzt haben sie ja die Energiesparlampen. Jetzt geben sie ja nicht mehr diese 240.000 Euro aus, sondern nur noch...
Schopp: ...38 Cent, also genau diesen Betrag, für ihre Beleuchtung! Den können sie immer noch ausgeben. Aber dafür haben sie rund um die Uhr elektrischen Strom zur Verfügung.
hpd: Das heißt, sie kaufen im billigsten Fall zwei Energiesparlampen, zahlen acht Euro und zahlen dann noch zusätzlich 38 Cent pro Tag?
Schopp: Ach, das war der Punkt. Nein, die Idee ist anders. Wenn eine afrikanische Familie einen Teil ihres Einkommens für Lampenöl beziehungsweise für Öllampenlicht ausgibt, dann – so kam mir der Gedanke – können sie vielleicht dasselbe Geld ausgeben, um ihre eigene Energieversorgung zu finanzieren.
Am Anfang muss irgendjemand die Summe Geld zur Verfügung stellen. Das kann ein Staat sein, durch ein Hilfsprogramm. Wie Deutschland, Luxemburg oder andere Staaten. Irgendjemand stellt das Geld zur Verfügung, damit die Stromversorgung finanziert werden kann, bestehend aus Solarmodulen, Container, Kabeln, Infrastruktur, um mit diesem Container 162 Haushalte zu elektrifizieren.
Das kann so aussehen: Da ist der Container, da ist die Stromverteilung, da geht der Strom ins Dorf rein. Da sind die Verteiler, da die Häuser, groß und klein.
hpd: Nichtsdestotrotz: Die Leute zahlen nicht nur acht Euro für zwei Glühlampen, sie zahlen mehr. Wie viel zahlen sie und wer bekommt das Geld?
Schopp: Sie zahlen gar nicht mal die acht Euro, sondern – und deshalb ist es wichtig, dass die Dörfer eine bestimmte Größe haben, wegen der Selbstverwaltung...
hpd: ...sie müssen eine Mindestgröße haben und selbstverwaltet sein?
Schopp: Genau, dass eine Struktur vorhanden ist mit einem Bürgermeister.
hpd: Jetzt verstehe ich das! Eine Administration muss bereits vorhanden sein.
Schopp: Genau, eine Administration muss vorhanden sein, weil da schnell Geld zusammenkommt. Wenn in einem Dorf mit 162 Haushalten, Tausend Menschen, am Tag 60 Euro zustande kommen durch Lampenöl oder 60 Euro deshalb zusammenkommen, weil in eine Gemeinschaftskasse eingezahlt wird, zum Erwerb der eigenen Solaranlage, summiert sich innerhalb von einer Woche schon so eine große Summe Geld, dass da Begehrlichkeiten entstehen können. Und deshalb braucht man eine Struktur, wo die Hand drauf gehalten wird, ein Sperrkonto, bei dem drei bis vier Leute unterschriftsberechtigt sind, aber nur zusammen, um dort Geld zu entnehmen.
Mein Ansatz war: Ich möchte Solartechnik zur Verfügung stellen, auch hier in Deutschland, die ohne Förderung gekauft wird. Aus Überzeugung. Meine Kunden können ihre Solaranlage auch ohne Förderung kaufen. Weil sie von der Sache überzeugt sind. Man muss nicht die Förderung in Anspruch nehmen, auch wenn das den Leuten permanent so erklärt wird.


hpd: Möglicherweise ist das ja Unsinn. Nichtsdestotrotz muss man das Geld in eine Anlage investieren, was ein Dorf mit 162 Haushalten einfacher machen kann als ein Individuum. Aber auch hier in Deutschland könnte eine Dorfgemeinschaft sagen: So, wir hätten auch gerne so etwas. Stell uns mal einen Container hin und wir finanzieren das dann teilweise, nehmen ansonsten einen Kredit auf. Es wäre theoretisch möglich, dass ein Dorf in Deutschland so etwas macht oder eine andere kleine Ansammlung von Haushalten.
Schopp: In Deutschland würden sie ohne weiteres einen Kredit bekommen, aber in Afrika nicht. Und aus diesem Grund ist es natürlich sinnvoll, wenn eine NGO oder ein europäischer Staat Gelder zur Verfügung stellt – die auch da sind –, um für solche Projekte die Finanzierung zu bewerkstelligen.
hpd: Aber es ist trotzdem ein Kredit, den die Leute aufnehmen und dann abbezahlen? Ich meine, du verdienst ja auch Geld damit, nehme ich mal an.
Schopp: Ja, denn unsere Projekte werden über die Gelder der Staaten finanziert, die es in der Kasse haben. Wie zum Beispiel Luxemburg: Das Lux Development hat eine bestimmte Menge Geld zur Verfügung, um Projekte, die wir in Afrika abwickeln, zu finanzieren.
hpd: Das muss sich doch für irgendjemanden amortisieren! Das heißt, ihr verdient dran – du selber auch –, die Leute in Afrika profitieren davon, weil sie Strom haben. Diesen Strom bezahlen sie aber auch.
Schopp: Okay, dann müssen wir mal trennen. Ich bin ja kein Wohltätigkeitsverein. Natürlich mache ich einen positiven Umsatz, um meine Struktur in Luxemburg, meine Firma, finanzieren zu können, um meinen Angestellten auch Löhne zahlen zu können.
hpd: Ja, ihr baut die Container und es dürfte – auch aufgrund des hohen Gehaltsniveaus in Luxemburg – sehr viel Geld kosten, sie zu bauen. Dann wird der Container verschifft, das kostet auch nochmal Geld. Es dürfte also insgesamt ziemlich viel Geld kosten, den Container herzustellen, ihn zu transportieren, bis er an seinem Bestimmungsort irgendwo in Afrika steht. Dort müssen die Kabel gelegt werden...
Schopp: ...das machen an der Stelle dann schon die Leute. Wir bauen das in Luxemburg, machen das alles versandfertig für die Spedition mit allem drum und dran. Dann ist dieses große Paket fertig und wird per Schiff nach Afrika transportiert.
hpd: Aber hier bezahlt es die Luxemburger Regierung?
Schopp: Ja, einen Teil. Und ein anderer Teil der Summe wird über Spenden finanziert, die zum Beispiel durch eine NGO aufgebracht werden. Also 100 Prozent der Finanzierung findet in Europa statt.
hpd: Das heißt, der Container ist bereits bezahlt, wenn er ankommt?
Schopp: Genau. An der Stelle kann man fragen: Warum wird denn das überhaupt gemacht? Warum engagiert sich eine NGO, irgendetwas in Afrika zu machen?
hpd: Und warum engagieren sich die Länder wie Luxemburg und Deutschland...
Schopp: Ablasshandel, oder... (lacht)?
hpd: Was mich interessiert, ist: Der Container ist zu 100 Prozent finanziert und dort vor Ort müssen die Leute nur noch ihre Energiesparlampen und ihre Elektrogeräte kaufen und die Verkabelung übernehmen.
Schopp: Und da setzt wieder ein Teil ein: Ich habe hier Arbeitsplätze geschaffen, weil wir Container bauen. Weil wir diese Art der Energieversorgung hier zusammenstellen können, mit den technischen Möglichkeiten ausgestattet sind, um so etwas zuverlässig und in höchster Qualität herzustellen. Es muss die höchste, die beste Qualität sein, die man finden kann. Weil es nachher sechseinhalbtausend Kilometer von Europa entfernt ist und wenn etwas kaputtginge, könnte eventuell das ganze System ausfallen. Also sollen Produkte, die nach Afrika gehen, von höchster Qualität und Güte sein.
hpd: Woran bemisst sich das?
Schopp: An der Zuverlässigkeit, der Art und Weise, wie diese Geräte gebaut werden.
hpd: Was sind das für Materialien? Ist es Silizium? Sind das Eisen- oder Stahlkonstruktionen?
Schopp: Wie bemisst sich die Qualität eines Produktes?
hpd: Zum Beispiel eine geringe Störanfälligkeit. Es kann, wenn es gut gearbeitet ist, durch externe Faktoren nicht so leicht beeinträchtigt werden, wie etwa durch Sandstürme, die es in Afrika gibt, oder durch Regengüsse. Man muss die Umweltfaktoren berücksichtigen.
Schopp: Und deshalb müssen die Geräte von hoher Qualität sein.
hpd: Okay. Wie viel kostet denn so ein Container?
Schopp: Etwa 200.000 Euro. Für ein 162 Haushalte Dorf.
hpd: Also plus minus 150 bis 200 oder genau 162?
Schopp: Das Beispiel ist auf 162 Haushalte skaliert. Es können ohne weiteres 150 Haushalte sein, es könnten aber auch 180 Haushalte sein. Da ist ein gewisser Spielraum drin.
hpd: Das heißt, wenn es weniger Haushalte in einem kleineren Dorf sind, wird es anteilig teurer?
Schopp: Ja, dann wird es anteilig teurer. Es ist ja immer der gleiche Container. Es gibt eine Grundausstattung, die muss auf jeden Fall gegeben sein, die wird auf jeden Fall bezahlt. Und die Grundausstattung ermöglicht die Versorgung einer bestimmten Menge Haushalte. Aber wenn ich Kosten durch Haushalte dividiere, wird das natürlich bei weniger Haushalten anteilig teurer sein als wenn ich auf das Maximum gehe oder sogar zehn bis zwölf Prozent darüber liege, also in diesem Beispiel 185 bis 190 Haushalte. Das würde prinzipiell gehen. Das Optimum für diesen Container liegt aber bei 162 Haushalten.
Die Kosten nach jetzigen Faktoren sind etwa 185.000 Euro. Soviel würde ein solches Containerkonzept mit sämtlichem Material ab Lager Luxemburg kosten. An dieser Stelle setzt es ein. Diese Summe ist zu 100 Prozent finanziert, aus Europa. Selbst der Transport wird noch finanziert, das ist gar nicht einmal so teuer. Für unter 4.000 Euro kommt dieser Container von Luxemburg bis in irgendein afrikanisches Dorf in Tansania.
Jetzt kommt dieser Container in Afrika an, in einem Dorf, das vorher schon einmal besucht wurde. Die Bewohner des Dorfes werden jetzt angeleitet, dass sie die Energieversorgung selber aufbauen. Das heißt, es steht auch Geld zur Verfügung für die Arbeitsleistung. Dieses Geld kommt teilweise von den afrikanischen Ländern.


hpd: Es ist also ein internationales Zusammenspiel.
Schopp: Das ist nicht unbedingt die Regel, aber man kann es dahin bringen. Weil in Afrika auch genügend Gelder existieren, um eigene Leute zu bezahlen, die in den Dörfern leben. Die können von ihrer Landesverwaltung oder von der Bezirksverwaltung bezahlt werden.
hpd: Und hier kommt ja die Schulbildung wieder ins Spiel. Denn die Leute, die eine gute Schulbildung genossen haben, können diese Aufgaben wie auch administrative Tätigkeiten übernehmen.
Schopp: Und das ist, finde ich, sehr wichtig, dass die Bevölkerung in so einem Dorf dafür zuständig ist, die eigene Stromversorgung zu bauen. Sämtliche Materialien sind vorhanden, sind in diesem Container oder in den weiteren Kisten, die wir dabei packen. Das Material für die erste Phase: Kabel und Lampen sind in unserer Lieferung vorhanden.
hpd: Ihr liefert also doch Lampen aus Luxemburg?
Schopp: Aus Deutschland. Oder aus Europa. Für die erste Phase. Und in der ersten Phase wird der Container aufgebaut, werden Solarmodule aufgebaut, werden die Hauptstromkabel gelegt, in die Dörfer rein.
hpd: Das machen die Afrikaner?
Schopp: Das machen die Leute vor Ort. Nach Anleitung, sie bekommen also Unterricht. Jetzt ist die erste Phase abgeschlossen. Die kann etwa zwei Wochen dauern. Dann ist es soweit aufgebaut. Einige Menschen werden schon in den Genuss der Energieversorgung kommen, vor allem wichtige Funktionen wie der Bürgermeister, die Schule, ein zentraler Platz im Dorf, vielleicht wird die Straßenbeleuchtung in Gang gesetzt, vielleicht gibt es einen Orden, vielleicht eine Klinik. Zentrale Einrichtungen kommen als erste in den Genuss der Energieversorgung.
In der zweiten Phase wird das Netz erweitert, verdichtet. In der ersten Phase waren schon Menschen aus dem Dorf nötig, die in diesem Projekt gearbeitet haben. Die wurden auch für ihre Zeit bezahlt. In der zweiten Phase bildet sich aus den Menschen der ersten Phase ein fester Kern von vielleicht drei bis fünf Männern. Und diese drei bis fünf Männer sind dafür zuständig, die Stromversorgung zu pflegen, auszubauen, zu reparieren, wenn es nötig ist – dafür Sorge zu tragen, dass sie erhalten bleibt.
Diese Männer sind dann auch dafür zuständig, das Geld einzusammeln. Was für die Benutzung nötig ist.
hpd: Wie? Ich habe ja immer noch nicht raus, wie das funktioniert. Die Diskrepanz besteht für mich darin, dass die Leute eigentlich nur ihre Geräte bezahlen, aber trotzdem regelmäßig etwas abgeführt werden muss.
Schopp: Aber nur soviel, wie sie sonst bezahlt hätten für das Öllampenlicht.
hpd: Sie bezahlen also weiterhin soviel, wie sie ohnehin bezahlt hätten und dafür erhalten sie jetzt Licht, Radio– was auch immer.
Schopp: Soviel, wie sie selber finanzieren können.
hpd: Was fällt darunter? Ventilator, Kühlschrank – Kühlschrank haben nur die Reichen. Wie sieht es mit einer Waschmaschine aus?
Schopp: Nein, das gibt es nicht. Eine Waschmaschine braucht Druckwasser, braucht mehr Leistung, um den Motor in Gang zu halten und braucht vor allen Dingen auch warmes Wasser. Eine konventionelle Waschmaschine würde das warme Wasser mit elektrischem Strom machen. Und das ist nicht gut. Das braucht zu viel Energie.
hpd: Einen Waschsalon kann man im Ort also nicht betreiben?
Schopp: Das wäre nicht anzustreben. Dafür gibt es vielleicht andere Maßnahmen. Das funktioniert aber auch. Der erste Ansatz ist ja, dass Licht dahinkommt, Licht für Afrika. Zum selben Preis wie für die Kibatari. Und Männer aus den Dörfern werden dazu befähigt, das System in Gang zu halten, zu pflegen und zu verwalten – und diese Männer können jetzt aus der Dorfgemeinschaft bezahlt werden! Das heißt, sie finden darin ihre Arbeit.
hpd: Für drei bis fünf Männer des Dorfes gibt es dann also Arbeit. Und diese können damit wiederum ihre Familien versorgen.
Schopp: Aus dem Grund ist es wichtig, dass in dem Dorf eine Struktur vorhanden ist, die das verwalten kann. Also ein Bürgermeister mit entsprechenden Kompetenzen und Verantwortungen, weil unter Umständen pro Tag eine ganze Menge Geld zusammenkommt. Natürlich nicht in der ersten Phase, sondern beginnend in der zweiten Phase, in der dritten Phase. In der vierten Phase – das sind meist zwei Jahre – ist das System so ausgebaut, dass es selbstverwaltend funktioniert.
Ein Dorf in dieser Größe, mit 162 Haushalten, mit bis zu 1200 Menschen, hat Tag und Nacht elektrischen Strom zur Verfügung. Und das im Prinzip selbst finanziert.
An der Stelle ist es ganz wichtig zu erwähnen: Das System funktioniert ja nicht unendlich. Da kann immer mal etwas kaputtgehen oder ausfallen. Und das, was kaputtgeht und ausfällt oder was für den Ausbau nötig ist, kann aus dem Geld finanziert werden, was gesammelt wird. Es müssten ja nicht genau 38 Cent gezahlt werden wie vorher mit den Öllampen. Es könnte auch weniger sein. Weil das Projekt ja zu 100 Prozent finanziert ist. Aber was geschenkt ist, ist nichts wert. Die Leute bezahlen also dafür, dass die Technik da ist.
Und wenn ich für die Technik bezahle, kann ich auch mit dem gesammelten Geld Gerätschaften ersetzen, die kaputtgehen. Nach etwa zehn bis zwölf Jahren wird der Batteriespeicher zu erneuern sein. Länger kann der nicht halten. In meinem Konzept hält der Speicher satte zehn Jahre, zwei Jahre sogar mit Vollgarantie. Zwei Jahre kann ich leisten von Europa nach Afrika, und zehn Jahre pro rata. Pro rata bedeutet, wenn die Batterie nach den zwei Jahren Vollgarantie, zum Beispiel im siebten Jahr ausfällt, dann bezahlt die Dorfgemeinschaft für die neue Batterie siebzig Prozent. Und der Lieferant dreißig Prozent.
Oft wird gefragt: Wie soll sich das denn finanzieren? Ja – von selber! Im Prinzip könnten die Leute ein Darlehen zurückzahlen. Wenn ein afrikanisches Dorf für ihre eigene Stromversorgung in Europa ein Darlehen bekommen würde, wäre das eine tolle Sache.
hpd: Wenn ich mir dein Papier anschaue, sehe ich, dass es in dem Beispiel immer noch einige Häuser gibt, die keine Stromversorgung haben. Warum haben sie die nicht?
Schopp: Entweder sind sie zu weit außerhalb oder die Häuser sind in einem so schlechten Zustand, dass es nicht sinnvoll ist, dort Strom reinzulegen.
hpd: Das heißt, diese Leute sind am ärmsten, denn ansonsten hätten sie ja bessere Häuser.
Schopp: Genau. Und an der Stelle kann auch die Verantwortung eines Dorfes einsetzen, sich um die Ärmsten in ihrer Bevölkerung zu kümmern.
hpd: Indem sie ihnen helfen, ein besseres Haus zu bauen oder in einer sonstigen Weise helfen.
Schopp: Genau.


hpd: Was mich noch interessiert: Wie kann ich mir einen solchen Container vorstellen? Ist das einfach so ein Klotz, der irgendwo steht? Kann man den betreten? Ist er mit Sonnenkollektoren übersät? Und wie sind die Kollektoren geschützt?
Schopp: Den Container kann man betreten. Die Kollektoren sind außerhalb, bis zu 100 Metern entfernt. Der Container ist die zentrale Energieversorgungseinheit, der zentrale Verteiler.
hpd: Der Strom wird dorthin geleitet?
Schopp: Ja.
hpd: Die Kollektoren stehen an freier Stelle auf einem Feld. Wie sorgt man dafür, dass sie nicht beschädigt werden?
Schopp: Das machen die Leute schon selber. Beschädigung ist ein Punkt. Diebstahl allerdings viel weniger.
hpd: Warum soll man die Kollektoren auch klauen, wenn man nichts damit anfangen kann?
Schopp: Man kann schon etwas damit anfangen. Aber es würde auffallen, wenn ich als Afrikaner, der Landwirtschaft betreibt, plötzlich ein riesengroßes Solarmodul auf dem Dach liegen hätte. Das kann ich mir in der Regel nicht kaufen und auf dem Wochenmarkt bekomme ich die Dinger auch nicht. Also habe ich es irgendwo gestohlen.
hpd: Gut, die Kollektoren werden nicht geklaut, weil das auffallen würde. Aber hier in Europa, in Deutschland wäre das ein anderesProblem, wenn man auf dem Feld einen solchen Kollektor aufbauen würde, weil jeder Dieb behaupten könnte, er habe den gekauft.
Schopp: In Afrika wird ein Zaun darum gebaut, damit keine Kühe zwischendurch laufen und damit sich Kinder beim Spielen nicht daran verletzen könne. Das sind die Gründe.
hpd: Wenn an der Anlage etwas kaputtgeht, wird dann jemand aus Europa kommen, um das in Ordnung zu bringen oder wie sieht das aus? Ich meine, zehn Jahre sind eine lange Zeit. In der Zeit könnten auch die Jungen studieren gehen und die Reparaturen dann selbst durchführen.
Schopp: Ja, weil es ganz normale Elektrotechnik ist, da ist nichts Spezielles dran, können die Leute das selber reparieren. Natürlich mit Anleitung und mit dem Material, das sie auch in Afrika bekommen können.
Es gibt natürlich schon spezielle Komponenten, die befinden sich aber im Container. Und wenn eine spezielle Komponente an einem Computer kaputtgeht, dann muss auch manchmal der Fachmann kommen. Oder ich kann mit dem Gerät zu einer Fachwerkstatt gehen, wo ich hoffentlich fachkundig beraten und unterstützt werde, damit mein Gerät wieder funktioniert.
hpd: Mit dem Container kann ich nicht zu einem Fachmann gehen, da muss der Fachmann schon kommen.
Schopp: Ja, und darum ist auch alles, was dort eingebaut ist, kleinteilig.
hpd: Ah, die kleinen Sachen kann man ausbauen und transportieren!
Schopp: Und es ist redundant: Wenn eine Komponente ausfällt, fällt dadurch nicht das ganze System aus.
hpd: Also nicht wie bei den Lichterketten, wenn eine Lampe kaputt ist, geht das ganze Ding nicht, sondern es ist alles autark. Redundant heißt das?
Schopp: Redundant.
hpd: Wenn ein Element ausfällt, funktionieren die anderen trotzdem. Und diese Akkumulatoren sind aus Blei oder enthalten Blei?
Schopp: Zum größten Anteil ist das Blei. Und das lässt sich recyceln, es wird auch in Afrika gesammelt, das ist ein sehr begehrter Rohstoff, und damit kann auch wieder Geld verdient werden. Afrikanische Firmen lassen in Afrika Akkumulatoren sammeln, nicht nur wegen des Umweltschutzes, sondern auch wegen der Rohstoffe.
hpd: Ist ja auch vernünftig. Sonst muss man sie irgendwo abbauen und Kriege führen, um Rohstoffe zu gewinnen. Wenn man sie aber hat, kann man sie ja nochmal verwenden. Die Solarzellen enthalten dann Silizium.
Schopp: Ja, das lässt sich auch recyceln. Und Solarmodule sollten in der Regel zwanzig bis dreißig Jahre funktionieren. Es kann natürlich eins kaputtgehen, muss dann aber nicht weggeschmissen werden. Das Recycling wird von europäischen Firmen organisiert, weltweit, dass beschädigte Solarmodule eingesammelt und zurückgeholt werden.
hpd: Kann man das Material denn zu 100 Prozent wieder verwenden?
Schopp: Die Aluminiumrahmen können verwertet werden. Die Laminate können getrennt werden, um an die Wafer zu kommen, das heißt an die Siliziumscheiben. Das Glas, das die Module abdeckt, kann auch recycelt werden. Das Silizium ist das Wertvollste an der ganzen Sache, das kann dann wieder genutzt werden. Es gibt eine Wertstoffverordnung, dass Produkte zu einem sehr hohen Anteil recycelt werden können.
hpd: Das ist doch gut und das, worauf ich immer hinaus möchte: Dass Produkte zu 100 Prozent oder nahezu 100 Prozent wieder verwertet werden können, dass die Rohstoffe herausgewonnen werden können. Gerade so wertvolle und zum Teil seltene Rohstoffe wie Silizium und Aluminium.
Schopp: Genau.
hpd: Vielen herzlichen Dank für das informative Gespräch!
Die Fragen stellte Fiona Lorenz