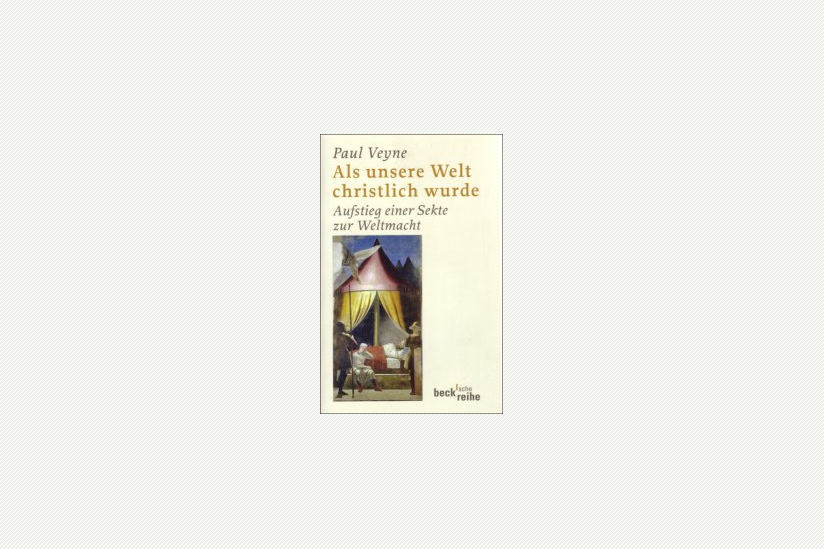BERLIN. (hpd) Kaiser Konstantin bekannte sich vor 1.700 Jahren zum christlichen Glauben, weil die neue Kirche seinem ehrgeizigen Charakter und seiner Ambition nach universaler Macht entsprach. So die These des französischen Althistorikers und Atheisten Paul Veyne. Die andere Seite der Medaille, laut Veyne: Ein perfekt aufgestellter Kirchenapparat wusste seinerseits genauso die Macht eines Kaisers zu nutzen.
Nähern wir uns auf einem Umweg: Es gab sie nicht, die eine große Hinwendung zur Innerlichkeit. Rom zu Beginn des 4. Jahrhunderts – alles war möglich in der spätantiken Metropole. Kunststile gab es so viele wie Moden. Ein ganzes Spektrum von der x-ten Auflage der griechischen Klassik über einen populistisch propagandistischen Kunststil, einen martialischen und einen kargen Stil bis hin zu einer neuen expressionistischen, ja fast abstrakten Kunst, die sich bewusst und durch einen gewollten Primitivismus auszeichnete. Den adaptierte später das Christentum.
Doch alle Elemente dieses Stils gab es schon vorher. Auf den Mosaiken der nordafrikanischen Latifundien in Cherchell im 3. Jahrhundert etwa, wie der französische Altistoriker Paul Veyne 2005 in seinem Werk „Die Kunst der Spätantike. Geschichte eines Stilwandels“ nachwies, biegen sich fragile Gestalten bereits geradezu byzantinisch. Einzelne Künstler experimentierten mit Formen und schufen sich ihre eigenen Markenzeichen, woraus sich später ein Formenkanon herausbildete, der zu einem neuen Weltempfinden passte, das im Christentum allgemein wurde.
Nicht minder groß war das Religionsangebot seinerzeit. Altäre für die antiken Götter gab es allenthalben, nur glaubte an sie keiner mehr richtig. Oder man wählte sich seinen Gott für die eigenen Bedürfnisse und gemäß persönlicher Affinitäten aus. Erfüllte der eine Gott nicht so recht die Wünsche, entschied man sich eben für einen anderen. Alles ging. Als Kaiser Konstantin sich am Vorabend der Schlacht an der Milvischen Brücke am 28. Oktober 312 gegen Maxentius, der damals das Westreich usurpierte, entschied, seine Banner mit dem Zeichen des Christentums zu versehen, da nahm eine Entwicklung ihren Lauf, die man gewöhnlich als die Geburt des christlichen Abendlandes bezeichnet. Es war die entscheidende Schlacht auf dem Weg zu Konstantins Alleinherrschaft und bedeutete das Ende der tetrarchischen Ordnung Diokletians, der Vierkaiserherrschaft.
Konstantin folgte einem Traumgesicht, aber sind nicht alle Träume vom Unbewussten visualisierte eigene Entscheidungen, mutmaßt Veyne in seinem neuesten Werk. Geschichte hat die Tendenz, uns immer nachträglich so zu erscheinen, als hätte sie nicht anders laufen können. Paul Veyne beschreibt in seinem jüngsten Essay „Als unsere Welt christlich wurde. Aufstieg einer Sekte zur Weltmacht“, die Faktoren im Falle Konstantins und des Erfolges des Christentums als durchaus kontingent.
Ein junger ehrgeiziger Kaiser fühlte sich angezogen von einer Religion, die anders war als die herkömmlichen. Man erbte sie nicht je nach Region, in der man geboren wurde und aufwuchs, von den Vorvätern. Es war die Zeit, da man sich noch zu ihr bekennen musste, um ihr anzugehören. Wie das bei Sekten so ist. Sie wies dafür aber dann jedem einzelnen einen Platz zu im großen Welttheater, auch dem Geringsten mindestens eine Statistenrolle in einem Drama, in dem es um den Sieg des Guten ging. Konstantin selbst aber fühlte wohl, dass auf ihn hier nicht weniger als eine Hauptrolle wartete.
Diese Sekte forderte jeden einzelnen. Auch Opfer, das Leben vielleicht, doch am Ende stand ja die Auferstehung, ein neues Reich. Durch das Bekenntnis zu dieser Religion konnte man zum Gelingen der Geschichte beitragen. Sie hatte nicht nur den Reiz des Avantgardistischen. In ihr klingt die Parole an: Frage nicht, was du bekommen kannst, frage, was du tun kannst, für das Ganze. Später war mit dem Ganzen die Staatsreligion und noch viel später der Staat gemeint. Es steckt, so lässt sich folgern, die Säkularität irgendwo verborgen schon im Christentum selbst.
Veyne räumt mit der oft kolportierten Lehrmeinung auf, dass das Christentum eine Religion der Armen und der Schwachen war, der Außenseiter. Im Gegenteil, ihre Gläubigen fühlten sich als Elite, waren bereits durchaus militant organisiert. Haben wir mit Veynes These über die spätantike Kunst erfahren, die Kunst jener Zeit mit den Augen der modernen Kunst zu betrachten, lernen wir in seinem zweiten Essay das frühe Christentum durch die Heilsversprechen des 19. und 20. Jahrhunderts zu verstehen. Die kommunistische Partei hat nicht das Christentum säkularisiert, die christliche Kirche verfügte schon seinerzeit über einen perfekten Apparat gleich dem der linken Funktionäre. Ihre Funktionsträger wussten dementsprechend auch auf Anhieb, die Entscheidung des Kaisers für sich zu nutzen. An Kirchengründungen sparte Konstantin nicht. Die junge Kirche forderte den Einsatz jedes Einzelnen und bekam nun die Unterstützung und die Protektion eines Kaisers.
Der jedoch war Staatsmann genug, das Christentum eben nicht zur Staatsreligion zu erheben, sondern zur persönlichen Religion des ersten Mannes des römischen Staates, des Kaisers. Das war eine Frage der Staatsraison. Waren jedoch bislang die römischen Kaiser Götter gewesen, so machte sich nun ein Kaiser zum Diener eines Gottes. Und eines Apparates, für den Universalität zum Programm gehörte. Dieser Universalitätsanspruch war dem Kaiser durchaus verständlich, hatte er ihn doch auch. Die Militanz der jungen Religion zog ihn an, sie entsprach seiner eigenen Militanz. Ohne diese Parallelen wäre es wohl nie zu der Hinwendung Konstantins zu der Religion gekommen, zu der sich damals nur fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung des Römischen Reiches bekannten, und nie zur Jahrhunderte währenden Macht der Kirche.
So wenig es die Geburtsstunde des christlichen Abendlandes gab, so wenig gibt es, meint Paul Veyne, das christliche Abendland. Veyne greift hier offensichtlich ein in eine aktuelle Debatte, wenn er konstatiert, dass Europa im Laufe der Geschichte entscheidend von der Aufklärung geprägt wurde. Es hat im Laufe der Epochen viele Entwicklungen aufgenommen, von denen das Christentum eben nur eine war. Und umgekehrt: Die Kirche drückte in ihren vielen Erscheinungsformen eigentlich immer vor allem ihre Zeit aus. Wozu auch gehörte, dass sie zur Zeit Konstantins gegen Sklaverei an sich eigentlich nichts einzuwenden hatte und - viel später - von Menschenrechten erst sprach, als die Philosophen sie längst so eindringlich proklamiert hatten.
Simone Guski
Paul Veyne: „Als unsere Welt christlich wurde. Aufstieg einer Sekte zur Weltmacht.“ C.H. Beck Verlag. beck´sche reihe. München 2011, 222 Seiten 12,95 Euro