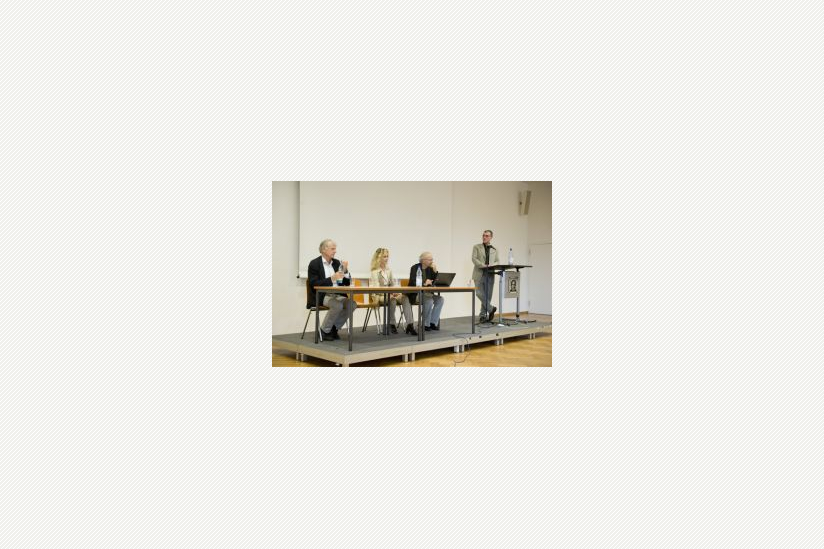FRANKFURT/M. (hpd) Inwieweit können uns die Neurowissenschaften behilflich sein, moralische und ethische Standards zu setzen? Zum Teil intensiv diskutiert wurde diese Frage von den Philosophen Peter Singer, Kathinka Evers und dem Neurowissenschaftler Wolf Singer, die ihrerseits selbst umstritten sind, was entsprechende Einwürfe ihrer Gegner unterstrichen.
Anlässlich des 14. Treffens der Nachwuchsgruppe „Philosophie des Geistes“ und der Verleihung des Barbara Wengeler-Preises 2011 der Barbara Wengeler-Stiftung im Rahmen des Frankfurt Institute for Advanced Studies (FIAS) an der Universität Frankfurt gab es zum Thema „Ethics and Neuroscience“ eine Podiumsdiskussion mit den Professoren Kathinka Evers (Uppsala), Peter Singer (Princeton) und Wolf Singer (Frankfurt), die von Thomas Metzinger moderiert wurde. Eine anspruchsvolle Thematik, die zudem komplett in Englisch diskutiert wurde.



Peter Singer begann seinen halbstündigen Vortrag „What can Neuroscience tell uns about Ethics!“ mit dem Anliegen, er wolle Hilfe und Belege von den Neurowissenschaften, ob bzw. ab welchem Punkt Lebewesen Gefühle und Schmerzen empfänden. Dies sei wichtig für das Verständnis der Moral. Daher konzentrierte er sich auf Moraltheorien, auf die Frage, in welchen Gehirnregionen moralische Urteile gefällt werden sowie auf andere Themen, die mit Hilfe der Neurowissenschaften und Evolutionspsychologie beantwortet werden können. Die Relevanz diesbezüglicher Forschung für unser Verständnis von Moral sollte Ziel der Diskussion sein.
Drei „selbst evidente“ ethische Axiome
Obgleich dies ein neues Forschungsfeld darstellt, bezog sich Singer immer wieder auf den Philosophen Sidgwick, einem rationalen Intuitionisten und Utilitaristen, der bereits 1874 in „The Methods of Ethics“ drei moralische Axiome aufstellte. Sidgwick schrieb, jede tadellose Theorie der Ethik müsse auf einem oder mehreren Prinzipien gründen, die wir intuitiv als „selbst evident“ erfassen.
- Fairness oder Gleichheit: Was für mich richtig und falsch ist, muss nicht für jemand anderen richtig und falsch sein. In einer Interpretation von Kants Imperativ kann man sagen: Wenn ich eine moralische Leitlinie für andere aufstelle, muss diese unter den gleichen Gegebenheiten auch für mich gelten.
- Besonnenheit: Allen Anteilen unseres bewussten Lebens gilt unsere „Zuwendung“ gleichermaßen. Ein angenehmes Erlebnis heute ist ebenso wichtig wie ein angenehmes Erlebnis in zehn Jahren.
- Unparteilichkeit: Das Wohl eines anderen Menschen ist ebenso wichtig wie mein Wohl.
Sidgwick meinte, es handele sich dabei um Wahrheiten, nicht nur um subjektive Präferenzen. Weiter war Sidgwick der Ansicht, die Kenntnis um die Herkunft des Sittlichkeitsgefühls, unsere Fähigkeit, moralische Wahrheiten zu verstehen, könne dazu führen, moralischen Wahrheiten zu misstrauen und diese komplett zu diskreditieren. Wir glaubten, wenn wir die Ursache einer Überzeugung kennen würden, diese Überzeugung sei falsch. Dies führe letztlich zu einem vollständigen Skeptizismus allem gegenüber, was aber keine vertretbare Position sei. Vielleicht, so Peter Singer, widerlege das, was wir von der Evolutionspsychologie und den Neurowissenschaften lernen, weder moralischen Realismus noch moralischen Objektivismus und höhle vielleicht insbesondere Sidgwicks Axiome nicht aus, sondern unterhöhle andere moralische Belange. Inwieweit also können die Forderungen Sidgwicks angesichts neuer Belege zur Moral heute noch überleben?
Zwei widerstreitende Gehirnareale
Ein Blick auf neuere Arbeiten etwa von Josh Green, dessen Buch „The Moral Brain“ demnächst erscheine, könnte diese Frage eventuell beantworten. Josh Green stellte Menschen vor moralische Dilemmata und beobachtete dabei mittels funktioneller Magnetresonanztomographie ihre Gehirntätigkeit. Er stellte zum besseren Verständnis eine „ziemlich nette“ Analogie der ethischen Entscheidungen mit verschiedenen Kameraarten her:
- „Point and shoot“ - Draufhalten und schießen (Autofokus etc.), ergibt meist ein recht gutes Foto
- Kameras, die manuell eingestellt bzw. justiert werden
Bezüglich unserer moralischen Urteile funktionieren verschiedene Gehirnareale in dem einen oder im anderen Modus, nämlich zum einen im„point and shoot“-Modus, dieser sei gewissermaßen „automatisch“ und intuitions- bzw. emotionsbasiert, zum anderen im „manuell“-Modus, dieser beinhaltet reflektierte, bewusste Prozesse.
Anhand verschiedener Beispiele konnte Singer verdeutlichen, dass wir Menschen eher darauf anspringen, auch fremde, entfernte Individuen zu retten oder ihnen zu helfen, als einer undefinierten Gruppe. Selbst wenn beim Nachdenken klar wird, dass es ungerecht wäre, nur dieser Person zu helfen bzw. dass das gespendete Geld nicht nur dieser Person zugute kommen wird. Wir sind grundsätzlich auf „point and shoot“-Modus eingestellt.
Darüber hinaus scheint es eine Rolle zu spielen, ob wir mithilfe des Umlegens eines Schalters jemanden töten oder ihn mittels Körperberührung töten müssten, wie Josh Green anhand seiner „Trolley-Experimente“ zeigte – im ersten Fall haben Menschen weniger Probleme und sehen geringere moralische Dilemmata als im zweiten. Doch warum? Wir Menschen haben im Laufe der Evolution eine Abneigung dagegen entwickelt, Menschen mit Berührungen zu töten. Abstraktere Formen des Tötens wie Bomben, das Umlegen von Schaltern oder das Öffnen einer entfernten Falltür sind allerdings noch nicht lange Zeit möglich, weshalb wir dagegen noch keine Abneigung entwickelt haben. (Diese Erklärung ist allerdings umstritten, wie sich später in der Diskussion zeigte.)
„Point and shoot“ nicht immer sinnvoll
Nicht immer sind die automatischen, intuitiven Reaktionen die besten. Sie korrespondieren zwar mit deontologischen Entscheidungen in dem Sinne, dass man einen anderen nicht als ein Mittel, sondern nur als Zweck verwenden sollte. Oder man gegen seine Rechte verstieße, ein Versprechen bräche oder etwas stehlen würde – die diversen Entscheidungen, die wir treffen, ohne die Konsequenzen zu berücksichtigen, dabei aber an bestimmte moralische Regeln denken. Darüber hinaus mögen die Regeln im Alltag funktionieren, aber nicht in jeder denkbaren Situation.