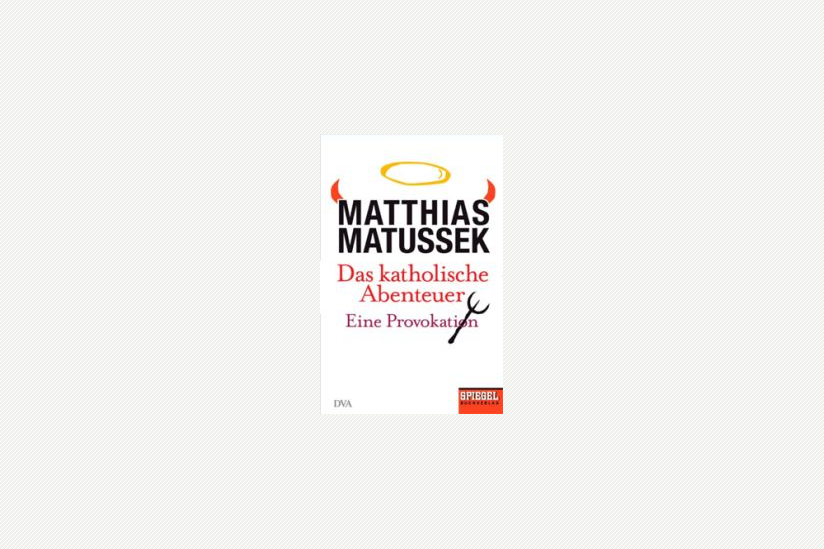(hpd) Wenn ein ehemaliger Feuilleton-Chef des SPIEGELs und begeisterter Katholik – eine etwas ungewöhnliche Kombination – ein streitbares Bekenntnisbuch vorlegt, kann ihm Aufmerksamkeit gewiss sein. „…es zischt und kracht in diesem Buch Seite für Seite“, schrieb ein Rezensent übertrieben, aber große Sprachkraft muss man dem vielgereisten Journalisten in der Tat zubilligen – und Mut zum Exhibitionismus.
Viele positive Attribute hat man für dieses Buch Das katholische Abenteuer gefunden: es sei ein Sprachkunstwerk, ein berührendes Selbstzeugnis, gebildet, klug usw. Erfährt man dann noch, das Buch sei „leidenschaftlich katholisch“ und ein Kurienkardinal habe es in Rom vorgestellt, so muss man freilich kein Ungläubiger sein, um sich schon hier ein großes inneres Fragezeichen zu malen. Als hervorstechendes Merkmal der Schrift sei aus Sicht des Rezensenten hervorgehoben: Der Mut zu diesem Exhibitionismus. Dass man des Öfteren auch zustimmend nicken kann bei mancher (freilich nicht neuer) Kritik an Erscheinungen des Zeitgeistes, das nur nebenbei.
Erzkatholische Sozialisation
Konzentrieren will ich mich auf die speziell katholischen Sichtweisen mit ihren Emotionen und Begründungen. Die Wichtigkeit kindlicher Sozialisation für die weltanschauliche Einstellung zeigt sich auch an der Vita Matusseks. Aufgewachsen mit vier Brüdern im „rabenschwarzen“ Münster in der klerikal-katholisch dominierten Adenauer-Ära, war seine Kindheit vom Fussball bestimmt, aber mehr noch vom Kirchenkalender, vom Tischgebet, Rosenkranzgebet vor dem Hausaltar. Gebetet wurde auch, wenn man den Schlüssel verloren hatte (zum hl. Antonius) usw. Sonntagsmesse und Marienandachten waren selbstverständlich, und der päpstliche Ostersegen im Fernsehen bewirkte den Erlass der Sündenstrafen. Klein-Matthias spielte mit seinem Bruder Messe in der Kutte, und Vater half beim Ausfüllen der Beichtzettel, wenn er auch dabei überlistet wurde. Ein Psychologe könne als Resultat dieser Erziehung vielleicht erschwerte Religionsvergiftung diagnostizieren, für ihn, so Matussek, sei es aber eine „glückliche und beschirmte Kindheit“ gewesen. „Dieser Kinderglaube hat ein Reservoir angelegt wie einen unterirdischen See“, bekennt er (58 ff.). Der Autor fasst zwar zusammen: „Versunkene Welt“ und spricht von seiner Kindheit als religiös inniger „frommer Hokuspokus“. Auf derselben Seite (62) schreibt er aber auch, er sei bei seinem Kindheitsglauben hängen geblieben und damit in guter Gesellschaft. „Heiliger Vater“ ist für ihn eine „wunderbare Anrede“ (63).
Als junger Mann ist M. plötzlich seinem Kinderglauben „längst entwachsen“ (73) und wendet sich dem Marxismus-Leninismus zu, der Meditation und Rauschmitteln. Die bewegte Lebensreise endet in einem vorläufigen konzentrierten Credo: an einen persönlichen Schöpfergott, Jesus Christus (dessen Natur offen bleibt), eine unsterbliche Seele, an den Menschen als Mittelpunkt der Schöpfung und die Sündenvergebung in der Beichte. Dass es ein Leben nach dem Tod gibt, wünscht sich M. nur. Vielleicht am Erstaunlichsten: „Ich glaube, dass die katholische Kirche trotz ihrer zahlreichen Verschattungen und Fehler jedes Recht hat, stolz auf ihre Geschichte zu sein und auf all das, was sie an Gutem bewirkt.“ (78)
Eigentore
Mit seinem Gotteskapitel verhebt sich Matussek. Der großsprecherische Untertitel „Einige Argumente für den Glauben, die das atheistische Team blass aussehen lassen…“ lässt zu Recht eine intellektuelle Blamage erwarten. Dass M. Leute einfach nicht versteht, „die an gar nichts glauben“, ist eine ebenso billige wie falsche Phrase. Oder will er tatsächlich Andersdenkende, die (teilweise) andere (nicht: gar keine!) Grundüberzeugungen haben, gar nicht als Leser? Wenn er „Wissenschaftsatheisten“ vorwirft, ihr Determinismus sei so schlimm wie die Erbsündentheologie des Augustinus (der Mensch sei nichts, wenn nicht aus Gottes Gnade), so sagt er zwar nichts Dümmeres als etliche heutige Philosophen. Aber mit den Ergebnissen der aktuellen Hirnforschung hat das nichts zu tun: Problem nicht erkannt (von der Problematik der Begriffsdefinitionen einmal abgesehen). Die Wiederholung der konservativen Behauptung, eine glaubenslose Gesellschaft verliere ihre Werte, ist intellektuell auch nicht besser (dazu Ursula Neumann) Und der schlichte Hinweis darauf, Darwin und Max Planck hätten an Gott geglaubt, ist für Matussek bereits ein Traumtor gegen die Atheisten. Dabei hat Darwin zwar die Existenz „Gottes“ nie dezidiert verneint, war aber doch zumindest in seinen letzten Jahren Agnostiker. Und Planck könnte man neben vielen Anderen Albert Einstein entgegensetzen: „Was sie über meine religiösen Überzeugungen lesen, ist natürlich eine Lüge…Ich glaube nicht an einen persönlichen Gott und habe das… immer klar zum Ausdruck gebracht.- Der Gedanke an einen persönlichen Gott ist mir völlig fremd und kommt mir sogar naiv vor.“ Traumtore sehen anders aus.
Zur Untermauerung der Plausibilität seiner Gottesthese stellt M. (S. 101) ohne nachprüfbare Quellenbenennung die ebenso unmaßgebliche wie zweifelhafte Behauptung auf, 70% der (deutschen?) Bevölkerung glaubten an einen Schöpfergott. Aber wenn schon Statistik: Interessanter als der bloße (auch deistische) Schöpfergott wäre der persönliche Gott. Und an den glauben in Deutschland ausweislich etlicher repräsentativer Umfragen seit langer Zeit nur noch maximal 25% (so schon die ALLBUS-Studie 2002), und über 50% bezeichnen sich als „nicht religiös“. Das ist nur eines von vielen Beispielen für große Oberflächlichkeit. Ein noch ärgerlicheres ist die Behauptung, die „Abschaffung“ des Religionsunterrichts in Berlin und Ersetzung durch das Fach Ethik sei ein Skandal. Eher ist es ein Skandal, mit welch fundamentaler Unkenntnis ein prominenter Journalist über eine massive kirchlich-politische Lügenkampagne hinweggeht, denn an eine Verschlechterung oder gar Abschaffung des traditionellen Status des Religionsunterrichts in Berlin war zu keinem Zeitpunkt gedacht. Noch eins zur journalistischen Sorgfalt: Was, bitte schön, ist die „Schönstedt-Bewegung“ (S. 199), ist etwa die Schönstatt-Bewegung gemeint?
Referenzpersonen
Zu den Personen, die Matussek mag, gehört Mutter Teresa (45f.). Diese Ikone der Nächstenliebe ist aber durchaus umstritten, u.a. ihre Devise, eine Krankheit sei wie ein Kuss Jesu, so dass in den Einrichtungen ihres Ordens auch Sterbenden Schmerzmittel versagt wurden. Auch berichteten Ärzte im Jahr 2010 SWR-Journalisten von erbärmlichen hygienischen Zuständen (nicht anders als zu Lebzeiten Teresas), Nachforschungen vor Ort wurden unterbunden. - Eine weitere Referenzperson M.‘s ist der kath. Philosoph Robert Spaemann (extremer Lebensschützer; er hat bei den Essener Gesprächen 1995 vor Juristen ernsthaft vorgetragen, wegen der unbedingten sittlichen Pflicht zur Gottesverehrung müsse der deutsche Staat diese privilegieren, Gott sei der „Legitimationsgrund allen Rechtes“; Sp. ist auch Verfasser des abstrusen Büchleins „Der letzte Gottesbeweis“, 2007). - Erzbischof Dyba widmet M. respektvoll das interessante Kapitel „Die Axt Gottes“. Einer von Dybas Leitsätzen lautete: „Eine Gesellschaft ohne Glauben ist eine Gesellschaft ohne Moral.“ (zum Unsinn solcher Diffamierung.) Dass das einen ungeheuren gesellschaftsspaltenden Affront gegenüber allen Nichtreligiösen darstellt, kommt M. nicht in den Sinn. Den solitären Ausstieg Dybas aus der kirchlichen Schwangerenkonfliktberatung mit Bescheinigung (staatsfinanzierte „katholische Beratungsindustrie“) bewundert er anscheinend.
Besondere Verehrung bringt der Autor Joh. Paul II. und Benedikt XVI. entgegen. Beide hält er für Glücksfälle. Joh. Paul II. sei gar ein „Jahrtausend-Papst“ (S. 217). Kritikwürdiges scheint er trotz seines 26-jährigen Pontifikats nicht gefunden zu haben, nicht einmal manche Ungeheuerlichkeit bei Südamerikareisen. Die überstürzte Heiligsprechung des Gehorsams- und Glaubensfanatikers Josemaría Escrivá, Gründer der Lieblingsorganisation des Papstes, nämlich des demokratiefeindlichen Opus Dei, lässt Matussek immerhin unkommentiert. Zu Benedikt XVI. erklärt er, schon die erste Enzyklika (Deus caritas est) zeige „rhetorische Brillanz und menschenkluge Tiefe“, er habe ein „wundervolles Jesus-Buch“ herausgebracht, mit dem ihn der Papst „als Schriftsteller fasziniert“ habe (S. 234). In diesem Buch (2007), sei angemerkt, zeigt der Papst seine Verständnislosigkeit gegenüber Religionskritikern auch mit Hilfe moralischer Diffamierung. Liberale Theologen mag M. offenbar generell nicht (49 f.).
Weitere Vorlieben
M. hält große Stücke auf die Zehn Gebote, ohne deren Drohcharakter einerseits, Banalität andererseits und ihre fehlende Eignung für die heutigen komplizierten ethischen Fragen zu erkennen (vgl. H.-W. Kubitza, Der Jesuswahn, Marburg 2011, 333 ff.). An der katholischen Kirche schätzt er u.a. die 2000-jährige Tradition, Gebet und Messe (insbesondere in ihrer tridentinischen Form, S. 63), das Rosenkranzbeten ist ihm eine „großartige Meditation“ (S. 112 f.), die Aufrechterhaltung des Pflichtzölibats (der Zölibatär als „auratische Figur“) erkennbar ein großes Anliegen (S. 49, 50 ff., S. 199, 205, 241 f.). Dass innerhalb derselben Papstkirche der Zölibat in den orientalisch-katholischen Kirchen für die einfachen Priester nicht Pflicht und praktisch die Ausnahme ist, interessiert den Autor nicht.