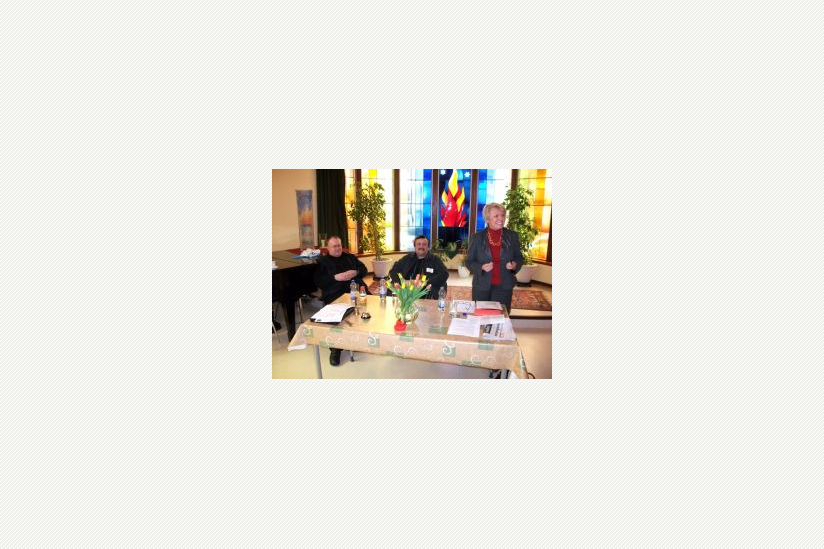LUDWIGSHAFEN (hpd) Dass es sich bei dem umgangssprachlich „Gotteslästerungsparagraph“ genannten § 166 StGB um „ein strafrechtliches Relikt“ handelt, war unter den Anwesenden unumstritten. Wie die „Religiöse und weltanschauliche Meinungsfreiheit“ angesichts des Blasphemie-Verbots in fast allen europäischen Staaten verteidigt werden kann, war Thema der gemeinsamen Tagung von Dachverband Freier Weltanschauungsgemeinschaften (DFW) und Internationalem Bund der Konfessionslosen und Atheisten (IBKA).
Allerdings ist der § 166 StGB nur ein Instrument staatlicher Kommunikationskontrolle und es gibt viele andere Möglichkeiten, den Diskurs über Religion zu steuern. Dies wurde schon in den einleitenden Statements klar. Doch lassen sich an diesem Paragraphen beispielhaft einige Punkte herausarbeiten, die generell von Bedeutung sind, wenn Religion mit Kritik in Berührung kommt. Volker Mueller (DFW) und Rudolf Ladwig (IBKA), die die Tagungsleitung übernommen hatten, lenkten die Aufmerksamkeit auf den fragwürdigen Begriff der „religiösen Gefühle“. Zum einen ist völlig unklar, was dies sein soll (was deutlich wird, wenn wir überlegen, was denn mit anderen gesellschaftlichen Subsystemen verknüpfte Gefühle sein könnten: sportliche Gefühle, literarische Gefühle, politische Gefühle usw.). Doch selbst wenn sie sich sauber definieren ließen, bliebe die Frage, warum bestimmte Gefühle religiöser Menschen anderen Gefühlen gegenüber bevorzugt behandelt werden sollen, indem sie unter besonderen rechtlichen Schutz gestellt werden. Auch die bei Diskussionen um religiöse Angelegenheiten immer wieder feststellbare Strategie, auf öffentliche Empörung anstatt auf Argumente zu setzen, um so Druck auf Publizisten oder Künstlerinnen auszuüben, ist kennzeichnend für § 166-Verfahren.
Einführende Kurzreferate
 Nachdem die Tagungsleitung das Problemfeld umrissen hatte, beleuchteten drei 20-minütige Kurzreferate einzelne Aspekte tiefer gehend. hpd-Redakteur Gunnar Schedel gab einen Überblick über die Rahmenbedingungen, innerhalb derer der § 166 StGB seine Wirkung entfaltet. In jeder Gesellschaft gebe es Tabus, die auch mit juristischen Mitteln aufrechterhalten würden. Was als Tabu gilt, unterliege nicht zuletzt den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen (so war es konservativen Kreisen in der Union in den 1990er Jahren nicht gelungen, einen eigenen Paragraphen, der die Bundeswehr gegen Kritik immunisieren sollte, einzuführen). Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass Religionsfreiheit nicht als Recht, sondern als Zustand verstanden werde. Wenn es vermehrt notwendig wird, diese Freiheit einzuklagen, sei dies bereits ein deutliches Anzeichen dafür, dass sie im Alltag allmählich verloren geht; dann, so der Verleger, lasse sie sich auf Dauer mit juristischen Mitteln nicht verteidigen. Augenblicklich geben die Zustände in Deutschland diesbezüglich keinen Anlass zur Sorge. Der § 166 könne seine volle Wirkung heute unter anderem auch deshalb nicht mehr entfalten, weil durch die zunehmende Säkularisierung vielen Menschen das Verständnis für das „Heilige“, das Unangreifbare, fehle. Allerdings seien auch gegenläufige Tendenzen zu erkennen, wie sich an der undifferenzierten und oft demagogischen Verächtlichmachung von Islamkritikerinnen zeige.
Nachdem die Tagungsleitung das Problemfeld umrissen hatte, beleuchteten drei 20-minütige Kurzreferate einzelne Aspekte tiefer gehend. hpd-Redakteur Gunnar Schedel gab einen Überblick über die Rahmenbedingungen, innerhalb derer der § 166 StGB seine Wirkung entfaltet. In jeder Gesellschaft gebe es Tabus, die auch mit juristischen Mitteln aufrechterhalten würden. Was als Tabu gilt, unterliege nicht zuletzt den gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen (so war es konservativen Kreisen in der Union in den 1990er Jahren nicht gelungen, einen eigenen Paragraphen, der die Bundeswehr gegen Kritik immunisieren sollte, einzuführen). Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass Religionsfreiheit nicht als Recht, sondern als Zustand verstanden werde. Wenn es vermehrt notwendig wird, diese Freiheit einzuklagen, sei dies bereits ein deutliches Anzeichen dafür, dass sie im Alltag allmählich verloren geht; dann, so der Verleger, lasse sie sich auf Dauer mit juristischen Mitteln nicht verteidigen. Augenblicklich geben die Zustände in Deutschland diesbezüglich keinen Anlass zur Sorge. Der § 166 könne seine volle Wirkung heute unter anderem auch deshalb nicht mehr entfalten, weil durch die zunehmende Säkularisierung vielen Menschen das Verständnis für das „Heilige“, das Unangreifbare, fehle. Allerdings seien auch gegenläufige Tendenzen zu erkennen, wie sich an der undifferenzierten und oft demagogischen Verächtlichmachung von Islamkritikerinnen zeige.
Blasphemie und Meinungsfreiheit
 Rainer Statz, Mitglied im IBKA, stellte heraus, dass die Wiederherstellung der durch die Schmähung der Götter gestörten Ordnung – die ursprüngliche Grundlage der Verfolgung von Blasphemie – im demokratischen Rechtsstaat obsolet sei. Doch auch für den Schutz des öffentlichen Friedens habe der Paragraph aufgrund des liberalen politischen Klimas in Deutschland keine Funktion mehr. Dies zeige sich allein schon daran, dass Verurteilungen kaum noch vorkommen. Provokationen, die es bewusst darauf anlegen, Konflikte heraufzubeschwören, kritisierte Statz als unnötig. Die Messlatte legte er dabei allerdings anders an als allzu schnell beleidigte Religiöse oder die Polizei. So berichtete er von der erfolgreichen Feststellungsklage gegen das Verbot eines Motivwagens beim Münchner Christopher Street Day. Die Ordnungshüter hatten seinerzeit ganz offensichtlich auf den Protest eines fundamentalistisch eingestellten Passanten hin die Mitführung eines Wagens untersagt, auf dem der Papst als Befürworter von Kondomen zu sehen war. Auch wenn der Ruf nach Polizei und Staatsanwaltschaft unangebracht sei, so meinte Statz, hätten übrigens auch Ungläubige das Recht, sich, zum Beispiel angesichts pauschaler Verunglimpfungen durch bestimmte katholische Bischöfe, beleidigt zu fühlen.
Rainer Statz, Mitglied im IBKA, stellte heraus, dass die Wiederherstellung der durch die Schmähung der Götter gestörten Ordnung – die ursprüngliche Grundlage der Verfolgung von Blasphemie – im demokratischen Rechtsstaat obsolet sei. Doch auch für den Schutz des öffentlichen Friedens habe der Paragraph aufgrund des liberalen politischen Klimas in Deutschland keine Funktion mehr. Dies zeige sich allein schon daran, dass Verurteilungen kaum noch vorkommen. Provokationen, die es bewusst darauf anlegen, Konflikte heraufzubeschwören, kritisierte Statz als unnötig. Die Messlatte legte er dabei allerdings anders an als allzu schnell beleidigte Religiöse oder die Polizei. So berichtete er von der erfolgreichen Feststellungsklage gegen das Verbot eines Motivwagens beim Münchner Christopher Street Day. Die Ordnungshüter hatten seinerzeit ganz offensichtlich auf den Protest eines fundamentalistisch eingestellten Passanten hin die Mitführung eines Wagens untersagt, auf dem der Papst als Befürworter von Kondomen zu sehen war. Auch wenn der Ruf nach Polizei und Staatsanwaltschaft unangebracht sei, so meinte Statz, hätten übrigens auch Ungläubige das Recht, sich, zum Beispiel angesichts pauschaler Verunglimpfungen durch bestimmte katholische Bischöfe, beleidigt zu fühlen.
Größtmögliche Freiheit für die Kunst
 Wie Kunst und Religion (oder besser: deren Vertreter) miteinander in Konflikt geraten, führte Silvana Uhlrich, DFW-Referentin für internationale Jugendarbeit, anhand zahlreicher Beispiele vom Hollywoodfilm „Dogma“ bis zum „Ferkelbuch“ vor. Häufig sei Auslöser eines Konfliktes über ein Kunstwerk nicht dessen religionskritische Intention, allein die unorthodoxe Verwendung bestimmter Symbole oder der Einsatz „heiligen“ Personals könne genügen, religiös motivierte Zensurforderungen auszulösen (in dem keineswegs religionsfeindlichen Streifen „Dogma“ trat Gott als Frau auf). Uhlrich plädierte für größtmögliche Freiheit der Kunst und verwies darauf, dass gesellschaftliche Debatten oft ihren Ausgang von einer Provokation nehmen. Insofern könne in der Kunst durchaus erlaubt sein, was im Alltag unterlassen werden sollte. Respekt gegenüber Religionen sollte nicht von vorneherein als Grenze für die Kunst definiert werden.
Wie Kunst und Religion (oder besser: deren Vertreter) miteinander in Konflikt geraten, führte Silvana Uhlrich, DFW-Referentin für internationale Jugendarbeit, anhand zahlreicher Beispiele vom Hollywoodfilm „Dogma“ bis zum „Ferkelbuch“ vor. Häufig sei Auslöser eines Konfliktes über ein Kunstwerk nicht dessen religionskritische Intention, allein die unorthodoxe Verwendung bestimmter Symbole oder der Einsatz „heiligen“ Personals könne genügen, religiös motivierte Zensurforderungen auszulösen (in dem keineswegs religionsfeindlichen Streifen „Dogma“ trat Gott als Frau auf). Uhlrich plädierte für größtmögliche Freiheit der Kunst und verwies darauf, dass gesellschaftliche Debatten oft ihren Ausgang von einer Provokation nehmen. Insofern könne in der Kunst durchaus erlaubt sein, was im Alltag unterlassen werden sollte. Respekt gegenüber Religionen sollte nicht von vorneherein als Grenze für die Kunst definiert werden.