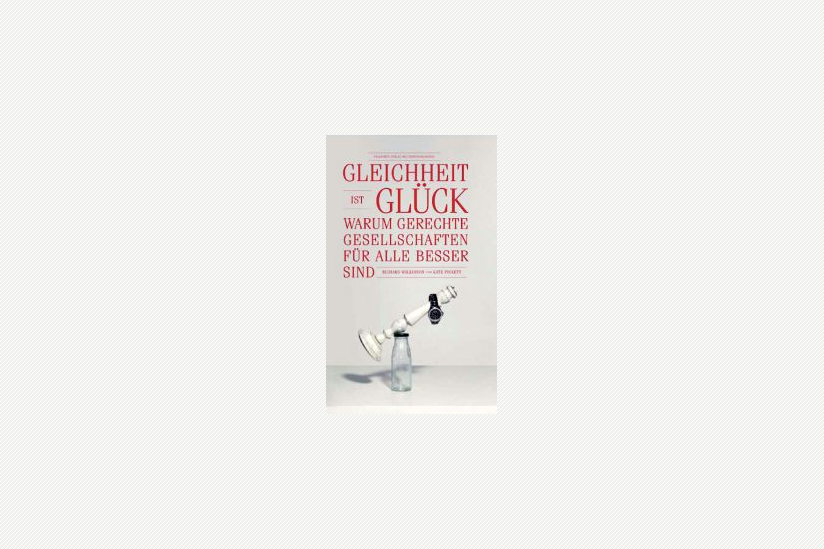(hpd) Die Anthropologin Kate Pickett und der Wirtschaftshistoriker Richard Wilkinson belegen in ihrem Buch „Gleichheit ist Glück. Warum gerechte Gesellschaften für alle besser sind“ anhand von umfangreichem Datenmaterial, dass in Ländern mit hoher Einkommensungleichheit die Gesundheits- und Sozialprobleme ebenfalls besonders hoch sind.
Durch eine vergleichende Betrachtung mit der Situation in den einzelnen US-Bundesstaaten und der kritischen Auseinandersetzung mit möglichen Einwänden, können sie anhand von harten Fakten die Notwendigkeit von mehr sozialer Gleichheit für die Überwindung gesellschaftlicher Probleme aufzeigen.
Bedarf die Entwicklung moderner Gesellschaften eines Mehr oder eines Weniger an Gleichheit? Über diese Frage wird in Medien, Politik und Sozialphilosophie kontrovers diskutiert. Der Beschwörung des Ideals der sozialen Gerechtigkeit steht die Einforderung des Leistungsprinzips mit sozialer Ungleichheit gegenüber. Doch was bedeutet die Ausrichtung von Gesellschaft und Politik nach den jeweiligen Prinzipien für das sozialen Miteinander der Menschen? Darüber äußern sich die Protagonisten der Debatte meist mit lautstarken Gesinnungsbekundungen, ohne empirische Fakten näher zur Kenntnis zu nehmen. Solche findet man in einer bemerkenswerten Studie, welche die Anthropologin Kate Pickett und der Wirtschaftshistoriker Richard Wilkinson unter dem Titel „Gleichheit ist Glück. Warum gerechte Gesellschaften für Alle besser sind“ veröffentlicht haben. Die darin enthaltene Position stellt aber keine bloße Meinungsäußerung unverbindlicher Art dar, können die Autoren dafür doch eine Fülle von statistischen Daten als überzeugenden Beleg präsentieren.
Dabei betrachten sie zunächst die Einkommensverteilung in den reichen Ländern bezogen auf den Unterschied zwischen dem Besitz der jeweils oberen und unteren zwanzig Prozent der Bevölkerung. Während in Ländern wie Japan, Norwegen oder Schweden eine vierfache Differenz besteht, kann in Staaten wie Großbritannien, Portugal oder den USA ein achtfacher Unterschied ausgemacht werden. Diese Angaben bringen Pickett und Wilkinson danach mit Daten über gesundheitliche und soziale Probleme in den jeweiligen Ländern in Verbindung. Hierbei stützen sie sich auf Informationen der OECD, UNO oder WHO zu dem Ausmaß von Kriminalität, dem Grad der Bildung, der Höhe der Lebenserwartung, dem Konsum von Drogen oder der Verbreitung von Depressionen. Um keinem methodischen Fehlschluss aufzusitzen, untersuchten die Autoren danach noch einmal gesondert die Daten zu diesen Fragen für die einzelnen Bundesstaaten der USA. Auch wenn die Unterschiede nicht so groß wie im internationalen Ländervergleich waren, vermittelte die Analyse das gleiche Bild:
Danach treten die „meisten ernsten gesundheitlichen und sozialen Probleme in den reichen Ländern dort stärker“ auf, „wo mehr soziale Ungleichheit herrscht. Die Korrelationen sind eindeutig genug, um Zufallsergebnisse auszuschließen. Man kann die Bedeutung solcher Abhängigkeiten nicht genug betonen. Zum einen weil deutlich wird, wie groß die Unterschiede zwischen den Gesellschaften mit geringer oder höherer Ungleichheit ausfallen - in den ungleicheren Gesellschaften treten die Probleme drei bis zehn Mal so häufig auf -, zum anderen geht es hier nicht um Unterschiede zwischen mehr oder weniger stark betroffenen Risikogruppen, die vielleicht zusammen nur einen geringen Teil der Bevölkerung ausmachen, oder ausschließlich um die Armen: Es geht um die Unterschiede zahlreicher und häufiger Probleme, die jeweils eine ganze Bevölkerung betreffen“ (S. 199). Die Untersuchung zeige auch, dass die postulierten Zusammenhänge mit der Einkommensungleichheit nicht nur für einzelne, sondern für alle erwähnten Gesundheits- und Sozialprobleme gelten.
Pickett und Wilkinson interpretieren die statistisch so eindeutig auszumachenden Zusammenhänge keineswegs unkritisch. Sie fragten sehr wohl auch danach, ob für die Unterschiede nicht auch andere Faktoren eine Rolle spielen könnten. Die kulturelle Gemeinsamkeit von Norwegen und Schweden in der Gruppe der gleicheren und von Großbritannien und den USA in der Gruppe der ungleicheren Länder spricht scheinbar dafür. Dagegen wäre aber auf Japan in der erstgenannten und Portugal in der letztgenannten Gruppe als Länder mit unterschiedlicher Kultur zu verweisen. Gerade die methodische Sorgfalt der beiden Autoren, die sich auch präventiv mit möglichen Einwänden auseinandersetzen, spricht mit für die Tragfähigkeit und Überzeugungskraft von Analyse und Position. Sie laufen auf die Einforderung einer grundlegenden Neuorientierung der Sozial- und Wirtschaftspolitik hinaus. Dass mit einem Mehr an sozialer Gleichheit nicht ein Weniger an politischer Freiheit verbunden sein muss, veranschaulichen die skandinavischen Länder.
Armin Pfahl-Traughber
Richard Wilkinson/Kate Pickett, Gleichheit ist Glück. Warum gerechte Gesellschaften für Alle besser sind, Berlin 2009 (Tolkemitt Verlag bei Zweitausendeins), 335 S., 19,90 €