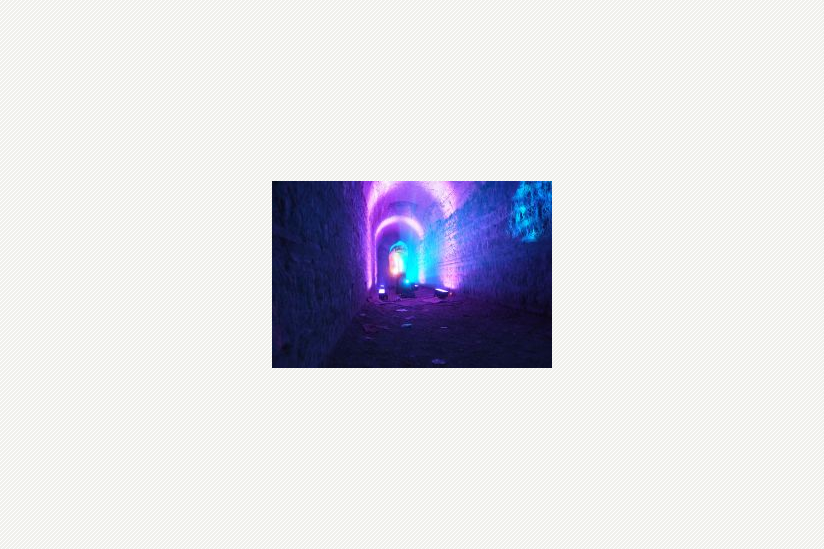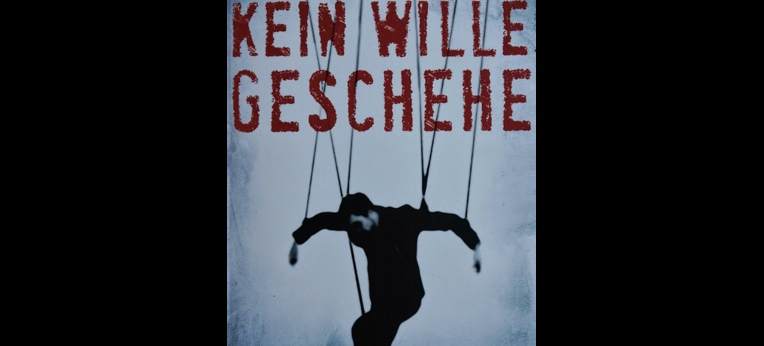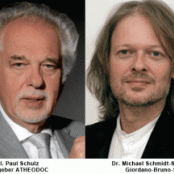(hpd) Im abschließenden dritten Teil seiner Replik auf Andreas Müller erklärt Michael Schmidt-Salomon, warum eliminatorische Reduktionisten eine „Zombie-Psychologie“ vertreten und warum der Glaube an Irreales durchaus mit realen Konsequenzen verbunden ist. Außerdem zieht er eine Bilanz der Debatte und bedankt sich bei seinem Kritiker.
Im zweiten Teil dieser Replik habe ich das Konzept einer „starken, naturalistischen Emergenz“ erläutert. Da ich in den nachfolgenden Überlegungen auf dieses Konzept zurückgreifen werde, halte ich es für angebracht, hier noch einmal einige zentrale Arbeitsergebnisse zusammenzufassen.
Erstens: Leben ist, was niemanden verwundern sollte, durch physikalische und chemische Prozesse bestimmt. Das Prinzip der „aufwärtsgerichteten Verursachung“ (Mikrodetermination) besagt, dass basale Prozesse die notwendige kausale Voraussetzung für emergente Prozesse bilden. Daher gilt: Was physikalisch unmöglich ist, ist auch biologisch unmöglich! Dennoch besitzt Leben eine Eigengesetzlichkeit, die sich nicht vollständig auf chemische oder physikalische Prozesse zurückführen lässt.
Zweitens: Emergente Systeme wie Organismen (oder auf noch höherer Emergenzstufe: Kulturen) haben einen selektiven Einfluss auf die Häufigkeit, in der basale physikalische und chemische Prozesse auftreten. Es gibt also neben der „aufwärtsgerichteten Verursachung“ (Mikrodetermination) auch eine „abwärtsgerichtete Verursachung“ (Makrodetermination), d.h. eine Rückwirkung des emergenten Ganzen auf die Teile der tieferen Integrationsebene. Diese Rückwirkung ist nicht kausal-deterministisch (im Sinne der Physik), sondern evolutionär-selektiv (im Sinne Darwins) zu interpretieren. Wenn beispielsweise Spezies A Spezies B aufgrund positiv wirkender Selektionskräfte verdrängt, so verändert dies nichts an den biochemischen Mechanismen der Vererbung, jedoch treten bestimmte Anordnungen von Biomolekülen häufiger auf als zuvor.
Drittens: Die Rückwirkungen emergenter Systeme auf niedere Integrationsebenen „bedienen“ sich der Gesetzmäßigkeiten dieser niederen Ebenen, weshalb sie aus der Perspektive der niederen Integrationsebenen in gewisser Weise „unsichtbar“ sind. Im obigen Beispiel: Wenn Spezies A Spezies B verdrängt, heißt dies, dass die spezifische Anordnung von Atomen, Molekülen etc., die für Spezies B charakteristisch war, nun nicht mehr auftritt. Auf physikalischer Ebene ist dabei nichts Ungewöhnliches passiert (es gab keine Verstöße gegen die Gesetze der Gravitation oder der starken, schwachen oder elektromagnetischen Wechselwirkung) – und doch ist in der Welt etwas Bedeutsames geschehen (zumindest für die Mitglieder der Spezies A und B), was sich letztlich auch im physikalischen Kosmos niederschlug, ohne dass dies aus einer rein physikalischen Perspektive als Besonderheit verbucht werden konnte!
Viertens: Da die Rückwirkungen emergenter Systeme aus der Perspektive der niederen Integrationsebene unsichtbar sind, kann der Ansatz eines eliminatorischen Reduktionismus, der reale Wirkungen emergenter Systeme bestreitet, als plausibel, ja sogar als „wissenschaftlich besonders elegant“ erscheinen. Allerdings fordert diese denkmögliche Position einen hohen Preis: Denn dieser Ansatz läuft daraus hinaus, dass alle Erscheinungen in der Welt (inklusive der menschlichen Kultur) nichts weiter sind als Epiphänomene physikalischer Prozesse. Unter dieser Voraussetzung würde es uns nur so erscheinen, als ob unsere Überzeugungen, Überlegungen, Gefühle etc. von Bedeutung sind, tatsächlich aber wären sie bloß vernachlässigbare Folgeerscheinungen der vier physikalischen Grundkräfte (Gravitation, starke, schwache und elektromagnetische Wechselwirkung). Jede Berufung auf die Wirksamkeit von Gründen, von Aufklärung und Selbstreflexion, jede Diskussion über die Güte von Argumenten, wäre damit hinfällig! Denn unter dieser Voraussetzung würden wir irrationale und/oder inhumane Standpunkte (etwa den Fundamentalismus bin Ladens) nicht deshalb kritisieren, weil wir uns dank rationaler Argumente von der Richtigkeit dieser Position überzeugt haben, sondern weil gänzlich unintelligente, physikalische Prozesse unsere Gehirne so determinieren, dass wir exakt so und nicht anders denken können (was im umgekehrten Falle für Osama bin Ladin selbstverständlich in gleichem Maße gelten würde).
Fünftens: Weil eliminatorische Reduktionisten die emergenten Eigenschaften von Leben ignorieren, meinen sie, dass es überhaupt keinen Unterschied mache, ob ein potentieller Roboter der Zukunft tatsächlich lebt, empfindet und seinen eigenen Erfahrungen Bedeutung zumisst, oder ob er derartige Eigenschaften bloß perfekt simuliert, ohne dass dies für ihn irgendeine Bedeutung hätte. Gegen diese reduktionistische Sichtweise hatte ich eingewendet, dass die Differenz von Leben- und Nichtleben für uns selbst dann noch die bedeutsamste Unterscheidung schlechthin bliebe, wenn wir in der Zukunft, getäuscht von raffinierten High-Tech-Maschinen, nicht mehr in der Lage sein sollten, diese Unterscheidung vorzunehmen.
An dieser Stelle möchte ich den argumentativen Faden wieder aufnehmen. Fragen wir uns zunächst: Was ist der Grund dafür, dass wir die Unterscheidung zwischen Leben und Nicht-Leben möglicherweise irgendwann einmal nicht mehr begründet vornehmen können? Und weshalb sollte eine solche Unterscheidung überhaupt noch bedeutsam sein, wenn wir sie unter bestimmten Umständen gar nicht mehr vornehmen können?
Ein Gedankenexperiment
Stellen wir uns vor, eine ethisch fragwürdige, aber uns technisch kolossal überlegene, außerirdische Intelligenz hätte uns darauf programmiert, in bestimmten Zeitintervallen zwischen zwei inneren Modi hin und her zu wechseln: Im ersten Modus, nennen wir ihn den „Real-Modus“, würden wir so weiterleben wie bisher. Wir würden lieben, lachen, hoffen, Schmerzen empfinden und all unsere Handlungen und Erfahrungen hätten für uns Bedeutung. Im zweiten Modus, dem „Zombie-Modus“, würden wir nach außen zwar weiterhin tun, was wir zuvor getan haben, doch wir würden all dies nicht mehr subjektiv erleben. Wir würden zwar schreien, wimmern, fluchen, wenn wir uns an einem spitzen Gegenstand stoßen, aber wir würden dabei keinerlei Schmerz oder Wut empfinden, da die entsprechenden Hirnregionen ausgeschaltet wären. Stattdessen würde ein raffinierter, außerirdischer Steuerungsmechanismus all die körperlichen Verhaltensmerkmale simulieren, die von der Außenwelt als Ausdruck „echter emotionaler Reaktionen“ interpretiert würden, in Wahrheit aber besäßen „wir“ nur das „reiche Innenleben“ eines Kühlschranks, Toasters oder Kaffeeautomaten.
In diesem hypothetischen Zombie-Modus wären wir in der Tat „lebende (oder besser gesagt: lebendig wirkende) Tote“, doch niemand könnte dies von außen erkennen und kein Außenstehender wäre in der Lage, zu unterscheiden, in welchem der beiden Modi wir uns gerade befinden. Allerdings wäre uns selbst der fundamentale Unterschied sofort klar, sobald wir vom „Zombie-Modus“ in den „Real-Modus“ wechseln würden. Denn nun würden wir ja wieder über unseren alten Empfindungsreichtum verfügen. Würde man uns in diesem Zustand Videoaufnahmen vorspielen, in denen zu sehen ist, wie wir im Zombie-Modus eine Bank ausgeraubt haben, so würden wir die Verantwortung für diese Tat strikt abstreiten – und zwar aus gutem Grund: Denn nicht wir hätten die Bank ausgeraubt, sondern eine gefühllose Maschine, die nur dank einer geschickten Simulation von äußeren Signalen den Anschein erweckte, es handele sich um eine echte Person. Leider aber würde uns kein Richter der Welt diese wichtige Differenzierung abkaufen, da von außen nun einmal keine Unterschiede zwischen den Modi feststellbar wären.
Das Zombie-Gedankenexperiment zeigt, dass der Unterschied zwischen Leben und Nichtleben, zwischen echten und bloß simulierten Empfindungen, für die Innenwahrnehmung eines Systems sehr wohl einen gewaltigen Unterschied macht – und zwar selbst dann noch, wenn dieser Unterschied von außen möglicherweise gar nicht mehr wahrgenommen werden kann. Wenn wir also über die Differenz von Leben und Nicht-Leben nachdenken, so müssen wir die Unterschiede zwischen der Ersten-Person- und der Dritten-Person-Perspektive berücksichtigen.
Warum wir uns so leicht täuschen lassen
Als lebende Organismen ist uns allen die Erste-Person-Perspektive vertraut. Wir wissen um unsere inneren Zustände, kennen Lust, Schmerz, Trauer, Freude sowie all die anderen „Qualia“ (erlebbare phänomenale Bewusstseinsinhalte) wie die Röte einer Tomate oder die Süße einer reifen Honigmelone. Aus diesem eigenen inneren Erleben schließen wir in der Dritten-Person-Perspektive darauf, dass andere Lebewesen, die uns ähnlich erscheinen, derartige innere Zustände auch kennen. Ganz sicher können wir uns in dieser Hinsicht zwar nicht sein, doch die Übertragung der Ersten-Person-Perspektive auf die Dritte-Person-Perspektive (die Grundlage aller Empathie!) ist zweifellos eine sinnvolle Prozedur. (Nur Psychopathen gehen davon aus, die einzigen empfindungsfähigen Wesen im Universum zu sein, umgeben von imaginären Erscheinungen oder philosophischen Zombies! Haben Sie also keine Sorge: Philosophische Zombies gibt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ebenso wenig wie einen personalen Gott!)
Da wir in andere Personen nicht hineinschlüpfen und somit ihre inneren Zustände nicht wirklich kennen können, sind wir darauf angewiesen, von äußeren Signalen (wie Wortwahl, Tonfall, Mimik, Gestik), die sie aussenden, auf ihre jeweiligen inneren Zustände zu schließen. Bei dieser Schlussfolgerung treten natürlich Fehler auf: So leiten wir manchmal aus äußeren Signalen innere Zustände ab, die in Wahrheit völlig anders aussehen (beispielsweise schließen wir aus dem Lächeln eines Gegenübers, dass er uns freundlich gesonnen ist, obwohl er uns mit diesem falschen Signal nur arglistig übers Ohr hauen will). Unter bestimmten Umständen begehen wir beim Transfer von der Außenperspektive auf die Innenperspektive sogar einen noch viel gravierenderen Fehler, nämlich indem wir unserem „Gegenüber“ innere Zustände zuschreiben, obgleich dieser (wie bereits am fiktiven Beispiel eines philosophischen Zombies erläutert) überhaupt keine subjektiven, inneren Zustände kennt.
Dass ein solcher Kategorienfehler nicht bloß Science-Fiction ist, sondern sehr wohl in der Realität vorkommen kann, wissen wir spätestens seit den 1960er Jahren, als der Computerpionier und Gesellschaftskritiker Joseph Weizenbaum sein berühmtes ELIZA-Programm schrieb. Nach heutigen Maßstäben war ELIZA ein atemberaubend simples Computerprogramm, aber es war in der Lage, zu „rogern“, das heißt, es konnte (wenn auch nur auf sehr oberflächliche Weise!) im Sinne der klientenzentrierten Psychotherapie (nach Carl Rogers) mit Menschen „kommunizieren“. Schrieb beispielsweise jemand: „Ich habe Probleme in meinem Job!“, so antwortete ELIZA: „Warum haben Sie Probleme in ihrem Job?“ Obwohl ELIZA natürlich nicht „verstand“, worum es dem Gesprächspartner ging (das Programm simulierte bloß „Verständnis“, indem es die Aussagen der Gesprächspartner mehr oder weniger geschickt in Fragen umwandelte), hatten viele Personen, die mit ELIZA kommunizierten, den Eindruck, sich mit einem realen Menschen (einem Psychotherapeuten!) zu unterhalten. Sie schrieben also einem überaus simplen Computerprogramm komplexe innere Zustände zu (incl. der Fähigkeit zur Empathie) und fühlten sich von diesem sogar in einem umfassenden Sinne akzeptiert, weshalb sie ihm teils höchst intime Details anvertrauten (was Weizenbaum einigermaßen schockierte).
Natürlich hätte ELIZA keinen echten Turing-Test (Verfahren zur Messung „Künstlicher Intelligenz“) bestanden. Dafür war das Programm letztlich zu einfach gestrickt. Doch bedenkt man, dass schon ein so altes, simples Programm wie ELIZA Menschen so sehr täuschen kann, können wir erwarten, dass es möglicherweise schon recht bald Programme oder gar Roboter geben wird, die wir in der Außenwahrnehmung von lebenden Systemen kaum mehr unterscheiden können, obwohl sie (höchstwahrscheinlich!) ebenso wenig über ein phänomenales Bewusstsein (innere subjektive Erfahrungen) verfügen wie ELIZA oder eine herkömmliche Tiefkühltruhe!
Fragen wir uns nun, warum eliminatorische Reduktionisten wie Andreas Müller oder (teilweise) auch Daniel Dennett den im Grunde offensichtlichen Unterschied zwischen echten und bloß simulierten Empfindungen leugnen. Warum meinen sie, dass die für uns subjektiv so bedeutsamen Unterschiede in der Innenwahrnehmung (Erste-Person-Perspektive) letztlich irrelevant sind? Der Grund hierfür ist, dass sie sich in der Analyse auf das äußerlich Beobachtbare (Dritte-Person-Perspektive) konzentrieren und in ihren theoretischen Entwürfen (im praktischen Leben dürfte das anders aussehen!) an subjektiven inneren Zuständen (also der Ersten-Person-Perspektive) nur wenig interessiert sind.
Diese weitgehende Ignoranz gegenüber innerpsychischen Erlebnissen und Verarbeitungsprozessen ist innerhalb des reduktionistischen Weltbildes durchaus verständlich: Denn wenn all unsere Gedanken, Gefühle, Empfindungen, wenn alle Qualitäten unserer subjektiven Wahrnehmung tatsächlich nur Epiphänomene physikalischer Prozesse sein sollten, so müsste man derartigen „inneren Zuständen“ in der Tat keine allzu große Bedeutung beimessen! Dies erklärt auch, warum sich eliminatorische Reduktionisten so hartnäckig weigern, zwischen lebenden und Leben bloß simulierenden Systemen zu unterscheiden. Denn die Differenz zwischen einem philosophischen Zombie und einem Menschen ist für einen konsequenten Reduktionisten gar nicht vorhanden, da in seinem Weltbild im Grunde jeder Mensch eine Art philosophischer Zombie ist. Zwar mögen wir höchst phantasievolle Zombies sein, die sich irgendwelche merkwürdigen „innere Zustände“ einbilden, aber derartige Zustände sind in der reduktionistischen Sichtweise letztlich zu vernachlässigen, da sie als subjektive Einbildungen keinerlei Einfluss auf die Welt haben können. (Wirkungen haben in der reduktionistischen Perspektive, wie gesagt, nur physikalische Prozesse, eine makrodeterministische Rückwirkung von Biologie und Kultur auf die Physik wird ausgeschlossen.)
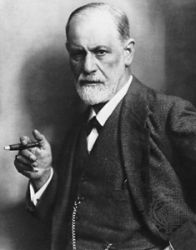 Der reduktionistische Verriss der Psychoanalyse
Der reduktionistische Verriss der Psychoanalyse
Da Reduktionisten aufgrund ihrer metatheoretischen Annahmen eine Art „Zombie-Psychologie“ vertreten, die sich (wenn überhaupt) nur für das äußerlich Beobachtbare interessiert, haben sie starke Aversionen gegenüber qualitativen Formen der Psychologie, die sich mit inneren Zuständen, phänomenalen Erlebnissen, Traumata, psycho-dynamischen Komplexen, kognitiven und emotionalen Verarbeitungsmustern etc. beschäftigen. In AMs Artikel-Serie wird diese Abneigung an vielen Stellen deutlich, insbesondere in seiner scharfen Kritik der Psychoanalyse, die er (hier durch die Blume, in manchen Texten jedoch auch expressis verbis) als reine „Pseudowissenschaft“ abqualifiziert.
Nun möchte ich keineswegs verhehlen, dass die Psychoanalyse (gerade in ihrer Anfangszeit) viele pseudowissenschaftliche Elemente enthielt. So ist mittlerweile erwiesen, dass einige von Freuds Musterfällen gefälscht waren. Außerdem sind seine Annahmen zur Sexualfunktionsentwicklung (oral, anal, ödipal, genital) und die daraus abgeleitete Charakterologie (oraler Charakter, analer Charakter etc.) weitestgehend widerlegt. Das Gleiche gilt für seine Überlegungen zur Traumdeutung oder sein Triebkonzept. Auch ist zu bemängeln, dass Freuds Konzepte von Übertragung und Verdrängungswiderstand dazu führten, dass sich Psychoanalytiker in bedenklicher Weise gegen Kritik immunisierten. All dies (und noch einiges mehr) soll hier keineswegs in Abrede gestellt werden! Doch ist das schon hinreichend, um die Psychoanalyse als reine Pseudowissenschaft zu klassifizieren? Dürfen wir sie so einfach mit Astrologie und Homöopathie auf eine Stufe stellen?
Ich meine, dass ein solcher Pauschalverriss keinesfalls gerechtfertigt ist! Denn in Freuds Werken (etwa in „Das Unbehagen in der Kultur“ oder „Die Zukunft einer Illusion“) finden sich viele philosophische und psychologische Überlegungen, die noch heute bemerkenswert sind! Auch seine wegweisenden Anmerkungen zur Arbeitsweise des psychischen Apparats sind nicht völlig von der Hand zu weisen. In der Tat gibt es unbewusste Prägungen, Übertragungen, Gegenübertragungen, Abspaltungen, Fetischbildungen, Verdrängungswiderstände usw., weshalb es nicht verwunderlich ist, dass empirische Untersuchungen über die Jahrzehnte hinweg immer wieder Belege für Freudsche Hypothesen lieferten.
Nur ein Beispiel unter vielen: Eine 1996 an der University of Georgia durchgeführte Untersuchung (siehe u.a. bild der wissenschaft, 11/09, S.69) stützte Freuds Vermutung, dass Hass auf Schwule nicht zuletzt durch eine Verdrängung eigener homosexueller Impulse hervorgerufen werden könne: Denn von den offen homophoben Probanten der Studie zeigten 54 Prozent eine sexuelle Erregung bei der Betrachtung eines Hardcore-Schwulenpornos, bei den nicht-homophoben Untersuchungsteilnehmern waren es gerade einmal 24 Prozent. Ein statistisch signifikantes Ergebnis, das nicht nur den von Freud entdeckten Mechanismus der latenten Projektion eigener Selbstzweifel auf Sündenböcke bestätigt, sondern ganz nebenbei auch den tragisch-komischen Fall des evangelikalen Schwulenhassers Ted Haggard erklärt, der dereinst beim Ausleben seiner „sündigen, fleischlichen Lust“ mit einem Strichjungen erwischt wurde.
So falsch es ist, Sigmund Freud als bloßen Scharlatan abzutun, noch unsinniger wäre es, die gesamte Psychoanalyse als Pseudowissenschaft abzuqualifizieren. Schließlich haben sich innerhalb der psychoanalytischen Tradition sehr unterschiedliche Schulen herausgebildet, die teilweise höchst konträre Positionen einnahmen. Wie etwa könnte man so grundverschiedene Autoren wie Erich Fromm, C.G. Jung, Alfred Adler oder Wilhelm Reich über einen Kamm scheren? Und wie könnte man übersehen, welchen entscheidenden Anteil gerade psychoanalytisch inspirierte Autoren bei der Überwindung der repressiven Sexualmoral oder der Aufhebung der einst gesellschaftlich weithin akzeptierten, autoritären Kindeserziehung hatten?! Wenn man den Unsinn abzieht, der im Rahmen der psychoanalytischen Theoriebildung zweifellos verzapft wurde, so bleibt, wie ich meine, genügend Substanz übrig, um Sigmund Freud sowie einigen Nachfolgern (etwa dem Neofreudianer Erich Fromm) vorderste Ränge in der menschlichen Kulturgeschichte zuzuweisen!
AMs Bild der Psychoanalyse entspricht in etwa dem witzigen Klischee eines Woody-Allen-Films, hat aber mit der realen Praxis der meisten heutigen Psychoanalytiker sehr wenig zu tun. Ginge es nach Andreas Müllers Vorstellungen, bräuchte es im Grunde nur Psychiater zu geben, die ihre Patienten mithilfe von Medikamenten kurieren, sowie höchstens noch ein paar Verhaltenstherapeuten, die mit den Mitteln der Konditionierung erwünschtes Verhalten fördern und unerwünschtes löschen. (Viel mehr ist von einer Zombie-Psychologie, die die Erste-Person-Perspektive vernachlässigt, nicht zu erwarten!) So sehr ich zustimme, dass Medikamentenvergabe bei bestimmten Störungsbildern sinnvoll und Verhaltenstherapie häufig enorm effizient ist (etwa bei der Behandlung konkreter Phobien, siehe hierzu auch JvGuB, Seite 126): Dies bedeutet noch lange nicht, dass wir mit einem derartig verkürzten psychologischen Instrumentarium gut ausgerüstet wären, um komplexe Traumata oder problematische Familienkonstellationen therapeutisch zu bearbeiten! Hier gilt es eben doch, Verdrängtes bewusst zu machen, Abspaltungen zu verdeutlichen, schädliche Projektionen aufzuheben usw.
Die komplexen Prozesse, die in der Innenwahrnehmung des Patienten ablaufen, sind, wie wir wissen, für den therapeutischen Erfolg von allergrößter Bedeutung! Dies haben selbstverständlich nicht nur Psychoanalytiker erkannt! Auch innerhalb der verhaltenstherapeutischen Schule setzte sich nach und nach die Ansicht durch, dass das klassische Modell des Behaviorismus überholungsbedürftig ist. Es reichte eben nicht aus, den Menschen nur von außen zu betrachten und das Innenleben, das in dieser vermeintlichen „Black-Box“ stattfand, zu ignorieren! Und so kam es bereits in den 1960er Jahren zur sog. „Kognitive Wende“ in der wissenschaftlichen Psychologie, was zur Folge hatte, dass die einst tiefen Gräben zwischen tiefenpsychologisch-qualitativen und behavioristisch-quantitativen Verfahren zunehmend geschlossen wurden. Diese theoretische Annäherung hat glücklicherweise auch in die therapeutische Praxis Eingang gefunden: Gute Therapeuten (gleich welcher sie „Schule“ sie nominell angehören) greifen heute pragmatisch auf einen „Methoden-Mix“ zurück, weshalb es Nur-Psychoanalytiker mittlerweile ebenso selten gibt wie Nur-Behavioristen.
Ich habe den Eindruck, dass die bemerkenswerten Fortschritte in Psychologie und Psychotherapie in den Konzepten eliminatorischer Reduktionisten nicht genügend Beachtung finden. Hier herrschen noch immer weitgehend Black-Box-Konzepte vor. Daran ändert sich auch nichts durch die zusätzliche Berücksichtigung neurowissenschaftlicher Befunde, denn diese beruhen letztlich auch bloß auf der Dritten-Person-Perspektive! Die Innenperspektive, d.h. die innerpsychische Bedeutung der von Außen beobachtbaren Prozesse (Verhaltensweisen, neuronale Aktivitäten), bleibt weiterhin fast vollständig ausgeblendet! Diese Verdrängung der Ersten-Person-Perspektive ist so eklatant, dass man bei der Lektüre eliminatorisch-reduktionistischer Texte über die menschliche Psyche mitunter den Eindruck gewinnt, Mr. Data, der genial-naive Androide vom „Raumschiff Enterprise“, persönlich habe sie verfasst – und zwar bevor er sich jenen berühmten „Emotions-Chip“ einsetzte, der ihn erstmalig das ganze Facettenreichtum menschlicher Emotionen erfahren ließ!
Die fehlende Sensibilität gegenüber den feinen Nuancen und mitunter auch dramatischen Aufwallungen, die mit inneren Zuständen verbunden sind, zeigt sich in AMs Text nicht nur in seiner rigorosen Abkanzelung der Psychoanalyse, sondern auch an jenen Stellen, in denen er über die Bedeutung von Schuld und Sühne, Rache und Vergebung, d.h. über die möglichen oder unmöglichen Folgen der Willensfreiheitsunterstellung schreibt. Damit kommen wir endlich zu AMs zentraler Kritik an meinem Buch „Jenseits von Gut und Böse“: Seiner Meinung nach hätte ein Abschied von der Vorstellung der Willensfreiheit nämlich keinerlei positive Konsequenzen für unser Leben. Dies widerspricht in der Tat den von mir im Buch vorgetragenen Thesen. Wie lauten also die Argumente, die Andreas Müller zur Stützung seiner Hypothese vorbringt?
Die Legitimation „primitiver Instinkte“
Im ersten Moment könnte man meinen, dass das Willensfreiheitsproblem mit drei einfachen Sätzen aus der Welt geschafft werden könnte: Erstens: Etwas, das real nicht existiert, kann keine realen Folgen im Universum haben. Zweitens: Ein ursachenfreier Wille kann in einer von Ursachen bestimmten Welt nicht existieren. Drittens (Schlussfolgerung): Ein ursachenfreier Wille hat keine Wirkungen in der Welt.
Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass mit dieser Feststellung keineswegs das Wesentliche zur Willensfreiheitsfrage gesagt ist: Denn der real existierende Glaube an real nicht Existierendes ist, wie wir wissen, sehr wohl mit realen Konsequenzen verbunden! (Man denke etwa an die Wirkungen des Hexenglaubens oder des medizinischen Placebo-Effekts!) Andreas Müller stimmt diesem (in der Sozialpsychologie als „Thomas-Theorem“ bekannten) Zusammenhang erfreulicherweise zu. Allerdings tut er dies nur in Bezug auf den Glauben an Gott und Teufel, Himmel und Hölle, Gut und Böse. In Hinblick auf den Glauben an die Willensfreiheit meint er, dass dieser seltsamerweise ohne jegliche Folgen für unser Leben bleibe (zumindest, sofern man Willensfreiheit nicht mit Fatalismus verwechsle).
Wie begründet AM seine These von der lebenspraktischen Folgenlosigkeit der Willensfreiheitsunterstellung? Ich muss gestehen, dass ich Schwierigkeiten hatte, in seinem Text eine derartige Begründung überhaupt zu finden! Immerhin: Im ersten Teil seiner Serie wendet er sich dezidiert dem angeblich fehlenden Zusammenhang von Willensfreiheitsunterstellung und Rachegefühlen zu. Ich zitiere die entsprechende Passage vollständig, damit wir die eigentümliche Struktur von AMs „Argumentation“ nachvollziehen können:
>> Eine Bestrafung von Tätern aus bloßer Rache kann sowieso nicht legitimiert werden – gleichgültig, wie man zur Willensfreiheit steht. Rache hat gar nichts zu tun mit der Frage nach der Willensfreiheit. Hier wurden zwei voneinander unabhängige Fragen zu einer Einheit vermengt. Das Gleiche gilt für die angeblichen Konsequenzen der Willensunfreiheit für die Bestrafung von Kriminellen. Wolf Singer sagt dazu: „Und wenn sie zu gefährlich sind, werden wir sie weiterhin ihrer Freiheit berauben, um uns vor ihnen zu schützen. Aber ich denke, wir werden etwas nachsichtiger werden und in vielen Verbrechern das Opfer einer ungünstigen Konstellation von Genen, Entwicklungsfehlern, frühen Prägungen und so weiter sehen.“ Inwiefern sollte aus der Willensfreiheit folgen, dass wir Kriminelle hart bestrafen müssen? Nehmen wir an, dass Menschen das wollen können, was sie wollen. Warum sollten wir sie nun härter bestrafen, als wenn dem nicht so wäre? Diese Logik ist doch von Anfang an schon fehlerhaft.
Der wirkliche Grund, warum Menschen die Bestrafung eines Täters aus Rache befürworten, oder eine unverhältnismäßig harte Bestrafung fordern, ist nicht ihr Glaube an den freien Willen des Täters, ihre Meinung, er hätte auch anders handeln können. Ihr tatsächlicher Grund lautet einfach, dass sie sich gut dabei fühlen, wenn ein Täter hart bestraft wird. Das tun sie, weil sich Vergeltung zur Regulierung des Sozialverhaltens von Tieren evolutionär durchgesetzt hat und sie damit zu unserer Programmierung gehört. Vergeltung diente der Abwehr unerwünschten Verhaltens und ein vages Verlangen danach gehört zu unseren ererbten Verhaltenstendenzen. Der freie Wille ist den Leuten im Grunde egal, er dient nur zur Legitimierung eines primitiven Instinktes, was eine neue Studie erwartungsgemäß bestätigt. Gewiss: Unser Rache-Instinkt ist viel zu grobschlächtig und muss durch die Vernunft gezähmt werden. Aber, wie schon gesagt, hat dieser Umstand rein gar nichts mit der Willensfreiheit zu tun. <<
Auffällig an dieser Passage ist, dass Andreas Müller mantraartig sein eigenes Credo wiederholt („Rache hat gar nichts zu tun mit der Frage nach der Willensfreiheit“ / „Diese Logik ist doch von Anfang an schon fehlerhaft“ / Aber, wie schon gesagt, hat dieser Umstand rein gar nichts mit der Willensfreiheit zu tun“), aber außergewöhnlich wenig Platz darauf verwendet, die Gründe aufzuzeigen, die sein Credo belegen könnten. Wir erfahren bloß, dass sich Menschen (AM zufolge) einfach „gut dabei fühlen, wenn ein Täter hart bestraft wird“, was der Autor darauf zurückführt, dass sich „Vergeltung zur Regulierung des Sozialverhaltens von Tieren evolutionär durchgesetzt hat und sie damit zu unserer Programmierung gehört.“ Nun sollte an dem evolutionären Ursprung unserer Rache- und Vergeltungswünsche niemand zweifeln (siehe hierzu auch meine Schilderung des „Kriegs der Schimpansen“ in JvGuB, S. 44ff.) – doch warum sollte dies ein Argument dafür sein, dass die Willensfreiheitsunterstellung in diesem Zusammenhang bedeutungslos ist?
Erst jetzt holt AM zu seinem vermeintlich „finalen Schlag“ aus – und der nachfolgende Satz enthält in der Tat das einzige Argument, das der Autor im gesamten Kapitel zur Stützung seiner These vorbringt: „Der freie Wille ist den Leuten im Grunde egal, er dient nur zur Legitimierung eines primitiven Instinktes, was eine neue Studie erwartungsgemäß bestätigt.“
Fragen wir uns: Ist AMs Behauptung, dass die Willensfreiheitsunterstellung „nur zur Legitimation eines primitiven Instinktes“ diene, ein guter Beleg für die These, dass diese Unterstellung folgenlos sei? Nun, davon könnte man logischerweise nur dann ausgehen, wenn die Legitimation „primitiver Instinkte“ keine Folgen hätte! Doch das ist ganz gewiss nicht der Fall! Nehmen wir als Beispiel die blutigen Rache-Vergeltungsaktionen unter den Yanomami-Indianern (siehe u.a. Schmidt-Salomon, Voland: Die Entzauberung des Bösen. In: Franz Josef Wetz (Hg.): Kolleg Praktische Philosophie, Bd. 1, S.111ff.): Selbstverständlich ist die kulturelle Rechtfertigung der Blutrache bei den Yanomami ein wesentlicher Grund dafür, dass derartige Verhaltensweisen bei ihnen signifikant häufiger auftreten als in Kulturen, die (wie unsere) Blutrache eben nicht legitimieren! (Bei den Yanomami werden diejenigen, die Blutrache begehen, mit sozialen Statusvorteilen belohnt, bei uns hingegen mit hohen Gefängnisstrafen bedroht!)
Man erkennt hieran (hoffentlich!) den von mir beschriebenen Mechanismus der Makrodetermination: Kulturelle Systeme (etwa die Stammesideologien der Yanomami) haben natürlich keinen direkten Einfluss auf die Funktionsweise biologischer Systeme (etwa darauf, dass Wutreaktionen durch Adrenalinausschüttungen ausgelöst werden), aber sie haben sehr wohl einen Einfluss darauf, wie häufig solche biologischen Prozesse auftreten!
Für die Wirksamkeit theoretischer Rechtfertigungen „primitiver Instinkte“ gibt es viele weitere Beispiele: Wäre die kulturelle Legitimation von Fremdenhass nicht damit verbunden, dass die uns biologisch mitgegebene Bereitschaft zur Xenophobie sich häufiger in fremdenfeindlichen Handlungen manifestieren würde, so müssten wir uns gegen „rechte Schreibtischtäter“ nicht zur Wehr setzen! Wir müssten unter dieser Voraussetzung auch nicht die kulturelle Legitimation von Sklaverei, Unterdrückung, Mord usw. problematisieren. Schließlich greifen all diese menschlichen Verhaltensweisen auf biologisch evolvierte Verhaltensprogramme zurück! Wäre die kulturelle Legitimation dieser Verhaltensprogramme tatsächlich so bedeutungslos, wie AM meint, könnten wir uns unsere Kritik an derartigen kulturellen Rechtfertigungen komplett sparen!
Je genauer wir hinschauen, desto deutlicher wird, dass sich die gesamte ethische Debatte letztlich um nichts anderes dreht als um die Frage der Legitimation „primitiver Instinkte“! Doch Vorsicht: Beim Worte „primitive Instinkte“ denken wir in der Regel an Fremdenhass, Wut- und Rachegefühle, in Wahrheit aber sind Liebe, Empathie und die Fähigkeit zu einem altruistischen Miteinander nicht minder stark biologisch in uns verankert! Es gibt also keinen vernünftigen Grund dafür, die vermeintlich „schlechte Natur“ gegen die vermeintlich „gute Kultur“ auszuspielen. Kultur und Natur sind vielmehr unaufhebbar miteinander verwoben (nämlich dank Mikro- und Makrodetermination) und deshalb müssen ethische Ratschläge notwendigerweise an biologische Programmen andocken (also in gewisser Weise „Legitimationen primitiver Instinkte“ sein!), wenn sie denn irgendeinen realen Einfluss auf menschliche Handlungen haben sollen!
Halten wir fest: Um die Folgenlosigkeit der Willensfreiheitsunterstellung belegen zu können, hätte Andreas Müller keinesfalls schreiben dürfen, dass diese Unterstellung nur der Legitimation primitiver Instinkte diene (genau dies ist ja die Form, in der kulturelle Argumente reale Wirkung in der Welt entfalten!), er hätte vielmehr umgekehrt formulieren müssen, dass der Glaube an den freien Willen eben nicht zur Legitimation primitiver Instinkte tauge!
Freier Wille, Rache und Vergebung
Unterstellen wir einmal, dass AM eigentlich meinte, dass der Glaube an den freien Willen nicht zur Legitimation „primitiver Instinkte“ tauge (obwohl er im Text das Gegenteil schrieb). Auf diese Weise könnte man eventuell auch seinen oben zitierten, kryptischen Kommentar zu Wolf Singer erklären: „Nehmen wir an, dass Menschen das wollen können, was sie wollen. Warum sollten wir sie nun härter bestrafen, als wenn dem nicht so wäre? Diese Logik ist doch von Anfang an schon fehlerhaft.“ AM gibt an dieser Stelle nicht an, was an Singers Logik fehlerhaft sein soll. Berücksichtigt man allerdings, was AM im zweiten und vor allem im dritten Teil der Artikel-Serie über „Konsequentialismus“ schreibt, so könnte man folgende Argumentation rekonstruieren: (Straf-) Sanktionen sollten nicht das Rachebedürfnis befriedigen, sondern der Prävention unerwünschten Verhaltens dienen. Deshalb sollte es für unsere Beurteilung und Sanktionierung unerwünschten Verhaltens irrelevant sein, welche konkreten Faktoren (etwa ein Hirntumor, schreckliche Kindheitserfahrungen oder ein fälschlicherweise unterstellter „freier Wille“) als ursächlich für die Entstehung dieses Verhaltens angenommen werden.
Zunächst muss man hier feststellen, dass AMs Argumentation für ein Präventiv- und gegen ein Vergeltungsstrafrecht völlig kompatibel ist mit dem Ansatz von Wolf Singer sowie mit meinen eigenen Darlegungen (siehe insbesondere das Kapitel „Gerächt ist nicht gerecht!“, JvGuB, S. 278ff.). Warum aber meinen wir im Unterschied zu Andreas Müller, dass der Abschied von der Willensfreiheitsideologie sehr wohl hilfreich wäre, um die letzten Reste eines Vergeltungsstrafrechts hinter uns zu lassen? Antwort: Weil die Unterstellung, dass sich ein Täter dank seines „freien Willens“ in einer bestimmten Situation auch anders hätte entscheiden können („Prinzip der alternativen Möglichkeiten“), im emotional-kognitiven Verarbeitungsprozess eines Individuums den Wunsch nach Vergeltung stärkt – beziehungsweise umgekehrt, weil die Unterstellung, dass ein Täter unter den gegebenen Bedingungen nur so handeln konnte, wie er unter diesen Voraussetzungen handeln musste, den Wunsch nach Rache abmildert.
Der psychologische Mechanismus, der diesem Zusammenhang zugrunde liegt, lässt sich folgendermaßen skizzieren: Wenn wir behaupten, dass sich Person A „frei“ (im Sinne von ursachenfrei) zu einer Schreckenstat entschloss, so führen wir einen nicht-berechenbaren Faktor X ein, der verhindert, dass wir die Ursachen, die zu der Tat führten, je nachvollziehen könnten. Diese angebliche Nichtnachvollziehbarkeit der Tat wird innerpsychisch (ohne, dass dies vielen Menschen bewusst wäre) dazu genutzt, um die Haltung zu legitimieren, dass wir uns gar nicht erst in die Lage des Täters hineinversetzen bräuchten. Die Willensfreiheitsunterstellung hat also innerpsychisch vor allem die Funktion einer Empathiebremse! Wir unterstellen dem anderen, dass er sich aus freien Stücken für „das Böse“ entschieden habe, damit wir aus vermeintlich guten Gründen „böse“ (im Sinne von „wütend“) auf ihn sein können.
Diese Gründe sind aber nur solange psychologisch „gut“, solange wir uns nicht die Mühe machen, das komplexe Ursachengeflecht zu verstehen, welches den Täter zu seiner Tat trieb. Würden wir uns dieser empathischen Mühe jedoch unterziehen, so würden wir sehr schnell feststellen, dass wir selbst unter vergleichbaren Umständen auch zu vergleichbaren Schandtaten fähig gewesen wären, dass wir es also letztlich nur einem günstigen Strom von Ursachenfaktoren zu verdanken haben, dass wir nicht selbst auf der Anklagebank gelandet sind.
Mit anderen Worten: Wenn wir die (durch die Willensfreiheitsunterstellung angezogene) Empathiebremse lockern, so werden wir in die Lage versetzt, den anderen zu verstehen und uns selbst in ihm zu erkennen, was unseren Rachedurst deutlich abmildert. Dies ist auch der Grund dafür, warum in jedem Vergebungstraining das empathische Einfühlen in den Täter, das Nachvollziehen der Gründe und Ursachen, die die Tat bewirkten, von fundamentaler Bedeutung ist! Um diesen psychologischen Sachverhalt zu verstehen, bedarf es keiner ausgefeilten, psychologischen Theoriemodelle. Er ist (normalerweise!) intuitiv einsichtig, was sich nicht zuletzt in den vielen, volksnahen Redewendungen widerspiegelt, die diesen Sachverhalt verarbeiten, etwa dem bekannten Sinnspruch der Sioux-Indianer: „Urteile nie über einen anderen Menschen, bevor du nicht zwei Wochen lang in seinen Mokassins gelaufen bist!“
Wie kann es also sein, dass Wolf Singer einerseits den hier skizzierten, psychologischen Sachverhalt als intuitiv einsichtig voraussetzt, während Andreas Müller ihn andererseits mit der gleichen Selbstverständlichkeit (d.h. ebenfalls ohne weitere Begründung!) als „unlogisch“ abweist? Ich fühlte mich in diesem Zusammenhang wieder einmal an „Raumschiff Enterprise“ erinnert – und zwar an die amüsanten Situationen, in denen Mr. Data bzw. sein „Vorgänger“ Mr. Spock, die „fehlende Logik“ menschlicher Gefühle bemängelten. Zwar dürfen wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Andreas Müller weder ein (weitgehend gefühlloser) Androide wie Data noch ein (Emotionen erfolgreich unterdrückender) Vulkanier wie Spock ist, doch ganz offensichtlich teilt er mit diesen beiden faszinierenden Star-Trek-Charakteren ein gewisses Unverständnis gegenüber der Dynamik innerpsychischer Verarbeitungsprozesse! Innerhalb seines eliminatorisch-reduktionistischen Denkansatzes ist dies, wie gesagt, auch durchaus konsistent: Denn wenn die von außen „unsichtbaren“ inneren Zustände von Individuen tatsächlich keinen Einfluss auf die Welt haben sollten, so wäre es in der Tat „unlogisch“, derartigen Zuständen in der Analyse besonderes Gewicht beizumessen.
Freier Wille, Schuld und Reue
Das hier zum Ausdruck kommende fehlende Verständnis gegenüber den in uns Subjekten wirksamen emotional-kognitiven Verarbeitungsprozessen schlägt sich auch in AMs abschließenden Anmerkungen zum „Konsequentialismus“ nieder. So schreibt er zu der von mir vorgenommenen Unterscheidung von Schuld- und Reuegefühlen: „Schuld bedeutet eine moralische Verurteilung, Reue ist die Einsicht in einen Fehler, um in Zukunft diesen nicht zu wiederholen (vgl. S. 215). Ob wir uns schuldig fühlen oder unsere Tat bereuen, folgt beides notwendig aus bestimmten Ursachen. Aus dieser Tatsachenfeststellung kann man aber nichts ableiten, schon gar keine eine Beurteilung, ob denn nun Schuld oder Reue besser wäre. Die sind einfach da, wenn sie da sein müssen.“
Zunächst einmal referiert Andreas Müller hier durchaus korrekt den von mir hervorgehobenen Unterschied zwischen Schuld und Reue und verweist auf den (spätestens seit Max Weber) hinreichend bekannten Unterschied von Tatsachenfeststellungen und Werturteilen (auf den ich in fast jeder meiner philosophischen Publikationen aufmerksam mache). Wo also besteht die Differenz? Er besteht in dem unscheinbaren (aber sehr bedeutungsvollen!) Sätzchen „Die [Schuld oder Reue] sind einfach da, wenn sie da sein müssen.“
Denn in AMs reduktionistischem Weltbild sind allein die physikalischen Grundkräfte (Gravitation, starke, schwache, elektromagnetische Wechselwirkung) dafür verantwortlich, ob ein Individuum Schuld- oder Reuegefühle empfindet. Viel mehr kann er innerhalb seiner eigenen Prämissen über das Auftreten von Schuld- oder Reuegefühlen nicht aussagen! In dem von mir vorgeschlagenen Modell jedoch haben kulturelle Konzepte tatsächliche Bedeutung. Und so ist das Faktum, das ein Mensch Schuld- oder Reuegefühle empfindet, keineswegs bloß auf Gravitation und physikalische Wechselwirkungsprozesse zurückzuführen (ein reichlich absurder Gedanke!), sondern vor allem auf die Wirkmacht innerer Verarbeitungsprozesse! Geht ein Individuum (fälschlicherweise) davon aus, dass es sich unter den gegebenen Bedingungen anders hätte verhalten können, als es sich verhalten hat, werden sich aus dieser Denkannahme moralische Schuldgefühle ergeben. Unterlässt das Individuum derartige Unterstellungen, so wird es sich selbst für die erfolgten ethischen Fehlhandlungen nicht moralisch verurteilen, diese aber sehr wohl bereuen und danach trachten, den entstandenen Schaden (sofern möglich) wieder gut zu machen.
Interessanterweise meint Andreas Müller in seinen weiteren Darlegungen (hier wieder analog zu meinen Ausführungen in JvGuB!), dass Reuegefühle sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft fruchtbarer seien als Schuldgefühle. Aber allem Anschein nach geht er davon aus, dass schon allein die Beherzigung der (konsequentialistischen) Maxime „Empfinde lieber Reue statt Schuld, damit es dir und allen anderen besser geht!“ ausreiche, um reale Schuldgefühle zu überwinden. In Wahrheit funktioniert dies aber ganz sicher nicht mithilfe eines solchen, einfachen Programmierbefehls (nur Data könnte mit einem „Suche Schuld und ersetze durch Reue“-Skript die eigene Matrix verändern).
Für die Überwindung von Schuldgefühlen müssen wir Menschen uns weit mehr ins Zeug legen. Vor allem müssen wir die komplexen innerpsychischen Muster dekonstruieren, auf denen unsere Schuldgefühle beruhen! Und dies ist selbst für diejenigen schwer, die den prinzipiellen Zusammenhang von Willensfreiheitsunterstellung und Schuldgefühlen verstanden haben! Denn ein bloß theoretisches Verständnis eines Zusammenhangs ist noch lange keine Garantie dafür, dass man ihn auch im eigenen Leben beherzigen kann! Wer die psychotoxischen Wirkungen des Konzepts „Schuld“ überwinden möchte, der sollte sich also auf einen langwierigen Prozess des Auffindens und Dekonstruierens eigener emotionaler und kognitiver Zuschreibungen einstellen…
Dürfen wir unsere Kinder loben?
Da Andreas Müller solche qualitativen, inneren Verarbeitungsprozesse suspekt sind, verwundert es nicht, dass er die eigentliche Pointe meiner Darlegungen im 2. Teil von „Jenseits von Gut und Böse“ nicht versteht! Er meint nämlich, dass ich nur die „Rosinen“ herauspicken würde, die sich in meinem Willensunfreiheits-Kuchen befänden. All die negativen Folgen würde ich jedoch glatt übersehen! Denn wenn es keinen Grund für Rache und Schuld gäbe, dann sollte es doch eigentlich auch keinen Grund mehr dafür geben, beispielsweise unsere Kinder für gute Noten zu loben! Und das sei, so AM, doch nun wirklich ein Verlust!
Was ist von diesem Argument zu halten? Nun, zunächst einmal loben wir unsere Kinder nicht nur, weil wir hoffen (wie AM in klassisch-behavioristischer Weise ausführt), dass sie dies „anspornen wird, sich weiterhin zu bemühen“, sondern auch, weil wir empathische Wesen sind. Das heißt: Wir freuen uns nicht bloß über unseren eigenen Erfolg, sondern auch über die Erfolge derer, die wir als Menschen wertschätzen (und zu diesem Kreis sollten die eigenen Kinder im Normalfall dazugehören!). Warum, so müssen wir uns fragen, sollte diese Freude dadurch aufgehoben werden, dass wir wissen, dass es zwingende Ursachen dafür gab, dass unsere Kinder mit guten statt mit schlechten Noten nach Hause kamen? Der Abschied von der Willensfreiheitsunterstellung verhindert doch nicht, dass wir Erfolge als Erfolge und Niederlagen als Niederlagen wahrnehmen, er verhindert bloß, dass wir die Ursachen von Erfolg und Niederlage falsch zuschreiben!
Wir können uns unter nach dem Abschied von der Willensfreiheit in der Tat nicht mehr einbilden, „unbewegte Beweger“ zu sein, die losgelöst von Ursachen Erfolge erringen oder Niederlagen erleiden. Durch diese veränderte kognitiv-emotionale Zuschreibung verlieren wir gewiss nicht die Fähigkeit, uns über Erfolge zu freuen oder Niederlagen zu bedauern! Aufgehoben werden hierdurch ganz andere emotionale Reaktionen, die bei den meisten Menschen allerdings unweigerlich mit dem Erleben von Erfolg und Niederlage verknüpft sind, nämlich Stolz- und Minderwertigkeitsgefühle.
Ich habe im zweiten Teil von JvGuB ausführlich beschrieben, dass Stolz- und Minderwertigkeitsgefühle nicht bloß auf falschen Denkvoraussetzungen beruhen, sondern auch vielfältige negative Folgen sowohl für das Individuum als auch für die Gesellschaft haben. Eigentlich sollte daher niemand dem Verlust von Stolz- und Minderwertigkeitsgefühlen nachtrauern! Im Gegenteil! Nur wenn man diese Gefühle hinter sich lässt, hat man die Chance, sich dem psychotoxischen Diktat der „Anerkennungs-Abwertungs-Zuschreibung“ zu entziehen (siehe hierzu auch Alfred Binder: Mythos Zen. Alibri 2009) und somit jene „Leichtigkeit des Seins“ erfahren, die ich in JvGuB beschrieben habe. Das vermeintliche Manko, das Andreas Müller entdeckt zu haben glaubte, ist also in Wirklichkeit eine der prächtigsten Rosinen, die man sich aus dem Willensunfreiheits-Kuchen überhaupt herauspicken kann!
Eine zusätzliche Pointe der Geschichte besteht hier übrigens darin, dass man aus einer von außen beobachtbaren Gemeinsamkeit (Vater A lobt seine Kinder / Vater B lobt seine Kinder) nur sehr schwer beurteilen kann, welche inneren Zuschreibungen die beiden Väter vornehmen, d.h. welche Bedeutung sie ihrer Handlung subjektiv beimessen. Der megastolze Vater A könnte sich durch die guten Noten seiner Kinder darin bestätigt sehen, dass nicht nur er selbst ein „absolut fantastischer Typ“ ist, der es mit seinem „eigenen freien Willen“ von ganz alleine „zu etwas gebracht hat“, sondern dass sich diese „großartigen Eigenschaften“ auch in seinen „absolut fantastischen Kindern“ widerspiegeln, die aus „freien Stücken“ all den „gnadenlosen Versagern“ endlich gezeigt haben, wo es lang geht! Der weltanschaulich bescheidenere Vater B hingegen könnte mit seinem Lob bloß demonstrieren wollen, wie sehr er sich mit seinen Kinder freut, wobei er weder sich noch seine Kinder als etwas „Besseres“ in Relation zu anderen begreift, sondern einfach nur „dankbar“ ist, dass ein günstiger Strom von Ereignissen dazu führte, dass seine Kinder gesund und intelligent genug sind, erfolgreich ihren eigenen Weg im Leben zu gehen.
Frage: Bei welchem dieser beiden idealtypischen Väter würden Sie auf Anhieb lieber zu Abend essen? Andreas Müller, der sich für „innere Zustände“ nicht sonderlich interessiert, dürfte dies einigermaßen egal sein. Meine Wahl jedoch fiele eindeutig auf Vater B – es sei denn, ich hätte Lust, mich mal wieder richtig ordentlich mit jemandem zu streiten…
Was wir schon mehrfach gesehen haben, zeigt sich also auch hier: Der eliminatorische Reduktionismus, dem Andreas Müller folgt, definiert letztlich Unterschiede weg, die sehr wohl Unterschiede machen. Aus diesem Grund halte ich den eliminatorischen Reduktionismus auch keineswegs für eine fruchtbare wissenschaftliche Hypothese, sondern bloß für eine letztlich irrelevante, metaphysische Spekulation, die zwar im Einklang mit naturalistischen Grundannahmen steht, aber bei genauerer Betrachtung weit mehr theoretische Probleme erzeugt, als sie zu lösen vermag.
Eine persönliche Bilanz
Diese dreiteilige Replik begann mit einem Dank an Andreas Müller – sie soll auch mit einem Dank an ihn enden! Denn er hat mich durch seine Artikel-Serie dazu genötigt, endlich das zu tun, wovor ich mich so lange Zeit gedrückt habe, nämlich einen Mechanismus zu beschreiben, der die reale (nicht bloß scheinbare!) Wirkung emergenter Prozesse (etwa des Abwägens von Gründen) erklärt, ohne dabei die erfolgreichen Grundprinzipien des naturwissenschaftlichen Weltbildes zu sprengen.
Meine diesbezüglichen Überlegungen entsprechen weitgehend dem Konzept des „emergentistischen Materialismus“, das Mario Bunge und Martin Mahner in ihrem Buch „Über die Natur der Dinge“ überzeugend darstellten (siehe hierzu auch meine lobende Rezension in der Philosophiezeitschrift „der blaue reiter“). Vielleicht mag es einige überraschen, dass ich mich selbst im Spektrum des „Materialismus“ verorte, denn immerhin hatte Andreas Müller ja erklärt, dass ich in Wirklichkeit gar kein „Materialist“ sei. Ich muss leider zugeben, dass ich dieses Missverständnis selbst verbockt habe. Tatsächlich hatte ich nämlich in einer Talkshow gesagt, ich sei kein „Materialist“. Allerdings bezog sich dies in der damaligen Gesprächssituation auf die weit verbreitete Vorstellung eines „Vulgär-Materialismus“, der meint, emergente Phänomene ausblenden zu können! Besser wäre es gewesen, ich hätte zwischen einem umgangssprachlichen, einem reduktionistischen, einem dialektischen und einem emergentistischen Materialismus differenziert, was jedoch im Rahmen einer Talkshow nur sehr schwer möglich ist! (Aus diesem Grund ziehe ich es gewöhnlich auch vor, den Begriff „Naturalismus“ zu verwenden, der insgesamt weniger automatische Fehlinterpretationen provoziert als der ideologisch arg strapazierte Begriff des „Materialismus“!)
Zurück zum Thema: Wenn der „emergentistische Materialismus“ im Grunde bereits korrekt beschreibt, wie es in der Natur zu neuen, emergenten Eigenschaften kommt, wo liegt dann noch das Problem, vor dem ich mich so lange drückte? Nun, die mir bekannten Ansätze legten zwar dar, dass emergente Prozesse aufgrund ihres höheren Organisations- oder Informationsgrades („Information“ ist keine außer-physikalische Kraft, sondern bezeichnet das „In-Formation-Gebrachtsein“ der Dinge!) nicht vollständig auf basale physikalische Prozesse zurückgeführt werden können. Sie erklärten für mich aber nicht in befriedigendem Maße, auf welche Weise emergente Prozesse ihren „Fußabdruck“ in der physikalischen Welt hinterlassen. Eine solche „abwärtsgerichtete Verursachung“ ist aber notwendig, um emergenten Prozessen überhaupt eine reale Bedeutung in der Welt zuweisen zu können (siehe hierzu u.a. Jaegwon Kim: Emergenz: Zentrale Gedanken und Kernprobleme. In: Thomas Metzinger (Hg.): Grundkurs Philosophie des Geistes, Bd. 2, S. 314ff.).
Durch diese Notwendigkeit einer „abwärtsgerichteten Verursachung“ entsteht ein ernsthaftes theoretisches Problem, das auf mich lange Zeit als nahezu unlösbar wirkte: Denn um in sich konsistent zu sein, müsste ein naturalistisches Emergenz-Modell zwei Bedingungen erfüllen, die sich (zumindest auf den ersten Blick!) diametral zu widersprechen scheinen: Emergente Prozesse müssten nämlich reale Wirkungen in der physikalischen Welt hervorrufen, die nicht vollständig auf die vier Grundkräfte der Physik (Gravitation, starke, schwache, elektromagnetische Wechselwirkung) zurückgeführt werden können. Um aber eine solche Wirkung auf physikalischer Ebene überhaupt entfalten zu können, müssten diese emergenten Prozesse zugleich zwingend in Form der vier Grundkräfte der Physik auftreten, da uns nun einmal keine weiteren physikalischen Kräfte bekannt sind.
Ich muss gestehen, dass mir die scheinbare Unvereinbarkeit der beiden Grundbedingungen eines naturalistischen Emergenz-Modells mitunter regelrecht den Schlaf raubte. Irgendwie ahnte ich zwar, wie die Lösung aussehen könnte, aber es gelang mir beim besten Willen nicht, diese Ahnung in einer halbwegs nachvollziehbaren Weise auf den Begriff zu bringen! In gewisser Weise half mir dann ein Zufall weiter: Durch eine erneute intensive Beschäftigung mit der Evolutionstheorie im Zuge des Darwin-Jahrs und ein Gespräch über die möglichen Besonderheiten der „evolutionären Logik“ kam mir der Gedanke, dass die „abwärtsgerichtete Verursachung“ vielleicht im Sinne des darwinschen Selektionsprinzips interpretiert werden könnte. Dies würde, wie ich meinte, die Rückwirkung emergenter Systeme erklären können, ohne dass wir hierfür irgendwelche neuen physikalischen Grundkräfte postulieren müssten! Je mehr ich diese erstaunlich einfache und elegante Hypothese überprüfte, desto fruchtbarer erschien sie mir. Aber dies allein hätte mich ganz sicher noch nicht dazu gebracht, eine solche, weitgehend unausgereifte Idee zu veröffentlichen. (Immerhin war mir ja durchaus bewusst, in welches weltanschauliches Wespennest ich mit der Hypothese einer evolutionär bedingten Makrodetermination stechen würde!)
Doch dann kam Andreas Müller! Im Grunde vertrat er in seiner Artikel-Serie Positionen, die man in ähnlicher Weise auch bei anderen naturalistisch denkenden Autoren finden kann. Aber er schrieb die Texte (anders als die meisten anderen) in einer sehr kompromisslosen, geradezu apodiktisch wirkenden Sprache. Dies ist nun einmal seine Art, die Dinge zu formulieren: Er kämpft stets mit offenem Visier, ohne all die rhetorischen Vorsichtsmaßnahmen, die sonst im akademischen Diskurs üblich sind (vernebelnde Relativierungen, undurchsichtige Sprachpanzerungen etc.). Die Klarheit seiner Positionierung ist eine Eigenschaft, die ich sehr an AM schätze, denn dadurch kann man sehr schnell feststellen, ob man seinen inhaltlichen Argumenten zustimmen kann oder nicht. In diesem besonderen Fall sorgte die Klarheit seines Auftretens dafür, dass die Unklarheit der metatheoretischen Positionen, die er vertrat, in besonderem Maße deutlich wurde. Wenn ich einen Artikel gesucht hätte, an dem ich die diversen Probleme des eliminatorisch-reduktionistischen Ansatzes idealtypisch hätte studieren können, ich hätte kaum einen besseren Text finden können!
Durch AMs Ausführungen wurde mir noch einmal schmerzlich bewusst, dass die naturalistische Argumentation ohne ein ausgefeiltes Konzept von Emergenz niemals Anschluss an die (ja keineswegs komplett unsinnigen!) Diskurse finden kann, die in den Geistes- und Sozialwissenschaften stattfinden. AMs ebenso logisches wie verblüffendes Eingeständnis (siehe die Debatte im hpd-Forum), dass er letztlich nur deshalb Religionskritiker sei, weil die physikalischen Grundkräfte (Gravitation, starke, schwache und elektromagnetische Wechselwirkung) dies erzwingen, würde in geistes- und sozialwissenschaftlichen Kreisen wohl eher als Ausdruck einer ernstzunehmenden, psychischen Störung gewertet werden – statt als Zeugnis einer gefestigten wissenschaftlichen Weltsicht! Es war also offensichtlich, dass wir dringend Brückenprinzipien brauchen, mit deren Hilfe wir den Graben zwischen den Natur- und Kulturwissenschaften überwinden können.
In meiner Schrift „Auf dem Weg zur Einheit des Wissens“ hatte ich bereits versucht, an einer solchen Brücke zu arbeiten, doch ohne ein naturalistisch stimmiges Verständnis von Emergenz fehlte ein wichtiger Stützpfeiler. Deshalb bin ich Andreas Müller wirklich dankbar (jetzt im Nachhinein – zwischendrin habe ich ihn eher dafür verflucht, dass er mir soviel Arbeit macht!) dass er mich dazu gezwungen hat, über die Beschaffenheit eines solchen Stützpfeilers noch einmal gründlicher nachzudenken.
Die Konstruktion dieses Stützpfeilers verlangt, wie ich gezeigt habe, keineswegs, dass wir uns von naturalistischen Grundprinzipien verabschieden müssten. Das Einzige, was von der naturalistischen Seite in diesem Kontext verlangt wird, ist eine Überwindung des eliminatorischen „Nichts-weiter-als“-Syndroms, welches in Naturalistenkreisen leider stark verbreitet ist! Statt weiterhin zu behaupten, dass kognitive Überlegungen „nichts weiter“ seien als neurobiologische oder gar physikalische Prozesse, sollten wir uns also auf die nüchterne Feststellung beschränken, dass jede Abwägung von Gründen notwendigerweise von entsprechenden physikalischen und neurobiologischen Prozessen hervorgerufen wird. Dass physikalisch beschreibbare Prozesse die notwendige Voraussetzung für emergente Prozesse (etwa das Abwägen von Gründen) bilden, kann man schwerlich von der Hand weisen! Doch warum sollte diese notwendige Voraussetzung zugleich auch eine hinreichende sein?
Wir stehen hier nicht vor der Entscheidung zwischen einem „Nur-Physikalismus“ (eliminatorischer Reduktionismus), der ausschließlich (!) physikalische Prozesse berücksichtigt, und einem „Nicht-Physikalismus“ (Supranaturalismus, Dualismus etc.), der meint, dass man physikalische Prozesse in irgendeiner Weise ausblenden könnte! Zur Auswahl steht durchaus auch ein „Nicht-Nur-Physikalismus“ (emergentistischer Physikalismus, Materialismus oder Naturalismus), der die Allgegenwart der basalen, physikalischen Prozesse berücksichtigt, aber trotzdem anerkennt, dass sich auf emergenter Ebene eigene Gesetzmäßigkeiten entwickelt haben, die einen realen, wenn auch physikalisch „unsichtbaren“ (weil im Einklang zu den bekannten physikalischen Gesetzmäßigkeiten stehenden) Einfluss auf die niederen Integrationsebenen haben.
Wie ich im zweiten Teil dieser Replik dargelegt habe, folgt aus dem hier vorgestellten Modell, dass wir so reduktionistisch wie möglich, aber zugleich so komplex wie nötig forschen sollten. In den vergangenen Jahren habe ich in meinen Texten den ersten Aspekt „so reduktionistisch wie möglich“ weitaus stärker betont als den zweiten Aspekt „so komplex wie nötig“. Angesichts der vielen Probleme, die durch anti-naturalistische Weltanschauungen hervorgerufen werden, scheint mir diese Strategie auch heute noch sinnvoll zu sein. Dennoch sollten wir nicht den Fehler machen, die Probleme zu übersehen, die sich eben auch aus einem allzu reduktionistischen Denkansatz ergeben! Denn dieser eliminiert letztlich all die emergenten Eigenschaften, die für unser Leben von Bedeutung sind!
Worin besteht also die Lektion, die wir Naturalisten in Zukunft vielleicht doch etwas stärker beachten sollten? Ich möchte es (in Anlehnung an einen leider sehr missverständlichen Satz Werner Heisenbergs) so formulieren: „Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft führt zum Reduktionismus; aber auf dem Grund des Bechers wartet eine überwältigende Kreativität der Materie, welche immerfort neue, emergente Ordnungen hervorbringt, die wir mit dem groben Raster des Reduktionismus niemals vollständig werden erfassen können…“
Michael Schmidt-Salomons Artikelserie:
Der erste Teil der Replik „Wege aus dem Labyrinth (1)“
Der zweite Teil der Replik „Wege aus dem Labyrinth (2)"
Andreas Müllers Artikelserie über die Willensfreiheit:
Teil 1: Im Labyrinth der Willensfreiheit
Teil 2: Abschied von der Willensfreiheit
Teil 3: Das Marionettentheater