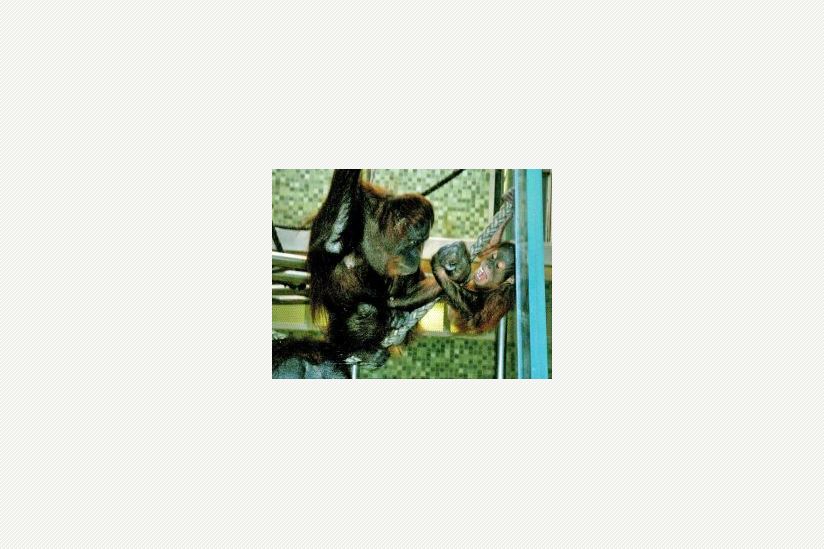BERLIN. (hpd) Die Ähnlichkeit zwischen Menschenaffen und Menschen in Gestik und Mimik ist frappierend. Die Moralisten des Mittelalters schockierte das. Heute amüsiert es eher, wenn Menschen und Gibbons sich gegenseitig im Zoo imitieren. Aber was sagt das über den Grad der Verwandtschaft aus? Diese Fähigkeiten können sich auch jeweils unabhängig voneinander entwickelt haben.
Was also macht den Menschen in dieser Hinsicht einzigartig, und wie kam es dazu? Diesen bis heute unbeantworteten Fragen geht die Primatenforscherin Katja Liebal, seit zwei Jahren Leiterin des Exzellenzclusters "Language of Emotion" am Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie der Freien Universität Berlin, nach.
Wir sind alle Primaten. Mensch und Affe haben einen gemeinsamen Vorfahren, der ungefähr dem nachtaktiven insektenfressenden Spitzhörnchen glich, sagt die Wissenschaft. Doch wie nah ist die Verwandtschaft wirklich? 99 Prozent der Gene haben wir bekanntlich mit den Schimpansen gemein, aber auch 70 Prozent mit dem Rettich.
Die 35-jährige Biologin, die seit zehn Jahren ihre Versuche am von Michael Tomasello geleiteten Wolfgang-Köhler-Primaten-Forschungszentrum in Leipzig macht, untersucht nach einer Etappe als Gastprofessorin am Department of Psychology der University of Portsmouth in England mit ihrem Team nun, wie Emotionen Sprache beeinflussen können und ob der Mensch Sprache braucht, um Emotionen auszudrücken.
Ihre vorläufigen Erkentnisse dazu präsentierte sie in Berlin in der Urania. Dabei will die Wissenschaftlerin herausfinden, ob auf dem langen Weg zur Menschwerdung Töne und schließlich die Kombination einzelner Laute die Vorläufer von Sprache waren oder Gesten. Beide Theorien schließen sich, so Katja Liebal, gegenseitig aus. Bei den Grünen Meerkatzen lässt sich immerhin beobachten, dass sie mit unterschiedlichen Lautkombinationen Alarm schlagen, je nachdem, ob sich eine Pythonschlange am Boden, ein Adler aus der Luft oder ein Leopard aus dem Busch oder Baum nähert. Sollte sich aber die Sprache aus Mimik und Gesten entwickelt haben, so setzt das voraus, dass die Primaten sie willentlich einsetzen können und im Laufe des Lebens neue Gesten dazu gewonnen werden können. Da dies beobachtet wurde, scheint dieser zweite Ansatz weiter zu führen.
Vor etwa dreißig Jahren erhoffte man sich eine Antwort auf diese Frage über den Versuch, Menschenaffen Sprache beizubringen, seien es Laute oder Symbole auf einer Computertastatur, erinnert Katja Liebal. Die Versuche mussten letzten Endes aufgegeben werden. Nach jahrelangem Training konnte ein Schimpansenmädchen gerade vier Worte aussprechen. So etwa das Wort „Cup“, Tasse. Dies aber nur, indem es die Finger zu Hilfe nahm, um die Lippe entsprechend zu Formen. Auch in der Gebärdensprache kam man nicht viel weiter. Denn die Schimpansen lernten sie nur, indem man ihnen die Hände zuvor zu der gewünschten Geste formte, also durch Berührung, nicht durch Imitation.
Aber schon da stellte sich eine Einschränkung unseres „zurückgebliebenen Verwandten“ heraus: Affen lernen nur solche Gesten, die Aufforderungen sind, die sich auf die eigene Person beziehen, also ausdrücken, was der Affe selbst möchte oder haben möchte.
Der amerikanische Anthropologe Michael Tomasello hat die Standards dafür gesetzt, was als Gesten gelten kann. Sie müssen gerichtet sein. Sie müssen variiert werden können und sie müssen eine flexible Verwendung haben. Auf 20-35 Gesten ist er je nach Menschenaffenart gestoßen. Nach zehn Jahren Forschungsarbeit am Leipziger Primaten-Forschungszentrum schränkt er den Rahmen der Möglichkeiten, innerhalb derer unsere nächsten Verwandten Gesten einsetzen können, deutlich ein. Sie sind bei den Affen stets sehr handlungsnah und Primaten benutzen keine symbolischen Gesten. Ihre Bedeutung ergibt sich aus der Interaktion im Kontext und sie benutzen keine Zeigegesten. Sie zeigen zwar auf Futter, wenn ihr Pfleger ihr Futter versteckt, aber dies ist bei der natürlichen Interaktion nicht zu beobachten. Die Gesten bleiben in der Regel diadisch, sie werden kaum je referentiell.

Katja Liebal / Foto: Simone Guski Die Leipziger Schule, der auch Katja Liebal angehört, verweist mehr auf die Unterschiede zwischen Mensch und Affe, als auf deren Gemeinsamkeiten. Anders als Frans de Waal, der mit seiner Theorie vom „guten Affen“ und „Affen als Moralisten“ weltweit Furore machte. In diesem Sinne betont Katja Liebal auch, dass Affen nur selten aktiv Futter teilen, viel öfter tolerieren, dass ihnen etwas weggenommen wird.
Auch in der Mimik sind die Ähnlichkeiten bei Mensch und Primaten in ihrer Anwendung und Bedeutung nur schwer eindeutig nachzuweisen, so die junge Primatenforscherin. Zwar beobachtet man an den Bonobos eine Mimik ähnlich unserem Lachen, doch bedeutet sie offenbar eher Unsicherheit und Angst – Gefühle, die auch Menschen mitunter lachen lassen, möchte man hinzufügen. Während unserem Lachen bei den Orang Utangs ein weit geöffneter Mund entspricht. Trotzdem, Affen lachen genau wie wir, wenn man etwa einen jungen Orang kitzelt. Allerdings sowohl bei Einatmen als auch beim Ausatmen, eben anders als wir.
Sie teilen auch. Eine dazu ansatzweise diadische Geste beobachtete Katja Liebal, als ein junger Orang mit aufgehaltener Hand, die er einem Nüsse fressenden älteren Orang unter den Mund hielt, um Futter bettelte - wobei er allerdings in der filmisch dokumentierten Szene nur die leeren Nussschalen als Gabe erhielt.
Es gilt, den Kontext bei der Interpretation der Mimik zu berücksichtigen, will man keine Fehler bei der Deutung machen. Bei entsprechender Umsicht kann man, beobachtet man einen ganzen Handlungszusammenhang, doch wieder auf überraschende Ähnlichkeiten stoßen. So wurde in Leipzig beobachtet, wie, nachdem ein Schimpanse einem anderen Futter, das sich auf einem Tisch zwischen ihren beiden sie trennenden Käfigen befand, wegzog, der geprellte Affe, begleitet von einem gewaltigen Wutausbruch, den ganzen Tisch mit Hilfe einer eingebauten Hebelvorrichtung zum Zusammenklappen brachte - so konnte nun keiner der beiden mehr an das Futter gelangen. Geteiltes Leid ist immerhin halbes Leid!
Können Affen Trauer zeigen? Oft wird berichtet, dass Affenmütter ihr totes Junges tagelang mit sich herumschleppen oder sich Affengruppen lange Zeit um ihren toten Artgenossen scharen. Doch, wendet Katja Liebal ein, kann man wirklich ausschließen, dass sie nicht einfach Interesse an dem Zustand des toten Tieres haben?
Um mehr über die Emotionen von Gibbons sagen zu können, untersucht Liebals Team zunächst die Funktion der an der Mimik beteiligten Muskeln, die über minimale elektronische Reize ausgelöst wurden, im Vergleich zu Menschen, bei denen eine englische Forschergruppe ähnliche Experimente ausführte. Im Prinzip dieselben wie 1862 Charles Darwin. Nun wird in so einem derart objektivierenden Verfahren notiert, welche Muskeln wie an welcher Mimik beteiligt sind, ohne eine Voraussage über den emotionalen Kontext machen zu müssen. Den bezog der Erfinder der Evolutionstheorie seinerzeit freilich schon ausdrücklich mit ein, als er Fotos von Kindern der englischen Mittelschicht anfertigen ließ und auf ihre emotionalen Ausdrucksmöglichkeiten miteinander und 1872 durch entsprechende Bildgegenüberstellungen in seinem Archiv mit der Mimik etwa eines lachenden Makaken verglich.
Für die Gibbons entschied man sich in Leipzig zunächst trotz oder gerade weil man davon ausgehen musste, dass die relativ monogam in Kleinstgruppen lebenden Tiere voraussichtlich über eine eher begrenzte Mimik verfügen. Als Grundregel gilt: „Sie wird stets umso vielfältiger, je komplexer die Gruppen werden, denn damit wird die Kommunikation zwangsläufig umfangreicher und flexibler“. Die Muskeln sind ähnlich wie beim Menschen, das mimische Repertoire auch, doch steht die Beantwortung der Frage nach den sie auslösenden Emotionen noch ganz am Anfang der Forschung.
Empathie wiederum ist weit mehr als pure Emotion, empathisch wird die Position des anderen eingenommen. Und sie ist die Voraussetzung für Hilfe. Diesem Phänomen unter den Menschenaffen ist gleich Frans de Waal auch Katja Liebal in einem anderen Forschungsprojekt auf der Spur. Wie Tomasello es oft getan hat, vergleicht sie hierbei das Verhalten von Kleinkindern und Primaten. 18 Monate alte Kinder schenken einem ihnen unbekannten Erwachsenen einen Luftballon, wenn dieses Spielzeug ihm abhanden gekommen ist und sie selbst über zwei verfügen. Tun Menschenaffen etwas Vergleichbares? 50 Prozent aller Orangs, die zweite neben den Gibbons von Liebal genauer untersuchte Menschenaffenart, helfen ihrem Artgenossen. Sie tun dies in einem Versuch, wenn dieser nicht an das Futter außerhalb seines Käfigs heranlangen kann, indem sie ihm ein Stöckchen durch die trennenden Gitterstäbe von einem in den anderen Käfig hinüberreichen, obwohl sie damit nicht einmal selber an das Futter herankommen können. Ja, einer reichte sogar auf Signale des bemühten Affen ein längeres Stöckchen, als sich das zunächst ausgehändigte als zu kurz erwies. „Orang Utangs helfen sogar weit öfter als andere Menschenaffenarten und erweisen sich damit noch vor den Bonobos oder Schimpansen als die empathischsten aller Menschenaffen“, stellte Katja Liebal fest. Eine Situation des moralischen Ausgleichs bei einer Schädigung erfassen sie allerdings nicht, wenigstens nicht, wenn es nicht um die eigene geht. Affen sind eben doch keine Moralisten.
Simone Guski