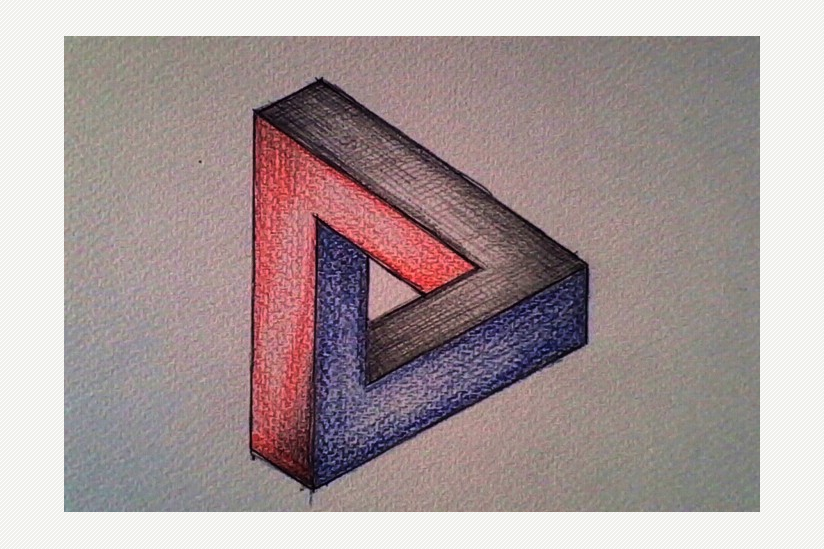BERLIN. (hpd) Der Alltag ist für viele Menschen so tief von ökonomischen Zusammenhängen beeinflusst, dass man die Bedeutung der Ökonomie als Wissenschaftsdisziplin mit jener der Medizin und der Ingenieurwissenschaften vergleichen kann. Aber anders als etwa in der medizinischen Forschung oder den Entwicklungen im Maschinenbau wirken wirtschaftswissenschaftliche Bemühungen oft seltsam kraftlos.
Naturwissenschaften haben nicht erst seit gestern solide Grundlagen. Man ist seit langem in der Lage und daran interessiert, wahre von falschen Aussagen zu unterscheiden und systematisch Wissen zu gewinnen. Man arbeitet mit wissenschaftlichen Methoden, folgt hohen fachlichen und ethischen Standards und entwickelt diese in der täglichen Arbeit weiter. Entsprechendes gilt auch für jene Fächer, die Naturwissenschaften konsequent anwenden. Grundsätzlich ist dagegen wohl wenig vorzubringen, auch wenn es ebenso selbstverständlich ist, dass dabei auch all jene menschlichen Schwächen zu Tage treten, die man auch außerhalb des Wissenschaftsbetriebs kennt. Und unterm Strich funktioniert es ziemlich gut - von der Verpackungsmaschine für Joghurt bis zum maßgeschneiderten Antibiotikum.
Pauschalurteile sind immer falsch.
Mit der Ökonomie ist es irgendwie anders. Es scheint, dass die Wirtschaftswissenschaften gegenwärtig auf einer beschreibenden Stufe verharren, so wie man es am Beginn der Entwicklung einer Disziplin antrifft. Die gewöhnlich darauf folgenden Schritte zur Analyse und zur Systematik scheinen heute noch in weiter Ferne zu liegen, von der Fähigkeit zur Vorhersage nicht zu reden. Selbst mancher oberflächliche Wetterbericht im Fernsehen ist heute erheblich zuverlässiger als etwa eine Expertenmeinung zum Börsengeschehen.
Dabei war man in mancher Hinsicht schon einmal weiter. Unglücklicherweise folgten auf einige sehr fruchtbare Entwicklungen im 19. Jahrhundert die ideologischen Vereinnahmungen eines Teils davon im 20.Jahrhundert. Demenstprechend sieht auch heute vermutlich mancher die Dinge durch eine Brille mit erkennbar ideologischer Tönung. Das ist der Sache sicher nicht förderlich, denn es entstehen dadurch Denklager und man kann beobachten, wie wechselseitige Ablehnungen schon daran festgemacht werden, wie man jemanden dieser oder jener Gruppe zuordnet, ohne Ansichten und Ergebnisse überhaupt zu prüfen.
Als jüngeres und populäres Beispiel mag Y. Varoufakis gelten. "Das Werk 'Time for Change' des griechischen Ex-Finanzministers durchweht der Geist von Karl Marx. Von moderner Ökonomik hält der Provokateur nichts." 1 Mit diesen Worten wird ein Artikel eingeleitet. Damit ist die Sache bereits erledigt. Varoufakis ist bei Marx und Provokateur. Pfui! Vermutlich, um das unausgesprochene "pfui" nicht so emotional rüberkommen zu lassen, sondern um der Ablehnung einen ratioanlen Anstrich zu geben, schiebt der Autor nach, Varoufakis halte nichts von "moderner Ökonomik" - was immer das sein mag. Wenn man jemandem bereits in der Einleitung auf diese Weise quasi die Kompetenz abspricht, muss man sich weiter keine Mühe machen - auch nicht die, den Artikel zu lesen, denn besser wird es kaum.
Ist schon einmal einem Ingenieur als Qualitätsmerkmal seiner Arbeit vorgehalten worden, seine Ansichten seien nicht "modern"? Wenn er sein Problem mit mathematischen Mitteln gelöst hat, die bereits Euklid kannte, ist es gut. Wenn er sich dabei der Infinitesimalrechnung bediente und sich so auf Newton und Leibniz bezog, auch gut. Würde jemand fordern, er solle Tensoren bei seinen Berechnungen verwenden, nur weil die ein wenig jünger, also "moderner", sind? Eine absurde Vorstellung - wenigstens in den Ingenieurwissenschaften. Das Ergebnis interessiert, nicht die Entstehungszeit des Werkzeugs - oder will jemand Rad und Schrift verwerfen, nur weil ihre Erfindung schon etwas zurückliegt?
Die Frage nach einer "Mode" bzw. "Modernität" teilt hier kaum etwas über die kritisierte Arbeit mit, wohl aber über den Kritiker. Dieses Muster ist in der Behandlung ökonomischer Ansichten kein Einzelfall. Das ist wenig förderlich für eine Entwicklung.
Statt vom Erreichten aus weiterzudenken und all das zu nutzen, was in den vergangenen 150 Jahren in Wissenschaft und Technik hervorgebracht wurde, beharrt man in der "modernen" Ökonomie zuweilen auf geradezu naiven Ansätzen und Prämissen. Diese werden heute gern hinter eitlen mathematischen Gebilden versteckt, die zu verstehen und zu hinterfragen nur wenige die Mühe und Geduld aufbringen. Zu neuen Einsichten verhelfen sie dabei kaum. Man fühlt sich an mittelalterliche Scholastik erinnert: Was im Ergebnis zu stehen hat, ist von vornherein klar. Man kann sich nur dadurch hervortun, dass man einen neuen oder handwerklich besonders anspruchsvollen Weg dorthin aufzeigt. Was nützt aber das schönste mathematische Modell, wenn die Voraussetzungen nicht tragen, wenn es schlicht nicht funktioniert? Kein ernsthafter Ingenieur würde vergleichbares in seinem Fach auch nur eines zweiten Blickes würdigen. Aber hier wird mathematisch verpackte Kaffeesatzleserei mit gebetsmühlenartig wiederholten Glaubenssätzen verbunden, die der Wirklichkeit nicht gerecht werden können. Es scheint, die ideologischen und zuweilen geradezu religiös erscheinenden Scheuklappen gestatteten es manchen Ökonomen nicht, den Finger auf wunde Stellen zu legen, wo dürre Vermutungen und nachgewiesen falsche Annahmen mit ernsthafter Forschung durch solides Wissen zu ersetzen wären.
Das Konkurrenzparadoxon
Oft kommen dann bestürzend schlichte Dinge als tiefe Erkenntnisse daher - wie etwa das Konkurrenzparadoxon. Dabei geht es darum, dass es Situationen gibt, in denen das, was für ein Individuum nützlich erscheint, zum Nachteil wird, wenn dieses Individuum zu einer Gruppe gehört, in der die anderen mehr oder weniger dasselbe meinen oder tun. Es ist ganz einfach: Im Kindergarten wird mitgeteilt, man könne draußen spielen. Die ganze Rasselbande stürmt zur Tür. Dort gibt es ein dichtes Gedränge und es geht erst mal nicht so recht weiter. Jedes Kind wollte ganz rasch hinaus, traf dabei mit anderen zusammen, die dasselbe im Sinn hatten und man stand sich augenblicklich gegenseitig im Wege und auf den Füßen. Warum? Weil die Kinder mangels Erfahrung und Einsicht noch nicht zu erkennen vermochten, dass sie nicht rasch zur Tür wollten sondern rasch draußen sein wollten. Das ist ein Unterschied, den ältere Kinder irgendwann verstehen. In einer Schule rennen die Kleinen noch zur Tür, während die Älteren mehr Gelassenheit zeigen. Dementsprechend reduzieren sich die Drängeleien am Ausgang. Kennt jeder.
Selbstverständlich kann man die Kindergartenerfahrung im Bemühen um größeren Ernst etwas dramatisieren und den Vorgang in ein brennendes Kino verlegen. Aber hier wie dort gilt: Niemand will schnell zur Tür, aber alle wollen schnell draußen sein. In einer solchen Notsituiation wird es kaum jemanden überraschen, wenn die Leute es dann irtümlich für nützlich halten, auch schnell zur Tür zu kommen.
In der Ökonomie ist das ein Riesending. So feiert Heiner Flassbeck den Ökonomen Wolfgang Stützel (Bundesverdienstkreuz 1985 2) zu dessen 75. Geburtstag: "Wieder gilt die alte von Stützel so geliebte Formel, daß ein einzelner Zuschauer bei der Prozession aufstehen kann, um seine Sicht zu verbessern, alle aber offensichtlich nicht." Flassbeck spielt hier auf das Konkurrenzparadoxon an und bringt ein gänzlich ungeeignetes Beispiel. Wenn nämlich alle aufstehen, so befinden sich ihre Augen in Höhen mit einer größeren Streuung als wenn sie sitzen. Das führt dazu, dass bei einer stehenden Zuschauermenge mehr Leute akzeptable Sicht haben als wenn alle sitzen. Im Sitzen ist die durchschnittliche Abweichung vom Durchschnitt der Augenhöhen geringer. Man könnte auch sagen, im Stehen ist mehr Platz, um irgendwo hindurchzuschauen.
Etwas näher dran scheint da, was auch Flassbeck in seiner Festschrift andeutet: Beispiele für das Konkurrenzparadoxon in der Wirtschaft. Was für ein Wirtschaftssubjekt nützlich ist, sofern es allein handelt, verkehrt sich zuweilen ins Gegenteil, wenn viele oder alle gleichzeitig dasselbe versuchen. Gern wird dabei auch das Ladenöffnungsbeispiel gebracht 3. Unterstellt, die zulässige Ladenöffnungszeit würde verlängert. Dann könnte man den Laden länger offen halten und so mehr Umsatz und Gewinn machen. Würden alle dem Beispiel folgen, wäre der Vorteil dahin. Es blieben nur die höheren Kosten. Klingt griffig, ist es aber nicht. Nicht alle können den Aufwand betreiben, der dafür nötig ist, den Laden länger zu öffnen. Die Bedingungen sind also nicht für alle gleich. Weiter würde es umgekehrt bedeuten, man könnte auch genausoviel verdienen, wenn man die Ladenöffnungszeiten gesetzlich verringern wollte. Das geht nur in eingeschränktem Umfang. Denn sicher kann man nicht in 2 Stunden die Kundenzahl durch einen Laden schleusen, die man in 12 Stunden schafft. Das ist der Hinweis darauf, dass der Effekt längerer Ladenöffnugszeiten nicht nur darin liegt, anderen, die nicht mitziehen können, Marktanteile abzugraben, sondern auch darin, einen Umsatzzuwachs zu generieren. Mancher geht eben abends doch mal für etwas völlig Überflüssiges los, weil es halt zu bekommen ist, worauf man aber leicht verzichten könnte, wären die Läden zu (Chips & Schokolade). Das Ganze könnte man nun noch mit den Werkzeugen der Mengenlehre darstellen und schon sähe es chic, wissenschaftlich und bedeutungsvoll aus. Soviel zur "modernen Ökonomik".
Ein Paradoxon scheint vielleicht nicht so sehr im Handeln einzelner und vieler in Konkurrenzsituationen zu liegen. Das ist trivial. Paradox erscheint viel mehr der Widerspruch zwischen dem Bedarf an leistungsfähiger Wirtschaftswissenschaft und dem gleichzeitigen Mangel daran.
- Die Welt, http://www.welt.de/wirtschaft/article143838114/Varoufakis-Kampfschrift-e... ↩︎
- Heiner Flassbeck, http://www.flassbeck.de/pdf/2000/gesamtwi.pdf ↩︎
- Wikipedia, de: “Konkurrenzparadoxon” ↩︎