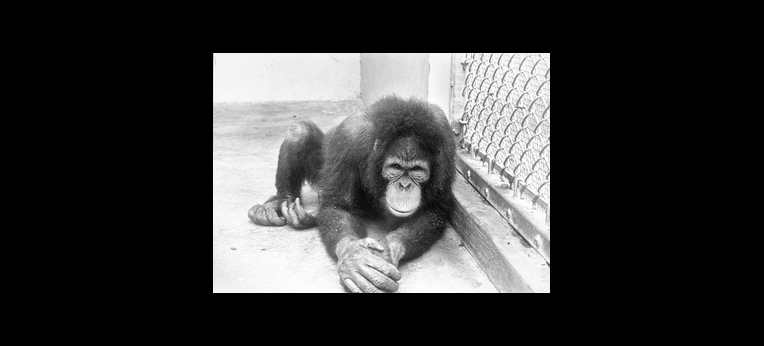BERLIN. (hpd) Eine so lange und so enge Beziehung wie zum Hund hat der Mensch zu keinem anderen Tier. Mit keinem sonst ist die Kommunikation derart differenziert. Auf beiden Seiten. Hunde haben eine sprechende Mimik. Ihr Wesen wurde aber auch Gegenstand von Projektionen. Die Ausstellung "Wir kommen auf den Hund" im Berliner Kupferstichkabinett zeichnet anhand alter und neuer Grafik den gemeinsamen Weg von Zwei- und Vierbeiner der letzten 600 Jahre.
"Pets", Familienhunde und Freizeitbegleiter sind unsere haarigen Hausgenossen noch gar nicht so lange. Zu ansonsten aufgabenlosen Spielgefährten wurden sie erst im 19. Jahrhundert. Vielleicht nicht zufällig im selben Jahrhundert, in dem man den Bürgern der großen Städte exotische wilde Tiere erstmals in Käfigen zur Besichtigung präsentierte. Davor half der Hund erst beim Jagen, dann beim Hüten des Viehs, war Wach- und Karrenhund und vieles mehr. Er musste sich sein Dasein verdienen.

Ist es ein Zufall, dass wir heute geneigt sind, jede andere Tätigkeit denn als die des möglichst noch halsbandlosen Begleiters als Tierquälerei aufzufassen? Schon immer segneten Gesetze schließlich einen gesellschaftlichen Konsens ab. Und gefordert wird zuvor, was oft ohnehin schon auf dem Weg ist zu werden.
Wohl wegen des ausdrucksstarken Minenspiels und der Fähigkeit des Hundes, auf uns einzugehen, unsere Gefühle zu erahnen und unsere Mimik zu deuten, lag es nahe, wiederum dem Hund zuzuschreiben, was wir sind, oft auch, was wir hoffen oder fürchten zu sein. Dürers schlafender Hund neben seiner "Melancholie" wird als schlafender Neid gedeutet, sein zu Füßen des Heiligen Hieronymus neben dem Löwen ruhender Vetter dagegen als Metapher der Eintracht. Während der Hund auf Hendrick Goltzius hinreißender Radierung des Knaben "Frederik de Fries mit dem Hund des Goltzius" aus dem 16. Jahrhundert zum Sinnbild der Treue wird. Das Kind hält auch eine Taube, Symbol der Einfachheit. Die ja mit der Treue Hand in Hand gehen soll. Der kackende Hund Rembrandts vor dem guten Samariter fungiert als drastische Darstellung der Triebhaftigkeit, die Menschen einander Gewalt antun lässt und hilfsbedürftige Opfer zurücklässt. Des Hundes putzwaches Hundeeigenleben regt sich endlich auf Max Liebermanns Radierung "Der Kahn" mit einem Liebespärchen darauf und einem Hund an Bord, der von ihm abgekehrt wohlgelaunt über das Wasser schaut. Otto Dix gliedmaßenamputierter "Streichholzhändler" wird schließlich selbst von einem Hund noch angepinkelt.
Dann sind da noch die Hundeportraits, von Rassehunden meist. Thomas Gainsboroughs "Studie einer Bulldogge" aus dem 18. Jahrhundert oder Giovanni Domenico Tiepolos "Windhunde auf einer Anhöhe". Sie zeigen hochgezüchtete vom Menschen kreierte Geschöpfe, doch gleichwohl Individualisten mit ihren Marotten, mehr als sie jeglichem Tier in freier Natur möglich wären. Wie die schlotternde Bulldogge mit ihren weit aufgerissenen Augen. Was sie so glasig starren lässt, weiß nur sie selbst. Denn Hunde scheinen zwar alles über uns zu wissen, aber seien wir uns nicht so sicher, dass wir ihr Innenleben kennen. Auch wenn es neuerdings Gegenstand von Versuchen wird, wie auf Wolfgang Petricks Farblithographie eines von Schläuchen durchbohrten Schäferhundes oder Nanne Meyers collageartiger Planskizze einer Versuchsanordnung "Können Tiere denken?"
Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin: "Wir kommen auf den Hund", bis 20.9. Kulturforum Matthäikirchplatz 10785 Berlin, Katalog 120 S., 14,95 S.