Es rauscht gewaltig im Literaturbetrieb und im Blätterwald der Journaille. Endlich ein Thema jenseits von Corona, über das es sich lohnt zu streiten: Identitätspolitik! In der Hamburger Lehrerzeitung (hlz) schrieb Joachim Geffers dazu einen Kommentar, den der hpd hier nachveröffentlicht.
Nachdem es, angefangen mit radikal-feministischen Gruppierungen, die eine insgesamt um Veränderungen kämpfende Strömung geschlechterdefinierter Identitäten unter dem Akronym LSBT* entstehen ließ, erhielt das Ganze durch die US-amerikanische Black Lives Matter-Bewegung noch mehr Schubkraft, in deren Reihen sich mehr und mehr Positionen durchgesetzt haben, die jene Ausschließlichkeitskriterien vor sich hertrugen, die zunehmend für Irritation sorgen und nun auch das deutsche intellektuelle Milieu in Aufregung versetzen. Und nicht nur dort: Selbst im Parteiengezänk oder auch parteiintern ist die Auseinandersetzung angekommen.
Cancel Culture
(…) Die Frontstellung, die sich hier als Kampf um Diskursmacht, Wahrnehmung und Anerkennung abbildet, ist kulturell und gesellschaftlich so bedeutsam wie komplex. Sie wird Generationenkonflikte sowie das Ringen um die Gestaltung der heterogenen Gesellschaft auf lange Zeit prägen. Anders als Wolfgang Thierse es erhofft, kann es dabei keine Erlösung durch einende Wirgefühle geben. Es geht um das Anerkennen, Respektieren und Organisieren von Unterschiedlichkeit, um Gerechtigkeit und Teilhabe. Es geht aber eben auch um Diskursfähigkeit, Verständnis und Gesprächsbereitschaft. (…)
Stephan Detjen, Chefkorrespondent von Deutschlandradio: Die SPD und Wolfgang Thierse – Kaltes Kalkül in komplexer Debatte, gesendet am 6.3.2021
Prominentestes Beispiel dafür, was unter dem Begriff Cancel Culture (dt. Absage- oder Löschkultur) die Runde macht (s. Kasten), war die Einlassung des SPD-Altvorderen Wolfgang Thierse, der sich, nachdem er in einem in der FAZ veröffentlichten Artikel das für ihn seltsame Gebaren so mancher sich auf identitäre Politik Beziehende als gesellschaftspolitisch bedenklich bis gefährlich charakterisierte, der Schelte seiner Parteivorsitzenden Saskia Esken und des Hoffnungsträgers der SPD, Kevin Kühnert, ausgesetzt sah. "All das beschämt uns zutiefst", und sie seien besorgt über ein rückwärtsgewandtes Bild der SPD, so kommentierten es Esken und Kühnert nach einem eigens dazu einberufenen parteiinternen Forum.
Da gerade wir als hlz-Redaktion es waren, die als eines der ersten Publikationsorgane unsere Texte gegendert haben, fühlen wir uns direkt angesprochen, Position zu beziehen. Dass es dabei mittlerweile nicht nur um die breit geführte Debatte des Genderns von Sprache geht, ist der Dynamik der Auseinandersetzung geschuldet, die inzwischen viele andere gesellschaftliche Fragestellungen unterdrückte Minderheiten betreffend aufgeworfen hat.
In einer Gesellschaft gehen Veränderungen immer von deren Rändern aus. Warum sollte auch die saturierte Gruppe das in Frage stellen, was ihrem Leben bislang Stabilität verlieh? Insofern sind die heftigen Reaktionen derer, die sich in eben jener Mitte wähnen, schon zu erklären. Ob sie berechtigt sind, ist eine andere Frage bzw. hängt wie immer vom Standpunkt der Betrachter_innen ab.
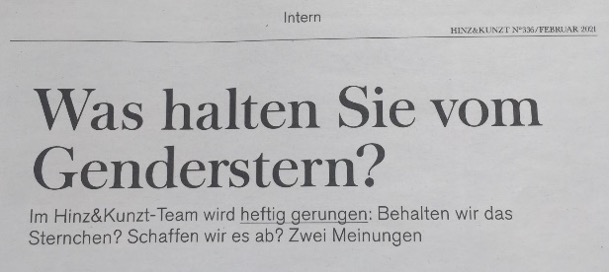
Umgekehrt kann man aber auch nicht jede Kritik, die von einer Minderheit kommt, mit einem Kredit versehen, auch wenn diese gern mit der Attitüde des Benachteiligt- und /oder Unterdrücktseins versucht, diesen für ihre Position zu beanspruchen.
So geht es mir auf jeden Fall im Zusammenhang mit der in der Linken aufgebrochenen identitätspolitischen Debatte. Nur um diese geht es mir! Auch wenn semantische Ähnlichkeiten zur völkisch-nationalistischen Strömung der Identitären vorhanden sind, so hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Um Missverständnissen vorzubeugen, seien die Unterschiede deshalb noch einmal dargelegt.
Links nicht gleich rechts
Während es den Protagonist_innen der linken identitätspolitischen Bewegung eindeutig darum geht, historisch gewachsene Diskriminierungen zu beseitigen, geht es den Rechten immer darum, die eigene kulturelle Identität als Schutzschild vor Überfremdung, sprich: Veränderung, zu einer Panzerung auszubauen. Jede/r, der oder die sich dem in den Weg stellt, wird als Verräter_in am eigenen Volk gebrandmarkt. Dabei ist klar, dass es keinerlei Differenzierung bedarf, wer wessen Identität gefährdet, wenn es um die Reinhaltung des eigenen "Volkskörpers" geht. Gesellschaftliche Unterschiede – außer Führer und Geführte – haben dort keinen Platz, man kennt folglich nur Volksgenossen!
Der qualitative Unterschied zwischen linker und rechter identitätspolitischer Bewegung besteht für mich folglich darin zu unterscheiden, ob die jeweils um Partizipation und Integration ringenden, sich diskriminiert fühlenden Angehörigen einer Gruppe dies in einen gesellschaftlichen Kontext stellen, der objektiv von Ungleichheit gekennzeichnet ist. Dabei geht es mir bei diesen tagesaktuellen oder auch zeitgeschichtlichen Auseinandersetzungen nicht um eine Hierarchisierung von Zielen oder etwaigen Zielkonflikten, sondern um deren Einordnungen in eine komplexe gesellschaftliche Struktur. Konkreter: die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenwiderspruch, wenn sie denn genutzt wird, um damit Bewertungen im Sinne einer Rangfolge vorzunehmen, führt auf den falschen Weg. Vielmehr bedingt das eine das andere. Das heißt, wenn ich als Ziel eine klassenlose Gesellschaft anstrebe, muss ich auf dem Weg dorthin die zahllosen als nebenwidersprüchlich charakterisierten Eigenarten, die alle ihre Wurzeln in eben einer auf Klassenunterschiede beruhenden Gesellschaft haben, nicht nur erkennen, sondern im Hier und Jetzt bekämpfen. Das ist dann der berühmte Weg, der beschritten werden muss, ohne das Ziel aus dem Auge zu verlieren, und um das Argument dialektisch betrachtet zu vervollständigen: Ich muss das Ziel kennen, um den richtigen Weg zu finden.
Stachel im Fleisch
Aber nun konkreter: Die in den letzten Wochen erneut aufgeflackerte Diskussion um eine gendergerechte Sprache zeigt, wie tief der Stachel im Fleisch bei jenen sitzt, die sich in ihrer Identität als Kulturträger_innen aufgerufen fühlen, deutsches Kulturgut, das heißt eben auch die Sprache, zu schützen und sich deshalb dem von ihnen ausgemachten "Genderwahn" von Feminist_innen entgegenstellen müssen.
Apropos gegenderte "Feminist_innen". Hier liegt ein weiteres Minenfeld bereit. Denn ein Teil der Bewegung für umfassende Gleichstellung spricht jenen das Recht ab, für die gerechte Sache streiten zu dürfen, wenn sie nicht direkt von der Diskriminierung betroffen sind. Das meint in diesem Fall: ein Mann kann sich weder als Feminist begreifen noch als solcher bezeichnen, weil er objektiv dazu das falsche Geschlecht hat.
Dies setzt sich fort, wenn man hört, dass beispielsweise eine weiße Übersetzerin keinen Text einer Schwarzen Autorin übersetzen könne. So geschehen aktuell mit der Lyrik Amanda Gormans, jener schwarzen Frau, die bei der Amtseinführung Bidens ein Gedicht deklamierte, das für weltweite Aufmerksamkeit sorgte. Die queere holländische Übersetzerin zog sich zurück, nachdem in den Sozialen Medien harsche Kritik aufkam, dass für die Aufgabe keine schwarze oder PoC-Übersetzerin ausgewählt worden sei. Einem Katalanen mit selbigem Auftrag wurde selbiger wieder entzogen. Und in Deutschland versuchte der Verlag, das Problem zu lösen, indem man gleich drei Frauen mit der Übersetzung betraute.
Spuren verwischen
Diese Art Kritik, gelabelt als kulturelle Aneignung, bildet den Kern der Auseinandersetzung um Positionen der links-identitären Bewegung. Was bei Blackfacing aus meiner Sicht nachvollziehbar ist, dass es sich bei der über Jahrhunderte lang diskriminierten, geknechteten oder präziser: versklavten Menschen verbietet, Stereotype über schwarze Identität sich von Weißen vorführen zu lassen, ist im Umgang mit der Eliminierung historischer Zeugnisse dieser Diskriminierung schon schwieriger. Gemeint ist das Streichen rassistisch konnotierter Verwendung von Begriffen aus der Literatur durch tatsächlich oder vermeintlich neutralere Bezeichnungen wie beispielsweise das N-Wort.

Sternsingergruppe in Baden-Württemberg, Foto: James Steakley, Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Das, was für Kinderbücher richtig sein mag, dass man derlei Begriffe verändert, ist aus meiner Sicht für die übrige Literatur kontraproduktiv. Ist das nicht gleichbedeutend mit Spuren verwischen? Ein Grund, sich mit historischer Literatur zu beschäftigen, liegt doch gerade darin, dem Denken und Fühlen der Menschen zu den jeweiligen Zeiten, in denen das Werk entstand, nachzuspüren. Wenn man nun aber gerade jene Begrifflichkeiten streicht oder ändert, mit denen sich Diskriminierung bis in die Gegenwart hinein erklären lässt, dann beraubt man sich ein Stück weit der Chance, die Gegenwart aus der Vergangenheit heraus verstehen zu können.
Übrigens begegnet uns dieses Problem ganz aktuell mit der auch von der GEW unterstützten Kampagne für den Wiederaufbau der von den Nazis zerstörten Synagoge auf dem Bornplatz. Das Auschwitz-Komitee und auch bekannte linke Israelis kritisieren dies ganz im oben beschriebenen Sinne als ein Spurenverwischen.
Gleich ist nicht gleich
Insofern kommt es immer drauf an, welcher historische Kontext angesprochen ist, wenn von kultureller Aneignung gesprochen wird. So finde ich beispielsweise das kindliche Indianerspiel nicht diskriminierend. Auf jeden Fall kann ich mich nicht erinnern, dass wir als Kinder bei diesem Spiel uns mit dem ins gesellschaftliche Abseits gedrängten, von Alkohol gezeichneten Menschen identifiziert haben, wie man es später als Realität vorgeführt bekam oder einem blutrünstigen Skalpell-jagenden Wilden nacheifern wollten. Das Gegenteil war der Fall: Es war immer der mutige, edle Kämpfer, der um seine Jagdgründe stritt. Natürlich ist auch dies nicht frei von Klischees und könnte somit durch das Raster politischer Korrektheit fallen, aber es auf eine Stufe mit Blackfacing zu stellen, halte ich für falsch.
Und trotzdem – ich begrüße diese Auseinandersetzung! Sie gibt die Möglichkeit, genau über die angesprochenen Unterschiede zu streiten. So abstrus manches auf den ersten Blick auch erscheinen mag, es schärft den Blick auf das jeweils Andere. Erst durch die Auseinandersetzung wird dies möglich. Das verlangt allerdings manchmal Mut.
Im Zusammenhang mit den vielen, die derzeit die Diskussionen im Umgang mit dem kolonialen Erbe führen beziehungsweise sich in Initiativen zusammenschließen, um auf den zum Teil skandalösen Umgang mit diesem aufmerksam zu machen, stellen sich Forderungen viel berechtigter dar, als sie auf den ersten Blick erscheinen mögen. Und was wäre trefflicher in Bezug auf politisches Engagement zu sagen, es trüge zur allgemeinen Verunsicherung bei! So muss es auch dem Altpräsidenten Joachim Gauck ergangen sein, als er sich gemüßigt sah, sich publizistisch mit dem Thema auseinanderzusetzen (s. DIE ZEIT v. 31.3.2021; S. 55 f.). Man muss seine Meinung nicht teilen, aber im Gegensatz zu in der Decolonize-Bewegung vertretenen Positionen dient es der eigenen Positionsfindung.
Abstrus?
So stark mich manches aus der Decolonize-Bewegung Stammende berührt und zum Umdenken bewegt, so unverständlich ist mir manches zugleich. Mir will beispielsweise nicht in den Kopf, warum ich eine/n Mitbürger_in mit schwarzer Hautfarbe nicht fragen soll, woher sie oder ihre Vorfahren stammen? Wieso werden mir rassistische Motive unterstellt und nicht einfach Interesse an der Person? Sollte ich nämlich durch die Frage an eine schwarze Person nach ihrer Herkunft eine Art Minderwertigkeitsgefühl wecken, weil Afrika als Kontinent als unterentwickelt, arm und kulturlos gesehen wird, so wünschte ich mir, dass mein Gegenüber gerade dies zum Anlass nimmt, um selbstbewusst dagegen zu halten, dass es sich doch herumgesprochen habe, dass Afrikas Kulturen viel älter sind als die europäischen und darüber hinaus diese strukturell an einer Gemeinschaft orientierten Kulturen weitaus humanere Züge trügen als das, was sich in den blutigen Klassenkämpfen der sogenannten entwickelten Gesellschaften abgespielt hat.
Die Psycholog_innen sprechen von einer "paradoxen Intervention", wenn beispielsweise zunächst negativ konnotierte Begriffe offensiv von Betroffenen benutzt werden, um genau die Deutung in sein Gegenteil zu verkehren. Die Schwulenbewegung hat es uns vorgemacht. Aber auch die Parole "Black is Beautiful" verfolgte denselben Zweck. Mit ihr gelang es, mehr schwarzes Selbstbewusstsein zu schaffen. Warum sollte dies nicht mit der Herkunft passieren, wenn jemand stolz auf den Umstand verweist, dass er/sie oder seine/ihre Vorfahren aus Afrika stammen? Im Übrigen gehe ich davon aus, dass jemand, der oder die auf seine Herkunft angesprochen wird, sehr gut unterscheiden kann zwischen einem: "Ey, wo kommst denn überhaupt her?" und einer Frage, die zeigt – ganz unabhängig vom Äußeren des Gegenübers –, dass der oder die Fragende_r an seinem/ihrer Gesprächspartner_in interessiert ist. Mit anderen Worten: ich kann den Charakter einer solchen Frage nur kontextgebunden beurteilen.
Trotzdem: Ich sehe ein, dass es schräg ist oder gar anmaßend klingen mag, wenn eine derartige Empfehlung von einem weißen und noch dazu alten Mann ausgesprochen wird. Dem Gefühl, bevormundet zu werden, von jenen, die ohnehin in der Gesellschaft das Sagen haben oder sowas wie die Meinungshoheit für sich beanspruchen, ist Rechnung zu tragen. Das bedeutet, dass derlei Vorschläge, wie man mit Diskriminierung umzugehen habe, wenn sie von den Betroffenen selbst initiiert werden, mit umso mehr Sensibilität belegen sollte.
Noch verunsichernder oder in diesem Fall besser irritierender als das Verbot der Frage nach der Herkunft empfinde ich den bereits oben angesprochenen Zusammenhang, ob es einer weißen Frau verwehrt werden sollte, einen Text einer schwarzen Frau zu übersetzen. Das Ganze wird noch getoppt von dem absurd anmutenden Vorwurf der kulturellen Aneignung, wenn beispielsweise einem weißen Musiker oder einer weißen Musikerin das Recht abgesprochen wird, schwarze Musik spielen zu dürfen. Rolling Stones adé?! Bereits das Tragen von Dreadlocks fällt unter dieses Verdikt.
Frevelhaft? 
Foto: © Sreejithk2000, Wikipedia, (CC BY-SA 3.0)
Aber um diese Art identitätspolitischer Forderung nicht auf die schwarze Emanzipationsbewegung zu beschränken, seien an dieser Stelle die für mich ebenso abstrusen Vorstellungen gleicher Provenienz aus der LSBT-Bewegung genannt: Danach dürfen – so wurde es auf jeden Fall kolportiert – schwule oder lesbische Menschen keine heterosexuellen Rollen im Theater oder Film übernehmen.
Man schlägt den Sack und meint den Esel
Dies hat dieser Tage viele herausgefordert, gipfelt diese Forderung doch darin, dass doch letztendlich nur jede unterscheidbare Gruppe das Recht hat, für ihre Emanzipation zu kämpfen. Vielleicht nur Ausnahmen oder Auswüchse im Rahmen einer engagierten Auseinandersetzung? In Hinblick auf den Protest gegen die Bewegung der Linksidentitären aus dem universitären Milieu sollte man auf jeden Fall unterscheiden, zwischen jenen, denen es um die Sache geht – nämlich um den Schutz der Meinungsvielfalt – und denen, die diese Diskussion zum Anlass nehmen, die gesamte identitätspolitische Debatte, gendergerechte Sprache eingeschlossen, zu diskreditieren. Man schlägt den Sack und meint den Esel. Der taz-Autor Kaveh Yazdani fragt zu Recht zum Thema Identitätspolitik und Cancel Culture nach empirischen Belegen (Kritische Verweigerung v. 21.3.2021). Bisher Fehlanzeige! Insofern sollte man deutlich unterscheiden zwischen einer linken Kritik, wie sie die US-amerikanische Soziologin Nancy Frazer oder ihre französische Kollegin Caroline Fourest, die das ganz besonders auch in ihrem jüngst auch auf Deutsch erschienenen Buch 'Generation Beleidigt' beschreibt oder jenen Rückwärtsgewandten, die die Gelegenheit nutzen, um alles, was sich um Emanzipationsbewegungen rankt, zu diskreditieren. Wenn beispielsweise Fourest beschreibt, wie sie und ihre Mitstreiter_innen von Islamistinnen im Verein mit sich links verstehenden Aktivistinnen im Zusammenhang mit einer Diskussion um das Kopftuch regelmäßig am Reden gehindert wird, ist es höchste Zeit, Partei zu ergreifen.
Rebellion ist gerechtfertigt! Dieses einmal von Mao Tse Tung ausgegebene Motto hat meines Erachtens immer noch seine Berechtigung, wenn verkrustete Strukturen, die der allgemeinen Emanzipation des Menschen zuwiderlaufen, aufgebrochen gehören. Niemals aber um den Preis, Andersdenkende mundtot zu machen!
Es rettet uns kein höh'res Wesen
So falsch ich vieles, was mit dem Vorwurf der kulturellen Aneignung eingefordert wird, finde, so interessant ist es doch zu versuchen, diese Position zu begreifen. Wie heißt es in der Internationalen? Es rettet uns kein höh'res Wesen/kein Gott, kein Kaiser noch Tribun/Uns aus dem Elend zu erlösen/können wir nur selber tun!
Auch wenn dies zunächst nur kollektiv gedacht war, so gilt dies letztlich natürlich auch für den Einzelnen. Und wir wissen, was selbsternannte oder auch gewählte Führer_innen in der Weltgeschichte schon alles verbrochen haben, um im Namen und vermeintlichen Interesse der Unterdrückten deren Lebenssituation verbessern zu wollen. Insofern ist aus einem historischen Blick heraus allemal Skepsis angebracht. Und selbst wir als aktive Gewerkschafter_innen sehen uns nicht selten in dem Zwiespalt und dem Vorwurf ausgesetzt, ob das, was wir da in Gang bringen, um die Arbeits- und Lebenssituation zu verbessern, nicht eine Art Stellvertreter_innenpolitik ist, die langfristig nicht dazu taugt, die eigentlich Abgehängten zu emanzipieren.
Vor diesem Hintergrund kann ich nachvollziehen, was zurzeit bestimmte Minderheiten mit Vehemenz einfordern: Nämlich als Betroffene gehört zu werden. Dass sie gleichzeitig mit Skepsis, ja mit Ablehnung reagieren, wenn sich andere ihrer Interessen bemächtigen, ist deshalb nachvollziehbar. Gerade auch, weil wir dies aus vielerlei Zusammenhängen kennen, dass Widerständiges nach kurzer Zeit von interessierter Seite für ganz andere Zwecke instrumentalisiert wird. Besonders anschaulich war dies ja zu verfolgen, wie die Modebranche sich der Punk-Kultur bemächtigte. Substanzieller gilt dies natürlich für die Kultur der Afro-Amerikaner. Mit der formalen Aufhebung der Jahrhunderte lang währenden Sklaverei war das Martyrium und ist die Benachteiligung der Schwarzen bis heute ja keineswegs überwunden. Vor diesem Hintergrund kann man verstehen, dass man sich gegen Vereinnahmung zur Wehr setzt. Auch so kann man manches Befremdliche, was einem unter dem Begriff Cancel Culture begegnet, versuchen einzuordnen.
Maggi alive
Trotzdem halte ich diesen Standpunkt, nur Betroffene dürfen sich wehren, nicht nur für falsch, sondern auch in eine Sackgasse führend. Von Margaret Thatcher stammt der Satz: "Gesellschaft gibt es nicht. Es gibt nur einzelne Männer und Frauen und es gibt Familien." Linke Identitäre müssen sich fragen lassen, ob sie in die Nähe jener Dame gerückt werden wollen!
Damit aber – auch das zeigt die Geschichte – hat er oder sie nur wenig Chance auf Erfolg. Es sei denn, man bemisst – wie Maggi - Erfolg nur am Eigenheim, das man am Ende seines Lebens zu seinen Besitztümern zählen darf. Wem also noch nicht ganz die Flausen seiner Jugend abhandengekommen sind, dass es ein Leben in einer Gesellschaft geben kann, in der der oder die Einzelne nicht zwingend auf Kosten eines/r anderen seinen Vorteil sucht, sondern er oder sie sein oder ihr Handeln an einer sozialen Utopie ausrichtet, die sich daran misst, ob ein gleichberechtigtes Miteinander jenseits von Ausgrenzung und Diskriminierung möglich ist, sollte sich nicht das Recht absprechen lassen, sich für jene Gleichstellung einsetzen zu dürfen, die auf eine humanere Gesellschaft zielt. Was soll schließlich das ganze Gerede über Empathie, wenn es aus Sicht der besagten Protagonist_innen der links-identitären Bewegung nicht allen gleichermaßen zugebilligt wird, auch aus Mitgefühl heraus, für eine bessere Welt zu kämpfen? Auf jeden Fall kann es nicht sein, dass jemand, der seine Lebensaufgabe darin sieht, an der Verwirklichung einer solchen Gemeinschaft mitzuwirken, von Menschen ausgegrenzt wird, die meinen, allein der Kampf um Durchsetzung von Partikularinteressen durch die jeweils Betroffenen reichten aus, um eine gerechtere Welt zu schaffen.
Der Artikel erschien zuerst in der hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 3-4/2021










4 Kommentare
Kommentare
A.S. am Permanenter Link
Das Abstoßende ist ja weniger das Thema als die Tonlage der Debatte.
Ich vertrete die Ansicht, dass jedes Regime seinen wahren Charakter im Umgang mit seinen Kritikern, Aussteigern und Gegnern entlarvt. Nacht diesem Kriterium bewerte ich die Protagonisten der Identitäts-Debatte und Cancel-Culture und komme zu keinem guten Urteil über selbige.
David Z am Permanenter Link
"Trotzdem halte ich diesen Standpunkt, nur Betroffene dürfen sich wehren, nicht nur für falsch, sondern auch in eine Sackgasse führend"
Wohl wahr. Allerdings ist er nicht nur falsch, er ist selbst rassistisch.
H. Lambert am Permanenter Link
Und darüberhinaus die Bewegung schwächend, weil alle bisherigen aufklärerischen Verbesserungen, u.a.
Constantin Huber am Permanenter Link
Die verschwindend kleine Gruppe von Feminist:innen hervorzuheben, die uns männlichen Feminist*innen diesen Status aberkennen möchte, finde ich ziemlich daneben.
Mit dieser Vorgehensweise könnte auch gegen die Menschenrechte argumentiert werden, weil 0,X % diese fragwürdig interpretieren.
Auch, dass es Diskussionen über Diskriminierungen von BIPoC auf dem Arbeitsmarkt gibt, ist im Prinzip eher begrüßenswert denn verwerflich. Diese wurden durch das angesproche Gedicht definitiv angeregt.
Als ausschließlich weiß geführte Organisation (sofern die Bilder auf der Webseite des Landesvorstands aktuell sind) fällt es auch deutlich leichter, sich an rassistischen Begriffe wie dem N-Wort nicht zu stören. Viele BIPoC wollen mit solchen diskriminierenden Begriffen allerdings nicht überall und stets konfrontiert werden. Weder im Alltag, noch beim Konsum von Kunst und Kultur. Zumal einige allein die Tatsache, durch solche Begriffe vor jüngeren Generationen in Erklärungsnot zu geraten, berechtigterweise bereits als befremdlich empfinden. Auch außerhalb von Kinderbüchern haben rassistische Begriffe also einen (nicht gewünschten) Einfluss auf das Leben von BIPoC. Sinnvoller erscheint es daher, solche Begriffe zu entfernen und, wo Bedarf besteht, mit einer Infobox zu erklären. Für Museen über Rassismus und Krieg könnten da ja Ausnahmen gemacht werden, denn dort ist jedem klar, womit man konfrontiert wird und kann selbst entscheiden, ob man sich dem aussetzen möchte oder nicht.
"Mir will bspw. nicht in den Kopf, warum ich eine/n Mitbürger_in mit schwarzer Hautfarbe nicht fragen soll, woher sie oder ihre Vorfahren stammen?"
Weil sie damit auf ihre Herkunft reduziert wird und die Frage impliziert, dass das für irgendeine Eigenschaft relevant sei. Wenn eine BIPoC auf die Frage, wo man denn herkomme, mit "Dortmund" antwortet, verstehen einige unsensible Menschen nicht, dass das ggf. zutreffend und eine völlig ausreichende Antwort ist. Weiter nachtzubohren, auch dann, wenn darüber nicht gesprochen werden möchte, kann als sehr unangenehm empfunden werden. Und bei weißen Menschen würde so auch nicht vorgegangen werden. Bei der Antwort eines weißen Menschen: "aus Saarbrücken" würde ja niemand penetrant nachfragen: "ja, aber ich meine wo deine Eltern herkommen, du weißt schon, wegen deiner großen Nase oder deinen kleinen Ohren. Ist das nicht für Menschen aus XY typisch?"
Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe systematisch anders zu behandeln, nennt sich Rassismus. Insofern finde ich das Unverständnis, warum solche Vorwürfe gemacht werden, recht befremdlich.
Ebenso wie der darauf folgende Abschnitt, welcher BIPoC vorschreibt, wie sie sich zu verhalten haben: "so wünschte ich mir, dass mein Gegenüber gerade dies zum Anlass nimmt, um [...]".
Ich bin eine weiße Kartoffel - aber ganz ehrlich, ich kann jeden BIPoC verstehen, dem beim Lesen dieser Zeilen schlecht wird.
"Das bedeutet, dass derlei Vorschläge, wie man mit Diskriminierung umzugehen habe, wenn sie von den Betroffenen selbst initiiert werden, mit umso mehr Sensibilität belegen sollte."
Genau das ist dem Autor nicht gelungen.
"Niemals aber um den Preis, anders Denkende mundtot zu machen!"
Verschwörungsmystiker:innen und Menschen, die nachweislich & wiederholt öffentlich Fake News verbreiten, können durchaus gecancelt werden.
Manchmal ist das sogar sehr sinnvoll und angebracht.
https://www.volksverpetzer.de/analyse/kenfm-trump-cancel-culture/
"[...] Stellvertreter_innenpolitik ist, die langfristig nicht dazu taugt, die eigentlich Abgehängten zu emanzipieren."
Auch weil Gewerkschaftspolitik Identitätspolitik ist, ist es so wichtig, diese nicht pauschal zu verteufeln, sondern angemessen zu differenzieren.
Wobei wir aufpassen müssen, dass die Zuschreibung "das ist doch Identitätspolitik!" nicht zum neuen "ihr seid doch 'Gutmenschen'" wird.