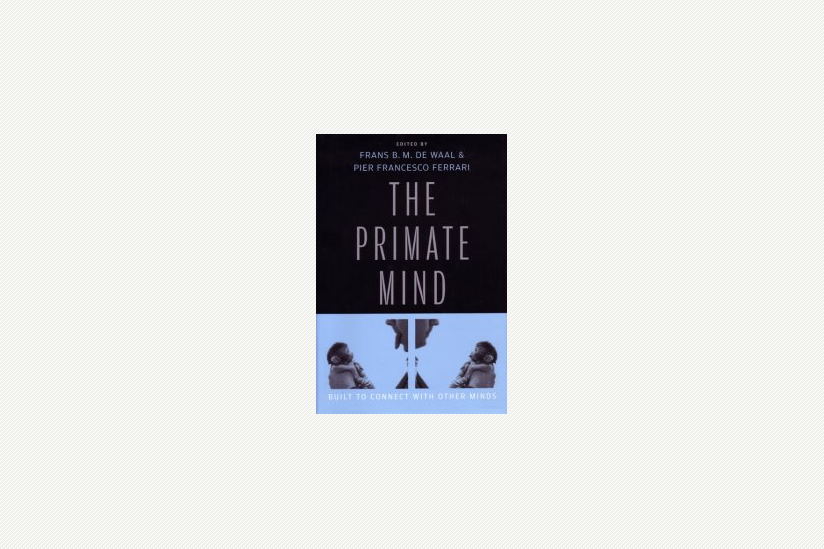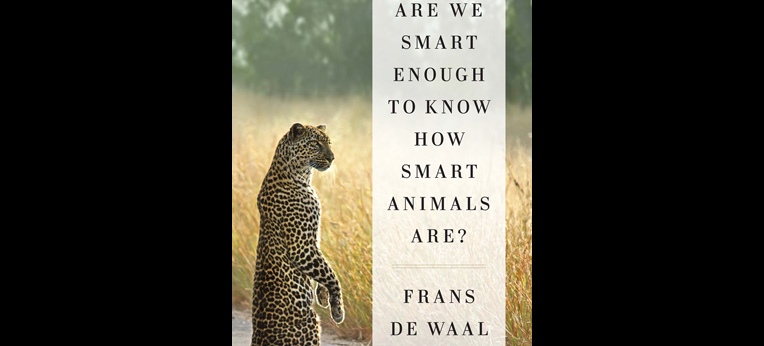BERLIN. (hpd) Es ist fast wie zu Darwins Zeiten. Ein tiefer Graben zieht sich zwischen den Parteien der Wissenschaftler, die sich der Verhaltensforschung der Primaten widmen. Die einen Forscher warten mit dem auf, was den Menschen vom Tier trennt. Die anderen fragen, was Menschen und Primaten, ja sogar Hunde oder Vögel mit ihm gemeinsam haben.
Eine Buchneuerscheinung liefert dazu verblüffende Ergebnisse.
Protagonist der konservativen Forschungsrichtung, welcher die Einzigartigkeit des Menschen betont, ist seit ein paar Jahren der in Leipzig am Wolfgang Köhler Forschungszentrum arbeitende Michael Tomasello, sein Kontrahent, der mit seiner These vom „guten Affen“ schon seit fünfzehn Jahren zu einiger Berühmtheit gelangte, Frans de Waal. Der sammelte seine Kohorten auf einer Tagung in Erice 2009, woraus ein in diesem Jahr erschienener Essayband, veröffentlicht von der Harvard University Press, entstand. Das Neue daran: De Waal untermauert seine alte These – der Empathie schon im Tierreich – in „The Primate Mind. Built to Connect with Other Minds“ mit der Neurobiologie. Damit kommen seine Kernbegriffe, die Empathie und die im Kopf vollzogene Imitation, raus aus der Ecke der theoretischen Begriffe und werden messbar.
Vor 20 Jahren sprachen Wissenschaftler zum ersten Mal von Spiegelneuronen. Italienische Forscher um Giacomo Rizolatti maßen eine erhöhte Tätigkeit von Neuronen in einem bestimmten vorderen Hirnbereich sowohl stets dann, wenn Makaken eine Handlung ausführten, als auch immer dann, wenn sie die Ausführung einer Handlung beobachteten. Die Versuchstiere fühlen sich also ein in das, was der von ihnen beobachtete Artgenosse – oder im Versuchsfall ein Mensch – tut. Sie empfinden die Bewegung ihres Gegenübers nach. Und in ihrem Gehirn läuft offenbar ein Als-ob-Tun ab. Vor sechs Jahren beobachtete Pier Francesco Ferrari, wie daraus Lernen entsteht. Forscher streckten einem nur wenige Wochen alten Makakenbaby, das sie so hielten, dass es ihnen ins Gesicht sehen konnte, die Zunge heraus – und der Winzling reagierte, indem er dem Forscher ebenfalls die kleine Zunge entgegenstreckte. Er probierte aus, wie sich das anfühlt, was er sah.

The Primate Mind - Cover - Ausschnitt - Foto Ferrari, Visalberghi
Imitation und Empathie hängen eng miteinander zusammen. Nachzuweisen wie, das heißt auch zu untersuchen, auf wie vielfältige Weise dies geschieht, und das ist Frans de Waals Anliegen. Nachahmung und Einfühlung sind schon im Tierreich vorhanden, umso ausgeprägter, je verwandter die Tiere mit uns sind. Schimpansen, aber selbst Keas, eine bodennah lebende Papageienart in Neuseeland, kopieren jedoch nicht nur eine bereits beobachtete Handlung. Sie sind offenbar in der Lage, das Ziel einer Unternehmung zu erkennen und, ihren eigenen Bedingungen entsprechend, zu variieren, untersuchte der Wiener Wissenschaftler Ludwig Huber. Ein Schimpanse klickt etwa einen Lichtschalter nicht mit der Stirn an, wie es ihm ein Mensch vormacht, um zu Futter zu kommen, sondern mit den Händen. Jedenfalls dann, wenn er sieht, dass der Mensch in beiden Händen einen Gegenstand trägt, also keine Hand frei hat. Ein Kea beobachtete einen anderen durch ein Loch im Nachbarkäfig dabei, mit einem Schnabel Futter aus einer Höhle zu holen, benutzte dazu aber seine Krallen.
Das Kuriose ist: Je lernfähiger die Tiere sind, um so eher tendieren sie prinzipiell dazu, eine Handlung exakt zu wiederholen, also gerade ihre Anpassungsfähigkeit an die Situation auszuschalten. Das scheint sich in der Evolution bei komplizierteren Handlungsabläufen als effektiver erwiesen zu haben.
Aber Affen lernen nicht nur, indem sie nachahmen, vielmehr offenbar auch dadurch, dass sie das Ergebnis einer Handlung ihrer Artgenossen der Gruppe untersuchen. Kapuzineräffchen lernen, weiß man aus Freilandbeobachtungen in Costa Rica, wie man aus Bambus Maden extrahiert, indem sie untersuchen, welche Bambussprossen etwa ihre Mutter auf der Nahrnungssuche geöffnet hat, welche Farbe die erfolgversprechenden Stengel haben, welchen Geruch sie haben, etc.
In der Tat, Primatenmütter führen nicht die Pfoten ihrer Sprösslinge, um sie etwa beim Nüsseknacken zu unterweisen, sie belohnen und strafen nicht, aber sie machen vor, wie man Nüsse mit einem Stein aufschlägt. Und junge Gorillas lernen offenbar zunächst, indem sie die Steine untersuchen, bevor sie das Aufschlagen der Nüsse beobachten. Und sie werden dadurch motiviert, dass sie jahrelang von der kräftefordernden Nahrungsbeschaffungsaktion der Mütter etwas abbekommen und so erfahren, dass das, was die Mutter macht, eine lohnende Tätigkeit ist.
Aber Schimpansen können nicht zeigen, darauf beharrt Tomasello immer wieder. Nie sah man in einer wildlebenden Schimpansengruppe, Mitglieder mit der Hand einander auf eine Nahrungsquelle hinweisen oder auf eine Rivalengruppe in den Grenzen des Reviers. Doch sie verweisen durch Körperrichtung und Blicke auf einen Gegenstand von Interesse oder Gefahr. Sie lassen die Blicke zwischen dem Gegenstand und dem Kommunikationspartner hin und hergehen.
 Schimpansen können gezielt kommunizieren
Schimpansen können gezielt kommunizieren
Vor zwölf Jahren erbrachte der amerikanische Wissenschaftler Charles Menzel in Guinea-Bissao mit der Schimpansendame Panzee, die auf einer Computertastatur 120 Symbole lernte, den Beweis, dass zumindest diese Schimpansin ihren Pfleger mittels der Computersymbole auf die genaue Position versteckter Apfelsinenbeutel außerhalb des Käfigs hinweisen konnte. Sie dirigierte ihn sogar um Hindernisse herum. Dazu wäre sie nicht in der Lage, wenn das Gehirn nicht dazu ausgestattet wäre, differenzierte Signale über Richtungen zu verstehen und zu kommunizieren, auch wenn wir Menschen bis jetzt noch nicht genau erfassen, wie das geschieht, argumentieren die Amerikaner Charles Menzel und Emil Menzel in einem Essay des Buches.
Oft fotografierte Frans de Waal im Zoo von San Diego Schimpansen, die einen in einer Rivalität unterlegenen Artgenossen trösten, indem sie den Arm um ihn legen. Oder Schimpansenmütter, die einem Sprössling, der sich zu hoch hinaufwagte ins Geäst und den Weg nicht mehr hinunter fand, die helfende Hand reichten, um ihn sicher wieder hinabsteigen zu lassen. Filippo Aureli maß schließlich den stressanzeigenden Cortisolgehalt im Kot von Schimpansen bei Auseinandersetzungen um die Rangordnung und nach entsprechenden darauf folgenden Streichel- und Tröstungssessions. Der Cortisolspiegel stieg nicht nur bei den Affen, die eine Aggression erfuhren, sondern auch bei denen, die sie beobachteten, und er sank nicht nur bei den getrösteten, auch bei den tröstenden.
Wollen die Tröster und Helfer etwa nur sich selber wohler fühlen, wenn sie helfen, ist also, was als Altruismus erscheint, eigentlich Egoismus? – Man weiß es nicht. Aber man weiß, dass Schimpansen Futter teilen, ehe sie die Erfahrung machen, von dem Profiteur später selbst zu profitieren. Sie erfassen, dass der andere auch etwas fressen will, und fühlen sich einfach besser damit, zu teilen, unabhängig davon, ob der Beschenkte um Futter bettelt oder nicht. Solch altruistisches Verhalten scheint also schon lange vor dem Menschen im Laufe der Evolution aufgetaucht zu sein.
Schimpansenbabys können sich an der Mutter festhalten und Mütter ihre Kinder umarmen, weil sie nicht zwei Hände und zwei Füße haben, sondern weil sie vier Hände haben. So die überraschende These schließlich von Tetsuro Matsuzawa. Weil Menschenmütter das nicht mehr können, seit der Australopithecus aufrecht auf zwei Beinen steht, müssen sie ihre Kinder gelegentlich für längere Zeit ablegen und tragen sie nicht ständig, wie Schimpansenmütter, fünf Jahre lang mit sich herum. Sie halten den emotionalen Kontakt miteinander, indem sie sich ins Gesicht sehen, und sie entwickelten deshalb die menschliche Sprache, um miteinander zu kommunizieren. Weil sie nicht mehr über vier Hände verfügen!
Einfühlung und in der Vorstellung vollzogene Nachahmung sind nicht nur die Motoren der höchsten Kunstform, wie einst Aristoteles bei seiner Abhandlung über das Theater nachwies, sie sind die Voraussetzung für das Zusammenleben und Lernen in Gruppen schon im Tierreich mit zahlreichen überraschenden Aspekten bei unseren nächsten Verwandten, den Affen. Darüber nachzudenken, dazu bietet der Essayband von Frans de Waal und Pier Franscenso Ferrari zahlreiche Anregungen auch für Nichtbiologen.
Die alte Frage, ob Tiere ein Selbstbewusstsein haben, ist damit freilich nicht beantwortet, nur wissen wir, dass auch diese mit der Fähigkeit der Einfühlung einhergeht. Schimpansen ab einem gewissen Alter, ja selbst Elefanten, können sich im Spiegel wiedererkennen, langen mit Händen oder Rüssel nach einem Farbfleck am Kopf. Sie erfassen, so Frans de Waal, dass das Spiegelbild gegenüber, sie selbst spiegelt. Offenbar hängt nun die Fähigkeit, sich selbst auszumachen, zusammen mit der, das Empfinden anderer nachzuvollziehen. So viel können wir vermuten.
Simone Guski
Frans B. M. de Waal & Pier Francesco Ferrari: „The Primate Mind. Built to Connect with Other Minds”. Harvard University Press, Cambridge Massachusetts 2012, 392 S, 45 Euro