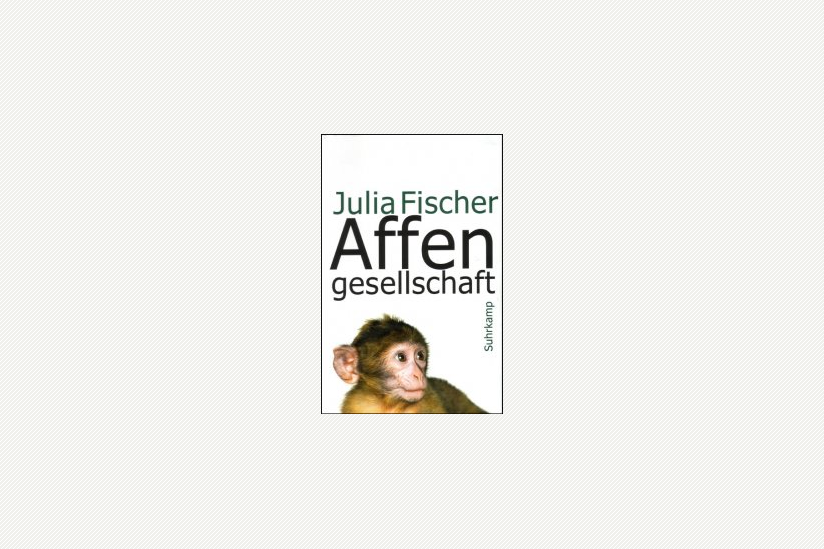BERLIN. (hpd) Derzeit interessieren die Primatenforscher sich besonders für Paviane und deren nächste Verwandte, denn Paviane leben, wie einst die ersten Hominiden und anders als die Menschenaffen, in Savannen. Daher dürften ihr Sozial- und Kommunikationsverhalten und ihre kognitiven Fähigkeiten einigen Aufschluss geben über die Entwicklung des Menschen.
Anderthalb Jahre lebte Julia Fischer, jetzt Leiterin des Deutschen Primatenzentrums, in Botswana im Busch und beobachtete dort wildlebende Pavianhorden.
Ging man früher davon aus, dass das Leben in einer Affenhorde vor allem aus einem komplizierten Schmieden von Ränken und Allianzen im Kampf um Rangordnung und damit den Zugang zu Ressourcen und Nachwuchschancen bestand, richtet sich heute der Forscherblick eher auf die vielfältigen Formen von Kooperationen. Dabei kamen die Wissenschaftler zu überraschenden Beobachtungen.
Affen sind geschickte Netzwerker. Denn beständige Kommunikation erhöht, stellte Julia Fischer im Busch an den Guineapavianen fest, ihre Chancen, an Futter und Weibchen heranzukommen. Fast ebenso wichtig, wie verwandtschaftliche Beziehungen, sind Beziehungen zu anderen Mitgliedern der Gruppe. Dazu entwickeln die Primaten Verhaltensweisen, die denen moderner Väter recht ähnlich sind. Halbwildlebende ranghohe Berberaffenmännchen in einem großen Freigehege im französischen Rocanamour sichern sich umso mehr Aufmerksamkeit und Sozialkontakt und damit potentiellen Beistand, je öfter sie ihren Nachwuchs fürsorglich durch die Gegend tragen. Die Weibchen überlassen ihnen die Sprösslinge gerne, denn sie können sich so mehr der Nahrungsaufnahme widmen und sich damit gute Voraussetzungen für weiteren Nachwuchs schaffen.
Dabei nehmen es unter manchen Affenarten die Männchen bei der Sorge um die Kleinen nicht einmal so genau, ob es sich tatsächlich um den eigenen Nachwuchs handelt. Wo reichlich Futter vorhanden ist, etwa bei den indischen Languren, bilden mehrere Männchen mit mehreren Weibchen einen lockeren Familienverband, weshalb die Vaterschaftsfrage nicht mehr eindeutig zu entscheiden ist. Bei knappen Nahrungsressourcen setzen diese Primaten freilich mehr auf stabile Paarbeziehungen, die es dann eher ermöglichen, den Nachwuchs und die eigenen Gene durchzubringen.
Einen guten Teil ihres Lebens sind Affen damit beschäftigt, zu beobachten, was andere Affen tun. Und sie haben eine genaue Kartografie im Kopf, welchen sozialen Status die anderen Affen gerade einnehmen. Das ermöglicht ihnen nicht nur, an Futter heranzukommen, sondern auch Hilfe zu holen, wenn nötig. Unter Umständen auch, sich Futter zu stibizen, indem sie durch einen geschickt inszenierten Streit ihre Konkurrenten von einer Futterquelle ablenken. Höherrangige Affen unterstützen sich gegenseitig gegen Emporkömmlinge. Das lohnt sich allerdings nur, wenn es um hochwertige Nahrungsquellen geht. In solch instabilen Situationen, wenn der Aufstand droht, zeigen die höherrangigen Affen größere Stressreaktionen, in stabilen immer die rangniedrigeren. Gibt es überall gleich verteilt relativ geringwertige Nahrung, verhalten sich auch die Paviane ziemlich egalitär. Wer wird auch hier nicht an menschliche Gesellschaften denken?
All dies erzählt Julia Fischer in ihrem neu erschienenen Buch „Affengesellschaft“. Darin weiß sie auch von regelrechten Abstimmungen zu berichten, wenn sich Paviane im Savannenland am Morgen entscheiden, in welche Richtung am jeweiligen Tag die Nahrungssuche aufgenommen werden soll. In solch einem Affenparlament wird durch die Einnahme bestimmter Blickrichtungen oder durch buchstäbliches Querstellen und Grunzlaute bei noch nicht erreichtem Konsens solange kommuniziert, bis schließlich die ganze Gruppe in eine Richtung loszieht.
Im Experiment in Deutschland erwies sich, dass Affen, wiederum nicht anders als Menschen, viel leichter erfassen, was andere Affen wohl wissen, als was sie wohl tun werden. Gelernt und kommuniziert wird vor allem Erfahrung. Es entsteht im Kopf der Affen ein Gesamtwissen, es repräsentiert Umwelt und kommunizierte Information über die Welt.
Wozu Kommunikation? Sie vermindert die Unsicherheit, so Julia Fischer. Doch der Sender will etwas erreichen, der Empfänger muss die Richtigkeit der Aussage in Bezug auf die Umwelt und die eigenen Interessen bewerten: ob einem Signal Folge zu leisten ist, bedeutet das in der Affengesellschaft. Dazu werden verschiedene Signale gelernt. Darin kommt es aber auch zu Kopierfehlern. Tradieren sie sich, kann man von regional begrenzten Kulturen sprechen – die dann allerdings wieder ihre eigene Funktion erhalten. Als Erkennungsmerkmal der Gruppe. Unterschiede bei benachbarten Gruppen – regelrechte Dialekte - können bei den Berberaffen, nicht anders übrigens als schon bei den Singvögeln, dabei größer sein als bei entfernt voneinander lebenden.
Zusammenhang zwischen Sozialverhalten, Kommunikation und Intelligenz
Julia Fischer geht in ihrer Forschungsarbeit davon aus, dass es einen Zusammenhang zwischen Sozialverhalten, Kommunikation und Intelligenz gibt. Je komplizierter das Sozialverhalten, umso mehr Intelligenz wird erfordert und entwickelt, so ihre These. Doch was bedeutet Intelligenz, was Bewusstsein? In den sechziger Jahren testete man vor allem die Fähigkeit von Menschenaffen, mit Symbolen umgehen zu können. Die Schimpansin Washoe, die den Umgang mit 132 Symbolen beherrschte, wurde zum Medienstar. Julia Fischer steht dem skeptisch gegenüber. Affen lernen vor allem durch Erfahrung, ist ihre Prämisse. Sie müssen dazu nicht selbst allzu viele Absichten und Einsichten haben. Das erste Wort, das Washoe zu benutzen lernte, war bezeichnenderweise „mehr“! – Eine Forderung.
Allerdings setzt Lernen voraus, zu wissen, was der andere weiß und was er nicht weiß, eine Fähigkeit, die im komplizierten Gruppenalltag der Paviane reichlich geübt wird. Und es verlangt das Wissen über das eigene Nichtwissen. Denn sonst würde kein Affe einem anderen folgen, wenn es darum geht, Futter zu suchen oder Gefahren auszuweichen.
Julia Fischer erdachte sich mit ihrem Team daheim in Göttingen Experimente, wie sie ein routinierter Fernsehquizmaster nicht besser planen könnte: Die tierischen Probanden sollten visuelle Reize unterscheiden. Nach jeder richtig beantworteten Frage konnten sie anhand von sich akkumulierenden Kugeln in einem Glas ablesen, wie viele Rosinen sie sich als Belohnung insgesamt schon verdient hatten. Das setzt, war das erste Ergebnis der Untersuchung, eine gewisse Fähigkeit zu repräsentativem Denken voraus: Kugeln stehen für Rosinen. Außerdem können Affen im Gegensatz zum berühmten zählenden Pferd Hans tatsächlich rudimentär zählen. Und sie hatten die Option, anzugeben, wann sie etwas nicht wissen und das Experiment abbrechen wollten, womit sie sich eine geringere Menge – allerdings weniger begehrten - Trockenfutters sichern konnten. Was sie dann auch tatsächlich taten, wenn ihnen die Testfragen zu schwer wurden. Schon Affen können sich sokratisch weise verhalten. - Und mit weniger vorlieb nehmen.
Simone Guski
Julia Fischer: „Affengesellschaft“, Berlin (Suhrkamp) 2012, 281 Seiten, 36 Abbildungen, 26,95 Euro.