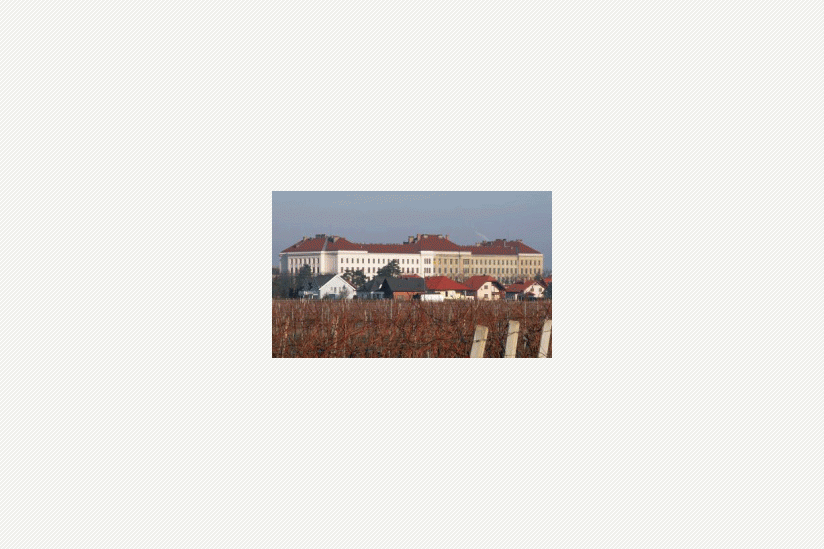TRAISKIRCHEN. (hpd) Die Flüchtlingsbetreuungsstelle bei Wien ist wieder einmal voll. 1.500 Asylwerberinnen und Asylwerber sind hier untergebracht. 1.000 mehr als es laut einer Vereinbarung zwischen Stadtregierung und dem zuständigen Innenministerium sein sollten. Und mehr als es laut allen Rahmenbedingungen sein müssten.
Wer mit der Lokalbahn im Stadtzentrum Traiskirchens ankommt, wird sie am Bahnhof stehen sehen. Meist junge Männer, die versuchen, die Zeit totzuschlagen. Wenige Frauen sind zu sehen. Insgesamt sind an die 1.000 erwachsene Asylwerber im Flüchtlingslager untergebracht. Nicht wenigen wird kalt sein. Sie sind die Temperaturen eines mitteleuropäischen Herbstes nicht gewöhnt. Bis zur „Erstbetreuungsstelle für Asylwerber“, wie das Flüchtlingslager offiziell heißt, die einige Gehminuten vom Bahnhof entfernt liegt, werden sie grüppchenweise vor Call Shops oder kleinen Lokalen stehen. Oder auf Parkbänken sitzen. Ein Eindruck, den man nicht schnell vergisst. Der Autor hat das in seiner Berichterstattung über das Flüchtlingslager oft genug gesehen, um diese Bilder im Kopf zu haben, wenn er hört, das Flüchtlingslager sei wieder einmal voll. Bilder der Armut, der Hoffnungslosigkeit und der Langeweile. Kurz: des Elends. Es gibt schönere Bilder.
Diesmal sind nicht wenige Jugendliche im Stadtzentrum. 550 so genannte unbegleitete Minderjährige sind nach offiziellen Angaben in der Erstaufnahmestelle untergebracht. Ohne Eltern sind sie in den vergangenen Monaten in Österreich gestrandet. Das macht die Situation noch komplizierter: „Für sie muss die Bezirkshauptmannschaft die Vormundschaft übernehmen oder dafür Sorge tragen, dass es jemanden gibt, der die Sorgepflicht für die Jugendlichen übernimmt“, beschreibt es der Traiskirchner Stadtrat Andreas Babler (SPÖ). „Bei der Unterbringung gibt es dann besondere Auflagen. Deswegen will sie niemand.“ Das führt dazu, dass sie länger in Traiskirchen bleiben müssen als vorgesehen. Und in der Luft hängen.
Die Erstaufnahmestelle Traiskirchen ist Österreichs größte Unterbringungsstelle für Flüchtlinge. Seit mehreren Jahren ist es als Durchgangsstation gedacht. Wer irgendwo in Ostösterreich einen Asylantrag stellt, kommt zuerst hierher. Die Stelle wickelt das so genannte Erstverfahren ab. Die Behörden stellen fest, ob der oder die Betreffende nicht in einem anderen Land einen Asylantrag gestellt hat. Das ist das so genannte Dublin-Verfahren, benannt nach dem „Dublin II“-Vertrag der EU. Der erklärt das EU-Land für ein Asylverfahren zuständig, in dem ein Asylwerber zuerst einen Antrag gestellt hat. Oder das EU-Land, in dem der oder die Betroffene zuerst nachweislich einen Asylantrag hätte stellen können. Ein Verfahren, das den südlichen und östlichen EU-Ländern die Last der Flüchtlingsströme aufbürdet. Die reicheren Staaten Mittel- und Westeuropas bleiben, so weit irgend möglich, außen vor. Die Regelung ist mitverantwortlich, dass das Flüchtlingswesen in Griechenland zusammengebrochen ist – noch bevor das Land in den Strudel der Finanzkrise geriet. Mittlerweile dürfen Flüchtlinge nicht mehr dorthin abgeschoben werden. Nicht einmal aus Österreich, dessen Behörden im Allgemeinen wenig zimperlich sind, Menschen abzuschieben.
Das österreichische Recht stattet das Erstverfahren für Asylwerber mit zahlreichen Schikanen aus. Während der ersten Verfahrenstage dürfen Betroffene die Erstaufnahmestelle Traiskirchen nicht verlassen. Und niemand darf später Gründe für Asyl vorbringen, die er oder sie nicht schon im Erstverfahren genannt hat. Das Gesetz nennt das etwas euphemistisch: „Neuerungsverbot.“ Theoretisch sollte das Verfahren innerhalb weniger Wochen abgeschlossen sein. Die Behörden verteilen die Flüchtlinge, die es überstanden haben, von Traiskirchen aus übers ganze Land. In Quartiere, wo sie warten müssen, bis ihr Asylantrag entschieden wurde. Das kann Jahre dauern.
Würde all das so geschehen, wie es die Gesetze vorsehen, in der ehemaligen Kadettenschule wären kaum mehr als 300 oder 400 Asylwerber untergebracht.
Allein, es wäre nicht Österreich, würde sich das Zusammenspiel der Behörden verschiedener Verwaltungsebenen jemals glatt gestalten oder den Gesetzen immer auf Punkt und Beistrich folgen. Theoretisch ist das Innenministerium dafür zuständig, dass Asylverfahren korrekt abgewickelt und Asylwerber währenddessen einigermaßen menschenwürdig untergebracht werden. Das Ministerium, das seit Jahren in christlichsozialer Hand ist, hat einen Teil der Verantwortung auf die Landesregierungen abgewälzt. Die Flüchtlinge werden gemäß einer Quote auf die neun Bundesländer aufgeteilt. Die haben sich darum zu kümmern, dass sie auch untergebracht werden.
Das ist in einer so genannten 15a-Vereinbarung geregelt, einem Vertrag zwischen den Rechtskörperschaften Republik Österreich und Bundesländer. Letztere geben die Verantwortung oft auf ihre Gemeinden ab, die sich um Quartiere für Flüchtlinge umschauen soll. Was die Sache zusätzlich verkompliziert. Nicht einfacher wird das, wenn, wie meistens, der private Sektor ins Spiel kommt. Im Regelfall warten Asylwerber in Landgasthöfen darauf, dass die Behörden ihr Verfahren entscheiden. Vereine oder professionelle Betreuungsstellen sind die Ausnahme.
Das darf einen angesichts der Entschädigungen nicht überraschen. 17 Euro pro Kopf bekommt man pro Tag, wenn man Asylwerber bei sich unterbringt, demnächst sollen es 19 werden. Die erste Inflationsanpassung seit 2004. Das muss Essen, Reinigung und Betriebskosten abdecken. Grundversorgung nennt sich das. Bei diesen Tagsätzen braucht man eine gehörige Portion Altruismus oder Geschäftssinn, um sich darauf einzulassen. Nicht selten sind es abgewirtschaftete Pensionen, die Asylwerber unterbringen wollen. Mit entsprechenden Abschlägen bei der Qualität. Für Menschen, die sich um die Asylwerber kümmern oder gar Dolmetscher, bleibt da kein Geld. Auch Betreuungsvereine sind auf zusätzliche Geldquellen angewiesen, wenn sie den Asylwerbern eine halbwegs sinnvolle Tagesbeschäftigung bieten wollen. Wer, wie Besitzer von Pensionen, mit Asylwerbern Geld verdienen will, verzichtet auf derlei im Regelfall ganz.
In diesem Wirrwarr aus Kompetenzen bleiben aktuell – wieder einmal – die Asylwerber aus Traiskirchen übrig. „Außer Wien und Niederösterreich erfüllt kein Bundesland die Quoten“, erzählt Andreas Babler. Und Niederösterreich erfüllt die Quote auch nur dank Traiskirchen, aber das nur nebenbei. Niemand will Asylwerber haben und das Innenministerium macht keinen Druck, dass die Landesregierung doch bitte schön die Verpflichtungen erfüllen sollen, die sie in einem Vertrag gemäß den Bestimmungen der Bundesverfassung eingegangen sind. Politik am Rücken von Menschen, wie auch Babler beschreibt. Man hört den Zorn in seiner Stimme, wenn er an den Landtagswahlkampf des burgenländischen Landeshauptmanns Hans Niessl denkt. Der hatte offen Stimmung gegen Asylwerber geschürt. Dass Niessl auch Sozialdemokrat ist, mildert Bablers Enttäuschung und vermutlich auch Verbitterung nicht.
„Über Kärnten brauch ich dir gar nichts mehr erzählen“, fügt er im Telefonat mit mir hinzu. Die Landesregierung aus der rechtslastigen Abspaltung der Rechtspartei BZÖ (ihrerseits eine Abspaltung der FPÖ, Anm.) namens FPK und der ÖVP betreibt seit Jahren je nach Bedarf Hetze gegen Asylwerber. Bis vor kurzem wurden dort „straffällige Asylwerber“ in einer abgeschiedenen „Sonderanstalt“ auf der Kärntner Saualm untergebracht. Im Verständnis der Landesregierung waren das auch Asylwerber, gegen die bloße Strafanzeigen vorlagen. Rechtskräftig verurteilt musste man nicht sein. Für Sicherheitsmaßnahmen war genug Geld da. Für eine ordentliche Betreuung offenbar nicht. Das Heim wurde wegen massiver Mängel vor kurzem behördlich geschlossen. Rechtsstaatlich war das Vorgehen nicht in Ordnung. Es verletzte die Menschenrechte der Asylwerber eindeutig. Das störte aber jahrelang nur NGOs und einige Politiker wie Babler. Das Menschenrechtsbewusstsein in Österreich kann man als unterdurchschnittlich beschreiben. Hierzulande gilt es als Erfolg der Humanität, wenn ein Politiker zurücktreten muss, der in einem Wahlkampf den Slogan plakatieren lässt: „Heimatliebe statt Marokkanerdiebe“.
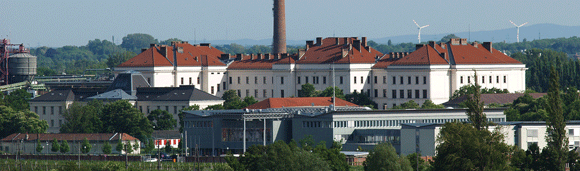
Ehemalige Kadettenanstalt, heutiges Flüchtlingslager Traisdorf / Foto: wikimedia commons
Und das sind die Bedingungen für erwachsene Asylwerber. Für Minderjährige wird es noch komplizierter. Was erklärt, warum jeder sie weiterreichen will wie eine heiße Kartoffel. Aus Sicht der Behörden bedeuten sie Arbeitsaufwand. Aus Sicht der Pensionsbetreiber Auflagen, die ein Mindestmaß an menschenwürdiger Behandlung sicherstellen sollen. Lieber nicht anstreifen. Das hat sich auch eine Bezirkshauptmannschaft aus dem Burgenland gedacht. Vor wenigen Wochen wurden dort fünf Kinder aufgegriffen, die offensichtlich unter den Status Asylwerber fielen. Die Jugendbehörde an der Bezirkshauptmannschaft kümmerte sich umgehend um das Problem. Man suchte nicht groß nach einem Vormund sondern schob die Kinder nach Traiskirchen ab. Verweis der Landesregierung: „Wir betreuen doch schon drei (!) unbegleitete Flüchtlingskinder.“
Babler zeigt sich enttäuscht über die mangelnde Solidarität. Und über die Bundesregierung: „Es sind noch immer die gleichen Bundesländer, die sich nicht an die Vereinbarung halten. Und niemand kümmert sich darum, das durchzusetzen. Dabei könnte man doch Bundesförderungen für Infrastrukturprojekte oder ähnliches davon abhängig machen, ob die Landesregierungen an ihre Verpflichtungen halten.“ Ein hehrer Wunsch in einem Land, in dem Flüchtlingspolitik oft darin zu bestehen scheint, Flüchtlinge nachhause zu schicken. Oder, wenn das nicht geht, nach Möglichkeit so zu tun, als wären sie gar nicht da.
Unter den 550 Minderjährigen ohne Eltern in Traiskirchen ist ein Dutzend Kinder. Die müssten in die Schule gehen und gesondert betreut werden. Allein, das geht in der Erstaufnahmestelle nicht. Die Kinder bleiben ja nicht dauerhaft hier. Theoretisch. Sie sollten längst in Pflegefamilien oder besonderen Betreuungseinrichtungen untergebracht sein. Die Stadt Traiskirchen würde die Kinder vermutlich in den Schulen der Stadt unterbringen können. Allein, ob sie das darf, ist nicht einmal klar. Damit würde sie unter Umständen der Bezirkshauptmannschaft des Verwaltungsbezirks vorgreifen, in dem das Kind laut 15a-Vereinbarung untergebracht werden wird. Eine Situation, die für die Stadtpolitik frustrierend ist. Bei einigen Gemeinderäten dürfte auch die Befürchtung mitschwingen: „Wenn wir die Kinder bei uns unterbringen, wird in Zukunft außerhalb Traiskirchens gar niemand mehr unbegleitete Flüchtlingskinder aufnehmen.“ Und irgendwann wäre die Kapazität der Gemeinde mit 18.000 Einwohnern erschöpft. Eine Schulplanung lässt sich mit zehn oder zwölf Kindern zusätzlich pro Jahr noch machen. Aber wenn’s bald 100 werden?
Das mutet zynischer an als es die Traiskirchner Stadtpolitik verdient hat. Die Gemeinde beherbergt seit 1956 Österreichs größte Unterbringungsstelle für Flüchtlinge. Als die UdSSR den Aufstand in Ungarn niederschlagen ließ, funktionierte die Republik eine Kadettenschule zum Flüchtlingslager um. Das war als vorübergehende Maßnahme gedacht. Das hat sich als ähnlich provisorisch erwiesen wie das deutsche Grundgesetz. In den vergangenen Jahren blieben viele Flüchtlinge dauerhaft in der Gemeinde. Vermutlich gibt es keine Stadt in Österreich mit einem höheren Pro-Kopf-Anteil an (anerkannten) Flüchtlingen wie Traiskirchen. Fremdenfeindlichkeit kann man den Bewohnerinnen und Bewohnern nicht unterstellen. Der Stadtpolitik im Allgemeinen auch nicht. Wiewohl mir einige hässliche Beispiele persönlich bekannt sind. Man muss sich keine Sorgen machen, dass Rostock südlich von Wien wieder passiert.
Aber im Lauf der Jahrzehnte hat sich Gleichgültigkeit breitgemacht. Man ist abgestumpft. Das darf nicht verwundern. Die Zahl der Asylwerber macht es unmöglich, für jeden einzelnen Empathie zu empfinden. Selbst wenn alles klappt, sind drei- bis vierhundert in der Betreuungsstelle untergebracht. Mitten im Stadtzentrum, das etwas mehr als 3.000 Einwohner hat. Dieser Tage kommt ein Asylwerber auf zwei Bewohner des Ortskerns.
Sie dürfen nicht arbeiten. Die Betreuungsstelle ist nicht auf so viele Menschen eingerichtet und es gibt kein ausreichendes Freizeitangebot. Dass es bisher keinen Marsch der Asylwerber gibt wie in Deutschland, überrascht. Hierzulande sind die Bedingungen schikanöser. Mit einer Ausnahme: Wenigstens nachdem sich die Republik Österreich bereit erklärt hat, ein Asylverfahren durchzuführen, dürfen Asylwerber im Land frei reisen. Zumindest bis zur nächsten Novelle des Asylgesetzes. Zuletzt gab es solche Novellen beinahe im Jahrestakt. Regelmäßig werden neue Schikanen erfunden.
Das macht das Verhältnis zwischen Traiskirchnern und Asylwerbern nicht einfacher. Mit einem Menschen, der mehrere Monate hier untergebracht sein wird, kann man eine Beziehung aufbauen. Mit einem Menschen, der morgen schon weg sein kann, nicht. Von dem bleibt nur das Bild des Elends. Das muss man auch einmal aushalten. Dass es im Großen und Ganzen kaum Spannungen gibt, überrascht. Die gibt es, wenn überhaupt, eher zwischen verschiedenen Nationalitäten in der Betreuungsstelle. Und gelegentlich am Bahnhof. Immer wieder kommt es zu Beschwerden, dass Asylwerber Mädchen anquatschen. Würde man den vorwiegend jungen Männern eine sinnvolle Beschäftigung geben, wäre das mit Sicherheit eine wirksame Prävention. Allein, das funktioniert nicht in einer Betreuungsstelle mit 1.500 Asylwerbern, die auf 400 ausgelegt ist.
Bleibt die Frage, ob eine Erstaufnahmestelle dieser Dimension in eine Gemeinde dieser Größe passt. Asylwerber könnten in einer größeren Gemeinde einfacher und mit geringerem Aufwand betreut werden. Im nahe gelegenen Wien würde das nicht groß auffallen. Selbst am Wiener Stadtrand gebe es mit Mödling oder Klosterneuburg urbanere Gegenden. Auch Graz mit einer Viertelmillion Einwohnern liegt eher im Osten Österreichs. Möglichkeiten für eine neue Erstaufnahmestelle mit der Größe Traiskirchens gebe es genug. Oder auch mehrere. Allein, die Erfahrung zeigt, dass sich Landtagswahlen mit dem Versprechen gewinnen lassen, dass kein Erstaufnahmezentrum im Bundesland errichtet wird. Da mag sich die Republik noch so oft dazu bekennen, man gewähre jedem und jeder Schutz, der oder die ihn brauche. Die vergangenen Jahre weisen es als Lippenbekenntnis aus. Abgesehen von der Tatsache, dass das Land international dazu verpflichtet ist, Schutzsuchenden Asyl zu gewähren. Solche Sonntagsreden suggerieren eher, man tue das aus Herzensgüte. Mit der ist es auch nicht sonderlich weit her. Sonst wären keine 1.500 Leute in der Betreuungsstelle Traiskirchen.
Wer sagt „Ja bitte, wir kümmern uns gerne“, riskiert das baldige politische Ableben. Nahezu unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Es gilt das Mikado-Prinzip. Wer sich zuerst rührt, hat verloren. Im Englischen nennt man das „Nimby“-Prinzip: Not in my backyard. Lieber bürdet man die Last denen auf, die sie immer schon getragen haben. Traiskirchen, den Asylwerbern dort und der Bevölkerung. Ob das für die Betreffenden die optimale oder auch nur eine gute Lösung ist – oder überhaupt eine Lösung, kümmert außerhalb der Gemeinde niemanden. Im Zweifelsfall fühlt man sich nicht zuständig. Es geht ja nur um Menschen. Nicht um die eigenen Wähler.
Man fragt sich, wie es so weit kommen konnte. Vor zwanzig Jahren noch haben die Menschen in diesem Land 300.000 Flüchtlinge aus Ex-Jugoslawien aufgenommen. Zumindest vorübergehend. Die meisten sind kurz nach ihrer Ankunft hier weitergezogen. Nach Deutschland, die USA, Kanada. Einige zehntausend sind hier geblieben. Es war nie die Frage, ob wir helfen. Sie waren da, wir waren da. Das passte schon. Nicht einmal eine Generation später fragt man sich, ob die gleichen Leute nicht in den nächsten Flieger nach Sarajevo verfrachtet werden würden, wenn es heute dort losgehen würde. Das Boot ist in den Augen vieler voll. Am allerwenigsten beinahe überraschenderweise in Traiskirchen.
Sicher hat es damit zu tun, dass die Flüchtlinge heute von weiter weg kommen. Die Konflikte sind nicht mehr so greifbar. Das macht es schwerer, Empathie aufzubringen. Und die Konflikte sind komplizierter geworden. Es sind nicht mehr nur offene Bürgerkriege, es sind nicht mehr staatliche Verfolgungen von Minderheiten. Clan A attackiert Clan B und der Staat kann nicht schützen. Oder will nicht. So sieht heute eine typische Flüchtlingsbiografie aus. Und viele suchen nicht unmittelbaren Schutz vor Verfolgung und Diskriminierung. Sie suchen Schutz vor Elend, das wir uns nicht mehr vorstellen können, und oft genug vor einem drohenden Hungertod. „Wirtschaftsflüchtlinge“ nennt man diese Getriebenen abschätzig. Als ob es hier nur um Verdienstmöglichkeiten ginge und nicht etwa um die Folge von Naturkatastrophen wie in der Sahel-Zone.
Man darf auch nicht vergessen, dass der Optimismus in Westeuropa weitgehend verschwunden ist. In den Augen der meisten Menschen geht es nicht mehr aufwärts. Man geht nicht davon aus, dass man sein Leben verbessern kann. Man ist froh, wenn es sich nicht verschlechtert. Wenn man nicht das verliert, was man hat. Das trifft zumindest auf die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu. Man hört ja ständig, der Sozialstaat sei aufgebläht und nicht mehr zu halten. Die Pensionen seien nicht mehr sicher, wir hätten über unsere Verhältnisse gelebt. Und man solle überhaupt froh sein, eine Arbeitsstelle zu haben. Die Mittelschicht, die die soziale Marktwirtschaft geschaffen hat, sieht sich von der Proletarisierung bedroht. Zu Solidarität fühlt sich die Mehrheit nicht mehr bereit.
Beide Entwicklungen machen ausländerfeindliche Parolen attraktiv. Ein Wir-gegen-die-da. Die wirklich Faulen, die wirklichen Betrüger, das sind natürlich nicht die, die seit der neoliberalen Wende der 1980er und 1990er reich geworden sind. Das sind die, die sich am wenigsten wehren können. In Österreich sind das die Asylwerber.
Christoph Baumgarten