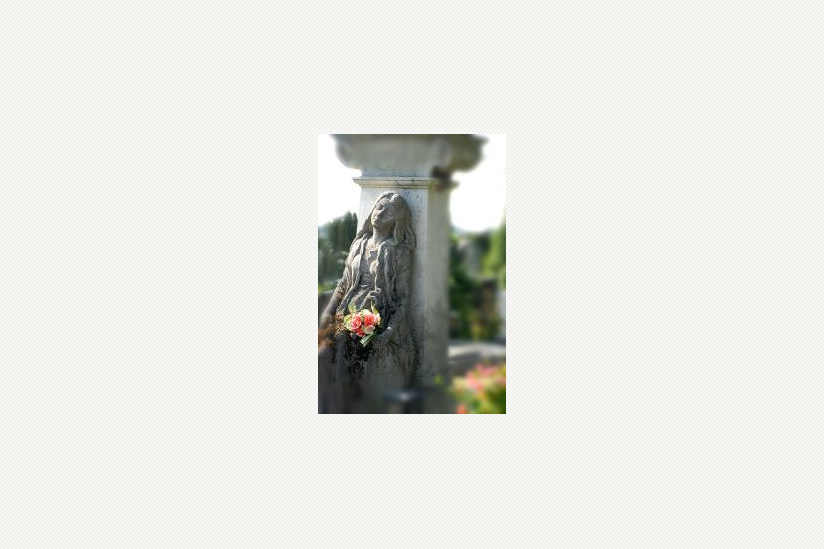WIEN. (fdbö/hpd) Wenn Menschen sterben, kommt fast immer die Religion ins Spiel. Bei Angehörigen in der Trauerbegleitung, für sie und für Freunde und Bekannte beim Begräbnis. Zweifellos helfen Rituale, die Trauer zu verarbeiten. Aber müssen sie religiös sein? Christoph Baumgarten geht dieser Frage in einem sehr persönlichen Text nach.
Liebe M., fühle ich mich versucht, diesen Text zu beginnen. Ihn als Brief zu schreiben an eine Tote. Ein Abschiedsbrief, wie so viele an sie geschrieben wurden. Vorderhand ein Text, der sich an ein Häuflein Asche in einer Urne richtet. Im eigentlichen Sinn ein Brief an sich selbst und an Überlebende. Freunde, Angehörige Ms. Trauerarbeit ist immer egoistisch. Je näher einem der Mensch gestanden ist, desto mehr. Je größer der Schmerz, desto mehr geht es darum, ihm Ausdruck zu verleihen. Die eigene Befindlichkeit ist stärker als die Empathie. Und gleichzeitig muss er öffentlich ausgelebt werden. Nur wenige Menschen sind imstande, den Tod eines oder einer Nahestehenden zu verarbeiten, ohne den eigenen Gefühlen vor anderen Ausdruck zu verleihen und ohne andere zu beobachten, wie sie das gleiche tun. Ein egoistisches Erlebnis, das nur in Gemeinschaft möglich ist. Paradox.
Wie die meisten Menschen hasse ich Begräbnisse. Als Kind war ich des öfteren zugegen, wenn Menschen beerdigt wurden, die ich nicht einmal kannte. Dass mich Wildfremde umarmten und mir Beileid wünschten, hat das nicht verhindert. Zum Begräbnis meines Großvaters ging ich nur, weil das von mir erwartet wurde. Ich hatte nie eine enge Beziehung zu ihm. Dort zu sein, Abschied zu nehmen, war mir kein inneres Bedürfnis. Innerlich verabschiedet hatte ich mich lange davor. Es war ein laizistisches Begräbnis. Mein Großvater war vor Jahrzehnten aus der Kirche ausgetreten. Abgegangen ist mir ein Pfarrer, wie ich von früheren Begräbnissen kannte, nicht. Auch meinem zweiten Großvater, erzkatholisch, hat der nicht gefehlt.
Ms. Begräbnis war das erste, zu dem ich aus innerem Antrieb gegangen bin. Sie war mir eine gute Freundin. Ihr Tod war überraschend. Selbstmord. Alkohol und Tabletten, nach jahrelangen Depressionen und mehreren Suizidversuchen. Seitdem ich von ihrem Tod erfahren hatte, hatte ich nur mehr ein Bild von ihr im Kopf. Wie zwei Sanitäter sie aus dem Tor ihres Wohnhauses heraustrugen, nach ihrem letzten Selbstmordversuch. Ihr Gesicht grau, faltig, die Augen abwesend. Weggetreten von dem Alkohol und den Medikamenten. Ich hatte damals mit einer gemeinsamen Freundin den Rettungseinsatz koordiniert.
Ein abstoßendes Bild. Nicht das, woran man sich erinnern will, wenn man an eine gute Freundin denkt. Zwei Wochen lang kämpfte ich um ein anderes Bild. Ich wusste, es musste in meinem Kopf sein. Ich konnte mich an die schönen Zeiten erinnern. Ich konnte mich erinnern, dass M. gern gelacht hat, dass sie ein unglaublich herzlicher, mitfühlender Mensch war. Nur sehen konnte ich sie nicht, auch nicht lachen hören. Das einzige Bild, das ich hatte, war dieses graue Wesen, das Sanitäter in den Notarztwagen trugen.
 Den Kampf habe ich erst beim und durch das Begräbnis gewonnen, in der Halle des Krematoriums am Zentralfriedhof. Geführt von einer Pastorin, aber kein Gottesdienst. Sie hat von einer besseren Welt gesprochen, in der M. jetzt sei. Vielleicht eine tröstliche Vorstellung. Andererseits: Irgendwann muss man sich damit abfinden, dass M. nicht mehr existiert. Nur mehr als Erinnerung. Der Glaube an ein besseres Leben danach, an ein besseres Leben als es M. hatte, an die Erlösung, mag den Schmerz im Moment lindern. Langfristig verzögert es aber die Abschiednahme, denke ich. M. leidet nicht mehr, habe ich mir gedacht. Das ist auch ein Trost. So sehr ich mir auch für sie, für ihre Kinder, für alle, die sie kannten, gewünscht hätte, dass es eine andere Lösung gegeben hätte.
Den Kampf habe ich erst beim und durch das Begräbnis gewonnen, in der Halle des Krematoriums am Zentralfriedhof. Geführt von einer Pastorin, aber kein Gottesdienst. Sie hat von einer besseren Welt gesprochen, in der M. jetzt sei. Vielleicht eine tröstliche Vorstellung. Andererseits: Irgendwann muss man sich damit abfinden, dass M. nicht mehr existiert. Nur mehr als Erinnerung. Der Glaube an ein besseres Leben danach, an ein besseres Leben als es M. hatte, an die Erlösung, mag den Schmerz im Moment lindern. Langfristig verzögert es aber die Abschiednahme, denke ich. M. leidet nicht mehr, habe ich mir gedacht. Das ist auch ein Trost. So sehr ich mir auch für sie, für ihre Kinder, für alle, die sie kannten, gewünscht hätte, dass es eine andere Lösung gegeben hätte.
Es war auch eine Hilfe, dass sehr viele gekommen waren, um zu trauern. Viele Bekannte und Freunde aus unserem gemeinsamen Stammlokal. Viele ihrer Kolleginnen und Kollegen, von denen ich ebenfalls einige kannte. Dieses Gemeinsame war Trost für uns alle und eine Stütze. Man fühlt sich nicht alleine gelassen. Das gibt Kraft, sich mit dem eigenen Schmerz zu beschäftigen.
Historisch bedingt haben Religionsgemeinschaften ein Monopol auf diese notwendigen Rituale. Überall auf der Welt. Die Formen dieses Abschieds unterscheiden sich dementsprechend. Juden und Muslime etwa begraben ihre Toten nach Möglichkeit am Tag nach dem Tod. Die Trauerrituale ziehen sich über einen längeren Zeitraum. Bis zu 40 Tage. In den meisten ostasiatischen Gesellschaften werden Tote verbrannt. Die Angehörigen mancher Eingeborenenstämme in Amerika bestatten ihre Toten auf Bäumen, die Leiche dient Raubvögeln als Futter. Ähnlich machen es die Parsen in Indien. Sie betreiben die so genannte Luftbestattung: Ihre Toten werden Geiern dargeboten. Ein Bestattungsritual, das sich in vergleichbarer Form auch in Tibet findet. Die eigentlichen Trauerrituale finden meist in den Wohnungen der Angehörigen statt.
Die Bedürfnisse der Hinterbliebenen auf der ganzen Welt sind die gleichen. Nur die Toten sind nicht gleich. Je nachdem, aus welchem Kulturkreis sie stammen, werden die Leichen auf bestimmte Weise entsorgt. Andere Bestattungsarten gelten als verpönt. Man denke nur an den harten Kampf des Vereins „Die Flamme“ und des Freidenkerbunds, die Feuerbestattung in Österreich zu legalisieren. Die religiös geprägten Vorstellungen sitzen tief. Das erklärt auch, warum sogar bei Konfessionslosen auf Wunsch der Familie oft Priester sprechen. So wie bei M.
Der Tod ist ein Monopol des Klerus. In der einen oder anderen Weise auf praktisch der ganzen Welt. Mönche und Priester haben in der gesellschaftlichen Wahrnehmungen die Rituale besetzt, die für uns notwendig sind, um den Tod eines geliebten Menschen zu verarbeiten. Nicht einmal die Vorstellung von Hochzeiten ist so stark religiös geprägt wie die von Tod und Abschiednehmen.
Das liegt sicher auch daran, dass Priester einen Schein-Trost anbieten. An ein Leben danach zu glauben, macht es sicher für viele kurzfristig leichter, mit dem momentan Unbegreifbaren umzugehen. Eine Art rituelles Placebo.
 Das hat es für uns Freidenkerinnen und Freidenker auch so schwer gemacht, laizistische Trauerrituale als Alternative zu etablieren. Es gibt sie. Massentauglich sind sie nicht. Die religiösen Prägungen, die viele als Kinder erhalten haben, brechen in dieser hoch emotionalen Situation durch. Das Placebo ist eher gefragt als die Einsicht, dass es nachher nichts mehr gibt.
Das hat es für uns Freidenkerinnen und Freidenker auch so schwer gemacht, laizistische Trauerrituale als Alternative zu etablieren. Es gibt sie. Massentauglich sind sie nicht. Die religiösen Prägungen, die viele als Kinder erhalten haben, brechen in dieser hoch emotionalen Situation durch. Das Placebo ist eher gefragt als die Einsicht, dass es nachher nichts mehr gibt.
Auch bei M.s Begräbnis. Allerdings muss ich der Pastorin zugute halten: Wenn sie auch nicht auf Jenseits-Vorstellungen verzichtet hat, auch nicht auf ein Gebet: Sie hat es so dezent gemacht, dass die nicht wenigen Atheistinnen und Atheisten sich nicht ausgeschlossen gefühlt haben. Sie hat nicht versucht, uns zu vereinnahmen. Dafür verdient sie Respekt. Nicht alle Priesterinnen und Priester, die zu nicht-religiösen Begräbnissen eingeladen werden, können dieser Versuchung widerstehen.

Christoph Baumgarten Trauer und Schmerz müssen wir in einer solchen Situation alle bewältigen. Jeder und jede auf seine Weise. Dazu brauchen wir Rituale. So wenig ich religiösen Menschen ihre wegnehmen will, so notwendig ist es, dass auch sie verstehen, dass auch Atheistinnen und Atheisten, Agnostikerinnen und Agnostiker und Freidenkerinnen und Freidenker ihre eigene Form der Trauerbewältigung haben und ausleben müssen. Und, dass nicht Priester und Mönche versuchen, auch diese Rituale zu vereinnahmen. Auf Tod und Trauer darf niemand ein Monopol haben.