(hpd) Als Religionskritiker sollen im Folgenden einige Denker mit ihren Auffassungen entlang der historischen Chronologie kurz portraitiert werden. Zwar besteht eine Gemeinsamkeit in der grundlegenden Kritik an Religion allgemein oder an besonderen Religionen. Es handelt sich allerdings nicht immer um Atheisten, kamen die Dargestellten doch auch auf Basis einer agnostischen, deistischen oder pantheistischen Auffassung zu ihren Einwänden.
Mitunter handelt es sich sogar um die Anhänger einer Religion, die andere Religionen kritisieren oder bestimmte Grundlagen der eigenen in Zweifel ziehen. Darüber hinaus lassen sich Unterschiede in der Schwerpunktsetzung der Kritik ausmachen: Mal ist es die Begründungsebene, also die Rechtfertigung für Religion, mal ist es die Erklärungsebene, also die Deutung der Akzeptanz, mal ist es die Wirkungsebene, also die Geschichte der Religion. Bei der Auswahl der Portraitierten fanden insbesondere Kritiker des Christentums und der deutschsprachige Raum Berücksichtigung.
Eindeutige Aussagen zu den Positionen der Religionskritiker in der frühen Antike lassen sich aus unterschiedlichen Gründen nur schwer formulieren: Erstens besteht ein Quellenproblem, da die einschlägigen Texte häufig nur fragmentarisch überliefert sind. Zweitens lassen sich aufgrund dieser Quellenlage auch ambivalente und widersprüchliche Deutungen vornehmen. Drittes hielten sich einige Philosophen angesichts möglicher Folgen bei bestimmten Aussagen bedeckt. Und viertens konnte Kritik an der Religion auch mit dem Glauben an die Existenz der Götter einhergehen. Als objektiv religionskritisch gelten können die Auffassungen der vorsokratischen Denker, insbesondere der Naturphilosophen (Anaximenes, Heraklit, Thales etc.), welche die Ursachen für die Naturprozesse in der Natur selbst suchten und sie nicht mehr als Ausdruck des Willens der Götter deuteten. Überhaupt stellt der philosophische Übergangsprozeß vom Mythos zum Logos einen grundlegenden Schritt in Richtung Religionskritik dar.
 Hinsichtlich der Einstellung zur Religion gibt es bei dem Philosophen Xenophanes (570-475 v.d.Z.) unterschiedliche Deutungen. Er wandte sich gegen die anthropomorphe Vorstellung von Göttern mit vermenschlichten Eigenschaften wie Betrug, Diebstahl und Untreue, was solchen edlen und transzendenten Wesen nicht würdig sei. Darüber hinaus stellten sich die Menschen ihre Götter entsprechend ihrer eigenen Bedürfnisse und Eigenschaften vor, sie wären somit das zufällige Produkt individueller Einbildungskraft, Phantasie und Wünsche. Derartigen Auffassungen stand Xenophanes mit Distanz gegenüber, könne doch kein Mensch die Götter genau erblicken. Bis zu dieser Stelle seiner Argumentation lies sich der Philosoph als Anhänger einer religionskritischen Projektionsthese deuten. Er vertrat allerdings auch die Auffassung, dass ein Gott unter den Göttern und den Menschen der größte sei. Manche Interpretationen sehen daher in ihm den frühen Vertreter eines neuen Gottesbegriffs im monotheistischen Sinne.
Hinsichtlich der Einstellung zur Religion gibt es bei dem Philosophen Xenophanes (570-475 v.d.Z.) unterschiedliche Deutungen. Er wandte sich gegen die anthropomorphe Vorstellung von Göttern mit vermenschlichten Eigenschaften wie Betrug, Diebstahl und Untreue, was solchen edlen und transzendenten Wesen nicht würdig sei. Darüber hinaus stellten sich die Menschen ihre Götter entsprechend ihrer eigenen Bedürfnisse und Eigenschaften vor, sie wären somit das zufällige Produkt individueller Einbildungskraft, Phantasie und Wünsche. Derartigen Auffassungen stand Xenophanes mit Distanz gegenüber, könne doch kein Mensch die Götter genau erblicken. Bis zu dieser Stelle seiner Argumentation lies sich der Philosoph als Anhänger einer religionskritischen Projektionsthese deuten. Er vertrat allerdings auch die Auffassung, dass ein Gott unter den Göttern und den Menschen der größte sei. Manche Interpretationen sehen daher in ihm den frühen Vertreter eines neuen Gottesbegriffs im monotheistischen Sinne.
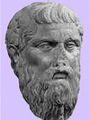 Als bedeutendster Vertreter der Sophisten gilt Protagoras (490-420 v. d.Z.), der eine Schrift „Über die Götter“ 415 v.d.Z. verfasst haben soll. Von ihr überliefert ist nur der erste Satz: Von den Göttern wisse der Autor nichts, weder dass sie existierten, noch dass sie nicht existierten; denn die Dunkelheit der Sache wie die Kürze des Lebens hemme das Wissen. Darüber hinaus ist nichts näheres bekannt. Es kann vermutet werden, dass Protagoras die traditionellen Göttervorstellungen als Widerspieglung menschlicher Verhältnisse deutete. Sicherheit besteht allerdings nur hinsichtlich der Auffassung, dass der Philosoph die Möglichkeit von sicherem Wissen der Menschen über das Leben und Wirken der Götter ausschloss. Obwohl hier nur eine agnostische und keine atheistische Position formuliert wurde, galt eine solche Einschätzung als Leugnung der Götter. Daher geriet Protagoras mit den herrschenden Vierhundert in Konflikt, seine Schriften wurden beschlagnahmt und verbrannt und er selbst zur Verbannung verurteilt.
Als bedeutendster Vertreter der Sophisten gilt Protagoras (490-420 v. d.Z.), der eine Schrift „Über die Götter“ 415 v.d.Z. verfasst haben soll. Von ihr überliefert ist nur der erste Satz: Von den Göttern wisse der Autor nichts, weder dass sie existierten, noch dass sie nicht existierten; denn die Dunkelheit der Sache wie die Kürze des Lebens hemme das Wissen. Darüber hinaus ist nichts näheres bekannt. Es kann vermutet werden, dass Protagoras die traditionellen Göttervorstellungen als Widerspieglung menschlicher Verhältnisse deutete. Sicherheit besteht allerdings nur hinsichtlich der Auffassung, dass der Philosoph die Möglichkeit von sicherem Wissen der Menschen über das Leben und Wirken der Götter ausschloss. Obwohl hier nur eine agnostische und keine atheistische Position formuliert wurde, galt eine solche Einschätzung als Leugnung der Götter. Daher geriet Protagoras mit den herrschenden Vierhundert in Konflikt, seine Schriften wurden beschlagnahmt und verbrannt und er selbst zur Verbannung verurteilt.
Ebenfalls zu den Sophisten gehörte der Philosoph Prodikos (470-390 v.d.Z.), der als Schüler von Protagoras gilt. In den ihm zugeschriebenen Überlieferungen finden sich Ausführungen zu dem Ursprung der Religionen: Er leitete diese ab aus dem Ackerbau, der die Grundlage jeder menschlichen Kultur sei, da er die Lebensmittelherstellung und Sesshaftigkeit ermögliche. Flüsse und Quellen, Mond und Sonne sowie die Früchte des Bodens lieferten die Beiträge dazu. Aufgrund ihrer hohen Bedeutung für das menschliche Leben sei die Vorstellung aufgekommen, es handele sich um die Götter. Daher verehre man in ihnen eigentlich nur die Kräfte der Natur. Demnach behauptete Prodikos in dieser Perspektive, dass es keine Götter gebe. Ob man diese Auffassung als atheistisch deuten muss, ist umstritten. Es könnte auch sein, dass der Philosoph lediglich die bestehenden Auffassungen einfach verständlich machen wollte. Möglich wäre aber auch eine aufklärerische Deutung, wonach die Götter als Produkte der Phantasie erscheinen.
 Der bekannte griechische Philosoph Epikur (341-270 v.d.Z.) entwickelte eine Ethik, wonach das oberste Prinzip das Streben nach Lusterfüllung sei. Entgegen weit verbreitert Auffassungen ging es ihm aber nicht um das bloße Ausleben von Emotionen und Wollust, sondern um seelische Ruhe und körperliche Schmerzlosigkeit. Dies brachte Epikur in Gegensatz zu den Auffassungen der heidnischen Religion mit ihrem Glauben an mehrere Götter. In ihr sah er eine Quelle der Furcht, die den Menschen belaste und verstöre. Dabei stritt Epikur die Existenz der Götter gar nicht ab. Für ihn lebten sie aber in einer Art Zwischenwelt, ohne auf das Leben der Menschen Einfluss nehmen zu können und zu wollen. Daher sei die Angst vor ihren Strafen in der Unterwelt unnötig. Vielmehr sollte den Menschen die Verehrung der Götter als Anreiz dienen, um an deren glückseligem Leben teilzuhaben. Epikur plädierte somit für eine säkulare Moral, beruhend auf dem Primat des angstfreien Strebens nach individuellem Glück im Diesseits.
Der bekannte griechische Philosoph Epikur (341-270 v.d.Z.) entwickelte eine Ethik, wonach das oberste Prinzip das Streben nach Lusterfüllung sei. Entgegen weit verbreitert Auffassungen ging es ihm aber nicht um das bloße Ausleben von Emotionen und Wollust, sondern um seelische Ruhe und körperliche Schmerzlosigkeit. Dies brachte Epikur in Gegensatz zu den Auffassungen der heidnischen Religion mit ihrem Glauben an mehrere Götter. In ihr sah er eine Quelle der Furcht, die den Menschen belaste und verstöre. Dabei stritt Epikur die Existenz der Götter gar nicht ab. Für ihn lebten sie aber in einer Art Zwischenwelt, ohne auf das Leben der Menschen Einfluss nehmen zu können und zu wollen. Daher sei die Angst vor ihren Strafen in der Unterwelt unnötig. Vielmehr sollte den Menschen die Verehrung der Götter als Anreiz dienen, um an deren glückseligem Leben teilzuhaben. Epikur plädierte somit für eine säkulare Moral, beruhend auf dem Primat des angstfreien Strebens nach individuellem Glück im Diesseits.
 An Epikurs materialistisch geprägte Auffassungen knüpfte sein römischer Anhänger, der Dichter und Philosoph Lukrez (99-55 v.d.Z.), mit der Ablehnung der Götter- und Todesfurcht an. Mit Beispielen aus der Mythologie veranschaulichte er in Lehrgedichten, dass die Vorstellung von den Göttern bei den Menschen aus Furcht vor Naturkatastrophen aufgekommen sei. Diese Annahmen machten die Menschen unglücklich, da sie noch schlimmere Entwicklungen nach ihrem Tod im Jenseits erwarteten. Lukrez verwarf derartige Einbildungen und Mythen. Außerdem lehnte er Auffassungen von der Unsterblichkeit und Vorsehung ab. Statt dessen solle man das Schicksal in die eigenen Hände nehmen und das individuelle Glück in der irdischen Welt suchen. Im Unterschied zu Epikur, der noch von der Existenz der Götter ausging, brach Lukrez im Sinne einer strikt atheistischen Position mit dieser Annahme. Seinen philosophischen Lehrer feierte er in einem hymnischen Gedicht als Befreier der Menschen und Zerstörer der Religion.
An Epikurs materialistisch geprägte Auffassungen knüpfte sein römischer Anhänger, der Dichter und Philosoph Lukrez (99-55 v.d.Z.), mit der Ablehnung der Götter- und Todesfurcht an. Mit Beispielen aus der Mythologie veranschaulichte er in Lehrgedichten, dass die Vorstellung von den Göttern bei den Menschen aus Furcht vor Naturkatastrophen aufgekommen sei. Diese Annahmen machten die Menschen unglücklich, da sie noch schlimmere Entwicklungen nach ihrem Tod im Jenseits erwarteten. Lukrez verwarf derartige Einbildungen und Mythen. Außerdem lehnte er Auffassungen von der Unsterblichkeit und Vorsehung ab. Statt dessen solle man das Schicksal in die eigenen Hände nehmen und das individuelle Glück in der irdischen Welt suchen. Im Unterschied zu Epikur, der noch von der Existenz der Götter ausging, brach Lukrez im Sinne einer strikt atheistischen Position mit dieser Annahme. Seinen philosophischen Lehrer feierte er in einem hymnischen Gedicht als Befreier der Menschen und Zerstörer der Religion.
Das Aufkommen des Christentums löste eine Reihe von Streitschriften gegen die neue Religion aus, wozu als erstes bedeutsames Werk „Das wahre Wort“ von 178 aus der Feder des Platonikers Celsus (2. Jahrhundert) gehört. In diesem Text kritisierte der ansonsten weitgehend unbekannte Autor die unterschiedlichsten Aspekte des Christentums: Er hielt die religiösen Grundlagen lediglich für eine wenig originelle Mischung aus Bestandteilen des jüdischen Glaubens und anderer Religionsformen. Die Texte der Evangelien seien weder einheitlich noch widerspruchsfrei. Darüber hinaus kritisierte Celsus den Dogmatismus des Christentums, verlange es doch den Glauben ohne Prüfung seiner Inhalte. Außerdem wende sich diese Religion bewusst an die Einfältigen, die Gebildeten könnten von seiner Botschaft nur schwerlich überzeugt werden. So erkläre sich auch der Glaube an die betrügerischen Wunderberichte. Spätere heidnische Kritiker des Christentums knüpften direkt oder indirekt an Celsus' Argumentation an.
Zu ihnen gehörte auch der neuplatonische Philosoph Porphyrios (233-301/305) mit seiner Schrift „Gegen die Christen“ von 270, die sich nach eingehender Analyse des Neuen Testaments mit scharfem Ton gegen die spekulativen und widersprüchlichen Positionen des Christentums wandte. Porphyrios bestritt darüber hinaus das hohe Alter der Texte des Alten Testaments und damit deren Authentizität im Selbstverständnis des christlichen Glaubens. Die im Neuen Testament vorgenommene Mythenbildung um die Person Jesus deutete er als Versuch, dem Religionsgründer durch das Andichten von Eigenschaften und Handlungen Einzigartigkeit und Göttlichkeit zuzuschreiben. Porphyrios richtete seine Kritik aber auch gegen die beiden bedeutsamen Apostel Paulus und Petrus, die ihm hinsichtlich der Auffassungen und des Verhaltens als heuchlerisch, schwankend und widersprüchlich galten. Gerade die inhaltlichen Einwände machten den Philosophen zu einem Vorläufer der modernen Bibelkritik.
 Der römische Kaiser Julian (332-363) versuchte den Einfluss des Christentums zurück zu drängen und ein neues Heidentum als Staatsreligion zu verankern. Er ging dabei nicht nur administrativ, sondern auch argumentativ vor. In zahlreichen Streitschriften formulierte Julian die unterschiedlichsten Aspekte seiner Kritik: Die Texte des Alten und Neuen Testaments wiesen keine Einheitlichkeit in den Aussagen zu bedeutsamen Aspekten auf, Jesus gehöre zu den zeitweilig auftretenden gewöhnlichen Figuren von Religionsstiftern, der Auferstehungsglaube müsse aufgrund seines Widerspruchs zu den Naturgesetzen als Ausdruck äußersten Unsinns gelten, die Christen seien verbohrt und sich untereinander feindlich wie Raubtiere gesinnt. Julian kritisierte das Christentum ebenso wie Celsus und Porphyrios aus der Perspektive des antiken Heidentums mit all seinen irrationalen Zügen. Gleichwohl lieferten die drei Genannten eine auch unabhängig von dieser Parteilichkeit begründbare historische und inhaltliche Kritik am Christentum.
Der römische Kaiser Julian (332-363) versuchte den Einfluss des Christentums zurück zu drängen und ein neues Heidentum als Staatsreligion zu verankern. Er ging dabei nicht nur administrativ, sondern auch argumentativ vor. In zahlreichen Streitschriften formulierte Julian die unterschiedlichsten Aspekte seiner Kritik: Die Texte des Alten und Neuen Testaments wiesen keine Einheitlichkeit in den Aussagen zu bedeutsamen Aspekten auf, Jesus gehöre zu den zeitweilig auftretenden gewöhnlichen Figuren von Religionsstiftern, der Auferstehungsglaube müsse aufgrund seines Widerspruchs zu den Naturgesetzen als Ausdruck äußersten Unsinns gelten, die Christen seien verbohrt und sich untereinander feindlich wie Raubtiere gesinnt. Julian kritisierte das Christentum ebenso wie Celsus und Porphyrios aus der Perspektive des antiken Heidentums mit all seinen irrationalen Zügen. Gleichwohl lieferten die drei Genannten eine auch unabhängig von dieser Parteilichkeit begründbare historische und inhaltliche Kritik am Christentum.
Während des Mittelalters dominierten die christliche Kirche und Religion die europäischen Gesellschaften. Daher kamen religionskritische Stimmen entweder gar nicht auf oder wurden rigoros unterdrückt. Gleichwohl lässt sich für diese historische Epoche nicht pauschal von „christlichem Mittelalter“ sprechen, gab es doch eine Reihe von religionskritischen Tendenzen. Einige Philosophen entdeckten die Vernunft als Prinzip für ihr Denken, womit sich indirekt eine Relativierung der Glaubensansprüche verband. In der einfachen Bevölkerung entstand phasenweise eine wenig reflektierte Skepsis, die in Verbindung mit Formen eine Spottes über Kirchenvertreter und Varianten diffusen Unglaubens Glaubenssätze relativierte. Überwiegend akzeptieren die vorstehend genannten Tendenzen aber das Christentum oder die Religion, sie stellten dabei jedoch grundlegende Aspekte von deren Selbstverständnis in Frage. Dies gilt auch für die beiden mit diesen Vorbehalten exemplarisch als Religionskritiker im Mittelalter genannten Philosophen.
 Der arabische Denker Ibn Rushd (1126-1198), der auch als Averroes bekannt wurde, spielte insbesondere als Aristoteles-Interpret eine wichtige Rolle. Mit Verweisen auf die materialistischen und naturwissenschaftlichen Auffassungen des antiken Philosophen kritisierte er Anhänger der orthodoxen Auffassung des Islam. Darüber hinaus ging Ibn Rushd von der Ewigkeit der Welt, der Sterblichkeit der Seele und der Unmöglichkeit göttlicher Schöpfung aus. Diese Positionen standen im Gegensatz zu den Grundlagen von Christentum, Islam und Judentum . Daraus leitete sich auch der Vorwurf ab, Ibn Rushd sei ein ungläubiger Gegner der drei Religionen und Autor blasphemischer Streitschriften gewesen. Er hatte sich aber nicht vom Islam abgewandt, sondern versuchte den Koran im Sinne einer Autonomie des Individuums zu deuten. Gegen Ende seines Lebens wurde Ibn Rushd angeklagt, die antike Philosophie zu Ungunsten des Islam ausgelegt zu haben. Man verbrannte seine Bücher und verbannte ihn.
Der arabische Denker Ibn Rushd (1126-1198), der auch als Averroes bekannt wurde, spielte insbesondere als Aristoteles-Interpret eine wichtige Rolle. Mit Verweisen auf die materialistischen und naturwissenschaftlichen Auffassungen des antiken Philosophen kritisierte er Anhänger der orthodoxen Auffassung des Islam. Darüber hinaus ging Ibn Rushd von der Ewigkeit der Welt, der Sterblichkeit der Seele und der Unmöglichkeit göttlicher Schöpfung aus. Diese Positionen standen im Gegensatz zu den Grundlagen von Christentum, Islam und Judentum . Daraus leitete sich auch der Vorwurf ab, Ibn Rushd sei ein ungläubiger Gegner der drei Religionen und Autor blasphemischer Streitschriften gewesen. Er hatte sich aber nicht vom Islam abgewandt, sondern versuchte den Koran im Sinne einer Autonomie des Individuums zu deuten. Gegen Ende seines Lebens wurde Ibn Rushd angeklagt, die antike Philosophie zu Ungunsten des Islam ausgelegt zu haben. Man verbrannte seine Bücher und verbannte ihn.
 An einige philosophische Lehren von Ibn Ruschd knüpfte der englische Scholastiker Wilhelm von Ockham (1285-1350) an. Er vertrat eine nominalistische Auffassung, wonach das Einzelne den primären Gegenstand der Erkenntnis bildete. Diese Perspektive ließ Ockham eine rigorose Trennung von Glauben und Vernunft vornehmen. Zwar begriff er Gott als Erhalter der Welt, aber dessen Einzigartigkeit sei nicht beweisbar und lediglich eine Sache des Glaubens. Darüber hinaus bestritt Ockham die Bedeutung Gottes bei der Entwicklung von Naturprozessen. Übertragen auf die gesellschaftliche Ebene ließen ihn seine Auffassungen eine konsequente Trennung von Kirche und Staat fordern. Ockhams Auffassungen entwickelten sich allerdings nicht hin zu einem säkularen Atheismus, sondern gehören allenfalls zur Vorgeschichte der Reformation. Gleichwohl sah man sie als religionskritisch an, wurde er doch vom Papst wegen ketzerischer Lehren angeklagt und nach einer Flucht vor Verhaftung mit einem Bann belegt.
An einige philosophische Lehren von Ibn Ruschd knüpfte der englische Scholastiker Wilhelm von Ockham (1285-1350) an. Er vertrat eine nominalistische Auffassung, wonach das Einzelne den primären Gegenstand der Erkenntnis bildete. Diese Perspektive ließ Ockham eine rigorose Trennung von Glauben und Vernunft vornehmen. Zwar begriff er Gott als Erhalter der Welt, aber dessen Einzigartigkeit sei nicht beweisbar und lediglich eine Sache des Glaubens. Darüber hinaus bestritt Ockham die Bedeutung Gottes bei der Entwicklung von Naturprozessen. Übertragen auf die gesellschaftliche Ebene ließen ihn seine Auffassungen eine konsequente Trennung von Kirche und Staat fordern. Ockhams Auffassungen entwickelten sich allerdings nicht hin zu einem säkularen Atheismus, sondern gehören allenfalls zur Vorgeschichte der Reformation. Gleichwohl sah man sie als religionskritisch an, wurde er doch vom Papst wegen ketzerischer Lehren angeklagt und nach einer Flucht vor Verhaftung mit einem Bann belegt.
Armin Pfahl-Traughber
Abbildungen: Soweit nichts anders vermerkt, unterliegen die Abbildungen der gemeinfreien Lizenz unter http://commons.wikimedia.org - Nachweise bei den betreffenden Namen.
Epikur: Rom, Museo Barracco.
Protagoras: Oregonstate University.







