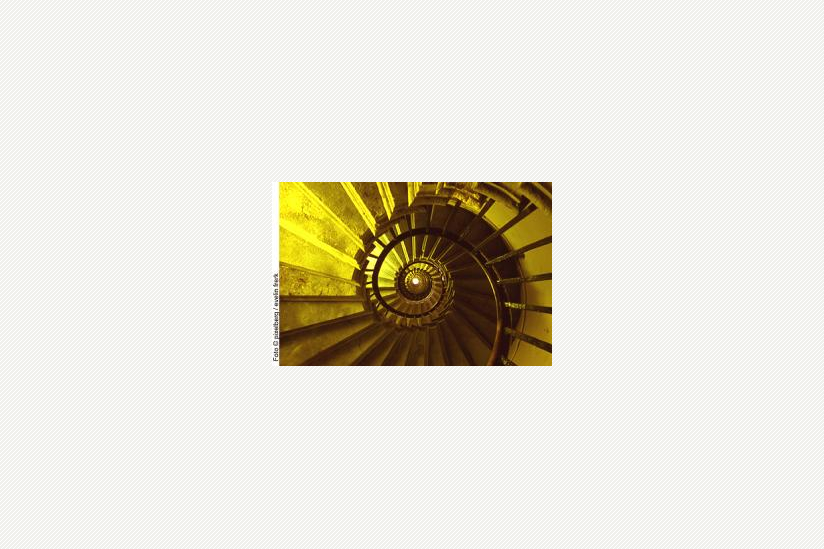Das islamische Kopftuch im rechtlichen und politisch - gesellschaftlichen Zusammenhang.
Von Gerhard Czermak.
Hinsichtlich des Urteils des Bayerischen Verfassungsgerichtshofes vom 15.1.2007 ist eine reflektierte juristische und politische Betrachtung angebracht. (Dieser Beitrag ist die erheblich gekürzte Fassung eines aktuellen Artikels (mit zahlreichen Anmerkungen und Quellen) im <fowid-Textarchiv> .)
Gegenstand der Erörterung
Bei der Beurteilung des von einer muslimischen Lehrerin im Staatsdienst getragenen Kopftuchs geht es zunächst um Empfindlichkeiten, Vorurteile, Religion, Politik, Geschlechterverhältnis und kulturelle Differenzen. Schon deshalb ist die besondere und anhaltende Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit unvermeidlich. Es geht aber auch um das Selbstverständnis des säkularen, freiheitlichen und demokratischen Rechtsstaats. Wenn angesichts dieser komplexen Problematik rechtspolitisch Stellung genommen werden soll, kann das hier nur schwerpunktmäßig erfolgen. Ich werde mich daher darauf konzentrieren, auf einige Charakteristika und Zwischenergebnisse der bisherigen Diskussion und Rechtsentwicklung hinzuweisen, den verfassungsrechtlichen Gesamtzusammenhang der Behandlung ideologischer Fragen aufzuweisen und die Frage der Gleichbehandlung von Religionen, d. h. der religiös-weltanschaulichen Neutralität, in einem Land mit weit fortgeschrittener Säkularisierung zu erörtern.
Die seit dem Kruzifix-Beschluss des BVerfG von 1995 anhaltende und immer wieder aufköchelnde öffentliche Debatte wie auch das staatliche Verhalten betreffend das Kreuz in der Schule, aber auch in anderen öffentlichen Einrichtungen wie Rats- oder gar Gerichtssälen, zeigt: Ideologische Grundfragen werden in Gesellschaft und Recht wenig einheitlich beurteilt und das Grundgesetz ist nach weit über 50 Jahren immer noch in Kernfragen (Neutralität, Staatsideologie) unverstanden oder doch kaum verinnerlicht. Die Kruzifix-Debatte von 1995/96 zeigte, dass der Nerv der überzeugt christlichen Bevölkerung – d. h. einer klaren Minderheit – sowie allgemein das Traditionsgefühl weltanschaulich konservativer Menschen getroffen war. Insbesondere konservative Politiker und Juristen selbst von hoher Reputation haben sofort, teilweise ohne Kenntnis der genauen Entscheidungsgründe, die Instrumentalisierbarkeit des Entscheidungsergebnisses nicht nur erkannt, sondern sogleich ohne Skrupel öffentlichkeitswirksam ausgenutzt. Die Medien produzierten daher, unterstützt durch solche Vorbilder, polarisierende und nicht selten hetzerische Schlagzeilen und Artikel, die höchst erfolgreich waren. Dass man sachliche, nachvollziehbare (und heute in der juristischen Fachliteratur weithin als seriös anerkannte) Argumente selbst des höchsten deutschen Gerichts ungestraft herabwürdigen und in den Schmutz ziehen durfte, war eine staatspolitisch neu-artige und in dieser Form völlig unvorhersehbare Erscheinung.
Hauptgesichtspunkte der Kopftuchdebatte
So heftig die Gemütsaufwallungen nach Verkündung des Kopftuch-Urteils des BVerfG vom 24. 9. 2003 auch auf breiter Ebene waren, sie erreichten wohl bei weitem nicht die Intensität der Kruzifix-Debatte. Der Kruzifix-Beschluss von 1995 verbannte nämlich (zumindest theoretisch) erstmals ausdrücklich das Kreuz als christliches Hauptsymbol sogar aus der – freilich zu Unrecht – so genannten (staatlichen) Christlichen Gemeinschaftsschule, weil es geeignet sei, Schüler verfassungswidrig einseitig ideologisch zu beeinflussen und weil es generell gegen das Gebot der religiös-weltanschaulichen Neutralität verstoße. Das war vor allem dem konservativen bayerischen Publikum schwer plausibel zu machen, das eine jahrzehntelange und manchmal regelrecht aggressive dezidiert christliche Schulpolitik im Volksschulwesen gewöhnt war. Deren klare GG-Widrigkeit hatten schon die Entscheidungen des BVerfG zu den sog. Christlichen Gemeinschaftsschulen von 1975 indirekt, aber unmissverständlich festgestellt. Das war der Eltern- und Lehrerschaft aber wegen der gezielten Desinformation der Kultusverwaltung und auch wegen der in der Öffentlichkeitsarbeit herrschenden Mechanismen nicht bekannt. So wurde systematisch der „Verfassungsbruch als Erziehungsmittel" benutzt. Die christliche Bevölkerung insbesondere in Bayern fühlte daher 1995 den vermeintlich ihr gehörenden „christlichen" Boden unter den Füßen weggezogen.
Die oft als uneindeutig kritisierte Kopftuch-Entscheidung des BVerfG von 2003 hatte für die konservative deutsche Bevölkerung nicht diese quasi existentielle Bedeutung, weil nach außen hin zunächst nur das als irritierend empfundene Kopftuch im Vordergrund stand, dessen Verbot immerhin ermöglicht wurde. Dafür erregten sich jetzt Kreise, die sonst als liberal galten und Bürgerrechte verteidigten, sowie feministische Zirkel, die im islamischen Kopftuch ausschließlich ein fundamentalistisches, wenn nicht islamistisches Symbol zu sehen vermochten, das einen klaren Verstoß gegen die mühsam errungene Gleichberechtigung von Mann und Frau darstelle und daher konsequent und flächendeckend zu unterbinden sei. Das nicht oder schlecht organisierte Lager derer, die endlich eine Wende hin zur auch praktischen Verwirklichung der religiös-weltanschaulichen Neutralität des Staats wenigstens in einem Teilbereich sahen, reagierte unterschiedlich. Die einen wollten das Kopftuch als ideologisches Symbol genauso und ganz aus dem staatlich-öffentlichen Raum entfernen wie das Kreuz, die anderen verlangten mit der Mehrheit der Bundesverfassungsrichter eine differenzierende Betrachtung, weil das Kopftuch mehrdeutig sei. Gespalten war und ist aber auch die Reaktion der islamischen Bevölkerung, und die Diskussion innerhalb der christlichen Kirchen ist es nicht minder. Manche Kirchenvertreter rieten zu Toleranz, weil sie – wie 2004 auch Bundespräsident Rau – meinten, eine Gleichbehandlung des Christentums mit dem Islam werde sich sonst nicht verhindern lassen. So ist in Deutschland in der Kopftuchfrage die gesamte Bevölkerung und auch die Beurteilung in der Politik und quer durch die Parteien gespalten, und das zeigt sich auch in den unterschiedlichen Reaktionen der Bundesländer. Ein deutlicher Konflikt wurde schon mit dem Urteil des BVerfG selbst dokumentiert, das die Minderheit von drei Richtern in einem Sondervotum ungewöhnlich scharf ablehnte.
In rechtspolitischer Hinsicht wurden zu Gunsten des islamischen Kopftuchs im Wesentlichen folgende Gesichtspunkte vorgetragen:
- Das K. sei in erster Linie ein religiöses Symbol, das auf Vorschriften des Koran gestützt sei. Als solches müsse es zumindest in eine Güterabwägung einbezogen werden.
- Die Ermöglichung des K. sei ein wichtiges integrationspolitisches Anliegen, seine pauschale Verhinderung wirke diskriminierend.
- Das K. könne eine wichtige Hilfe auf dem Weg zwischen zwei Kulturen sein, da es eine Bindung an die Herkunftskultur dokumentiere und somit Halt gebe (Schutz vor Identitätsverlust)
- Es helfe, familiäre Probleme zu vermeiden.
- Es sei vielfach auch ein Zeichen der Emanzipation und keineswegs der Frauenunterdrückung, da es um Frauen gehe, die sich im Gegensatz zu den Gepflogenheiten der Herkunftskultur einen eigenen Beruf und damit die Möglichkeit einer unabhängigen Existenz erkämpft hätten.
- Das K. hebe die Würde der islamischen Frau hervor und biete ihr Schutz.
- Es könne wesentlich dazu beitragen, gegenseitige Toleranz auch praktisch einzuüben.
- Entscheidend sei nicht, was eine muslimische Lehrerin auf dem Kopf, sondern im Kopf habe. Das könne sie auch mit Worten erläutern.
- Wer das K. verbiete, müsse auch das Ordenskleid und die jüdische Kippa verbieten.
- Ein Kopftuchverbot könne negative Folgen für den interreligiösen Dialog haben.
Demgegenüber tragen die Kopftuchgegner meist mit Vehemenz vor:
- Das islamische K. sei das dezidierte Zeichen islamistischer Gesinnung, zumindest im Regelfall, und werde sogar mit der Billigung von Gewalt assoziiert.
- Das K. sei das klare Zeichen der Unterwerfung und Unterdrückung der Frau und stehe daher im Widerspruch zu Art. 3 II GG.
- Es spalte die Gesellschaft und irritiere die einheimische Bevölkerung. Es werde nicht die Integration gefördert, sondern Parallelgesellschaften mit ihren Gefahren würden zementiert.
- Der Koran schreibe in keiner Weise ein derartiges Tuch vor, sondern äußere sich viel allgemeiner. Die Praxis sei dementsprechend in den islamischen Ländern unterschiedlich.
- Die Kopftuchtragende Lehrerin sei ein schlechtes Vorbild und erschwere erheblich die Situation von Schülerinnen muslimischer Herkunft, die nun noch leichter zum Tragen eines Kopftuchs gedrängt oder gar gezwungen werden könnten.
- Das K. sei eine Absage an die christliche Grundlage von Staat und Gesellschaft.
- Das K. verstoße klar gegen die Neutralitätspflicht des Staates und der Lehrerin.
Objektivierung der Probleme
All diese Punkte und vielleicht noch weitere wurden in allgemeinen und Fachdebatten und vermutlich Tausenden von schriftlichen Stellungnahmen einschließlich ungewöhnlich zahlreicher mehr (oder auch weniger) wissenschaftlicher Erörterungen immer wieder durchgekaut. Besonders fällt dabei auf, dass Kopftuchgegner, darunter übrigens auch relativ prominente islamische bzw. aus dem islamischen Kulturkreis stammende Frauen – nicht selten verbissen, aber nicht ohne Grund – ihre These von der Gleichsetzung des Kopftuchs mit Islamismus und Frauenunterdrückung vertreten, jedoch andere Sichtweisen kategorisch nicht zulassen. Bei nüchterner Sichtung aller o. g. Einzelargumente Pro und Contra kommt man leicht zu dem Ergebnis, dass sie trotz ihrer z. T. großen Gegensätzlichkeit fast alle eine gewisse Berechtigung haben. Daher stellt sich die Frage, ob und welche allgemein rational nachvollziehbaren und akzeptablen Gründe es geben kann, eine (möglichst bundesweit einheitliche) Regelung in der einen oder anderen Richtung zu finden, ohne mit dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in einen unauflösbaren Konflikt zu geraten oder den sozialen Frieden ernsthaft zu stören.
Bei der kritischen Überprüfung der o. g. Fragestellungen ist es von Bedeutung, ihr Verhältnis zur wirklichen Aussage des Urteils des BVerfG zu bestimmen. Das ist deswegen zu betonen, weil erfahrungsgemäß leider gerade die Entscheidungsgründe solch ideologisch aufgeladener Gerichtsentscheidungen in der allgemeinen Diskussion allenfalls eine geringe Rolle spielen. Trotz der vielfach und selbst von Juristen geübten scharfen und oft auch bemerkenswert unsachlichen Kritik an der Entscheidung vom September 2003 ist diese trotz einer gewissen Weitschweifigkeit im grundsätzlichen Gedankengang klar, logisch und nachvollziehbar.
Die Verfassungsbeschwerde der muslimischen Lehrerin Fereshta Ludin betraf die Frage, ob das Land Baden-Württemberg ihr zu Recht die Ernennung zur Beamtin verweigere, weil sie auch während des Unterrichts ihr Kopftuch aus hauptsächlich religiösen Gründen keinesfalls ablegen wolle. Weder das religiöse Motiv, noch die Verfassungstreue von Frau Ludin war von den Schulbehörden, den drei vorangegangenen verwaltungsgerichtlichen Instanzen und dem Prozessvertreter des Landes vor dem BVerfG in Zweifel gezogen worden. Bei dieser Sachlage vertrat das BVerfG folgende Auffassung: Es geht um die beamtenrechtlich erforderliche persönliche Eignung im Sinn des Art 33 II GG, die nach Art. 33 III GG auch unabhängig vom religiös-weltanschaulichen Bekenntnis ist. Die Beurteilung der Frage, ob das konsequente Tragen eines islamischen Kopftuchs diese Eignung in Frage stellen kann, ist ein Problem, weil sich die Lehrerin einerseits grundsätzlich auf die auch ihr zustehende Religionsfreiheit (Art. 4 I, II GG) berufen kann, andererseits zu den Beamtenpflichten die Wahrung der religiös-weltanschaulichen Neutralität gehört und Schüler bzw. Eltern einen grundrechtlichen Anspruch haben, nicht durch Verhaltensweisen, die dem Staat zuzurechnen sind, gezielt beeinflusst zu werden. Um diese drei bzw. vier verschiedenen Rechtspositionen verfassungsrechtlich in Einklang bringen, mit anderen Worten die Frage der konkreten Schranken der Religionsfreiheit der Lehrerin klären zu können, muss die Bedeutung des Kopftuchs und einer davon ggf. ausgehenden Einflussnahme ermittelt werden. Dabei kam das BVerfG nach Anhörung von Sachverständigen zu dem klaren Ergebnis, das islamische Kopftuch sei objektiv mehrdeutig. Es könne nicht als solches unzulässig beeinflussen, sondern nur in Verbindung mit einem kritikwürdigen Gesamtverhalten der Trägerin. Dieses war aber im konkreten Fall auch im Hinblick auf die religiös-weltanschauliche Neutralität nach Sachlage nicht zu beanstanden. Einer Einstellung als Beamtin stand daher nichts im Wege, denn eine entgegenstehende landesgesetzliche Regelung gab es im baden-württembergischen Recht damals nicht. Daher wurden alle entgegenstehenden behördlichen und gerichtlichen Entscheidungen aufgehoben.
Diese Argumentation entspricht entgegen anders lautenden Stimmen völlig der anerkannten Grundrechtsdogmatik, auch bezüglich der Amtsträger mit besonderem Status, und ist widerspruchsfrei. Dass wegen der – isoliert betrachtet – ideologischen Missverständlichkeit des islamischen Kopftuchs eine Verbotsregelung bei Beachtung bestimmter Voraussetzungen grundsätzlich zulässig wäre, darunter vorrangig die Gleichbehandlung der verschiedenen Religionen (Neutralitätsgebot), hat das BVerfG eingeräumt. Selbst wenn man dazu nicht, wie aber mit guten Gründen das BVerfG, ein förmliches Gesetz für erforderlich hält, sind wegen der Kompetenzregelung in Art. 70 ff. GG für Schulangelegenheiten jedenfalls die Länder zuständig. Die häufig scharf kritisierte Möglichkeit unterschiedlicher Landesgesetze ist daher keine Erfindung des BVerfG, sondern eine verfassungsrechtliche Selbstverständlichkeit. Das steht auch nicht im Widerspruch zum Neutralitätsgebot, denn im Fall des Verzichts auf ein generelles Kopftuchverbot ist die objektive Mehrdeutigkeit des Kopftuchs bei gleichzeitig glaubhaft zu machender schulischer Neutralität der Lehrerin im Rahmen der Eignungsprüfung zu berücksichtigen. Und dass Neutralität ggf. auf unterschiedliche Weise hergestellt werden kann, nämlich als offene und als distanzierende, sollte sich mittlerweile herumgesprochen haben.
Ist somit das Urteil bei der Behandlung der maßgeblichen Rechtsfragen in sich konsistent und in keiner Weise revolutionär, so verbleibt als möglicher Hauptkritikpunkt nur die Beurteilung der Bedeutung des Kopftuchs als Symbol, weil davon letztlich alles abhängt. Nun ist unbezweifelbar, dass der (verfassungsfeindliche) Islamismus von Frauen das Tragen dieser Art von Kopftuch autoritativ fordert und dass das Kopftuch vielfach in den muslimischen Kulturen als Zeichen der Unterordnung und Geringwertigkeit gegenüber dem Mann verstanden wird. Dieses Verständnis aber absolut zu setzen, ist wohl unseriös. Die Mehrdeutigkeit des islamischen Kopftuchs (s. die oben genannten Hauptgesichtspunkte der Kopftuchdebatte) im Einzelnen darzulegen, muss insbesondere der Islamwissenschaft, Soziologie und Politologie vorbehalten bleiben. Zwar gibt es derzeit wohl keine genauen Untersuchungen darüber, aus welchen religiösen und nichtreligiösen Gründen und Begründungskombinationen Mädchen und Frauen in Deutschland solche Kopftücher tragen und wie das nach altersmäßigen, bildungs- und berufsmäßigen sowie ggf. regionalen Unterschieden differiert, wobei sicher auch die Frage der Zugehörigkeit zu Organisationen und die familiären Erwartungen eine Rolle spielen. Nun haben speziell in Berlin der orthodoxe Islam und der Islamismus nach dem Kopftuchurteil des BVerfG spürbar Auftrieb erfahren. Dort (und anderswo) ist die Zahl der jungen Kopftuchträgerinnen stark angestiegen, wobei nicht selten rigider familiärer Zwang angewendet wird. Hierüber gibt es genügend alarmierende Berichte. All das mag die rechtspolitische Notwendigkeit begründen, jedenfalls in Berlin eine restriktive gesetzliche Neuregelung nach Maßgabe des Kopftuchurteils zu erlassen. Ein Argument gegen die Richtigkeit der verfassungsgerichtlichen Entscheidung ist aber nicht ersichtlich.
Kopftuch und Landesgesetzgebung
Die Führung einiger Bundesländer hat nach Verkündung des BVerfG-Urteils schnell deutlich gemacht, ein Gesetz erlassen zu wollen, um speziell das islamische Kopftuch staatlicher Lehrer verbieten zu können.
Die 2004 in fünf Ländern in Kraft gesetzten Regelungen können hier nicht im Detail analysiert werden. So viel kann man aber auch bei überschlägiger Prüfung sagen: sie sind sowohl aus rechtsstaatlicher wie rechtspolitischer Sicht völlig misslungen, denn sie nennen die Dinge nicht beim Namen, verwenden unklare Begriffe und vergrößern sogar – entgegen der erklärten Absicht – erheblich die Unsicherheit, die ohne solche Gesetze bestünde. Vier von ihnen (Ba-Wü, Bay, Hes, Saarl) enthalten textlich eine vage Privilegierung christlichen Gedankenguts. Besonders fällt auf, dass diese Gesetze laut jeweiliger Begründung alle eine Reaktion auf die Kopftuch-Entscheidung des BVerfG darstellen wollen, indem sie islamische Kopftücher bei Lehrerinnen verbieten und im übrigen die Vorgaben des Urteils einhalten. Die Gesetzestexte selbst sehen jedoch ganz anders aus: Konkrete Begriffe wie insbesondere „Kopftuch", „Ordenskleid" und „Kreuz" enthalten sie nicht. Wenn es jemand darauf angelegt hätte, jede klare Begrifflichkeit zu vermeiden, eine konservative Stimmung zu erzeugen, Unsicherheit zu schaffen und weiteren Rechtsstreit zu provozieren, hätte man es kaum besser machen können.
Einen ehrlichen Weg ist demgegenüber das Land Berlin gegangen. Die Präambel des Gesetzes betont mehr als nur nebenbei die generelle Bedeutung der Neutralität in staatlichen „Bereichen, in denen die Bürgerin oder der Bürger in besonderer Weise dem staatlichen Einfluss unterworfen ist..." Speziell für den Schulbereich wird verfügt, es dürften Pädagogen „innerhalb des Dienstes keine sichtbaren religiösen oder weltanschaulichen Symbole, die für die Betrachterin oder den Betrachter eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft demonstrieren, und keine auffallenden religiös oder weltanschaulich geprägten Kleidungsstücke tragen. Dies gilt nicht für die Erteilung von Religions- und Weltanschauungsunterricht." Damit dürfte klargestellt sein, dass weder Kopftuch, noch Kreuz (in welcher Form auch immer) noch Ordenskleid oder Kippa getragen werden dürfen. Eine solche Regelung ist hieb- und stichfest. Sie wurde expressis verbis auf den Kernbereich des öffentlichen Dienstes (Justiz, Polizei, Strafvollzug) ausgeweitet und natürlich gerade wegen dieser konsequenten „Gleichbehandlung von Kopftuch und Kreuz" kritisiert.
In Frage kommt nach zutreffender und auch vom BVerfG ausdrücklich vorgeschriebener Auffassung nur eine rechtlich-politische Entscheidung der Kopftuchfrage, die dem religiös-weltanschaulichen Gleichheitsgebot (Neutralitätsgebot) vollständig gerecht wird.
Bemerkenswert ist der Umstand, dass Gesichtspunkte, die das BVerfG in erster Linie für die Entscheidung über das Ob einer gesetzlichen Verbotsregelung aufgezeigt hat, von etlichen Ländern missbräuchlich als Freibrief für einen beliebig weiten Ermessensspielraum innerhalb einer solchen Regelung aufgefasst wurde. Insoweit käme wohl nur in Betracht, traditionelle (nicht demonstrative) Schmuckkreuzchen und vergleichbare islamische, jüdische usw. Schmuckzeichen zuzulassen.
Neutralität und staatliche Identität
Das rechtspolitische Problem des Kopftuchs besteht nach allem weniger in der Entscheidung dar-über, ob man es bei Lehrern generell untersagen darf oder soll, sondern ob man dabei zwischen Kopftuch und Kreuz unterscheiden darf mit dem Ergebnis, dass man das Kopftuch verbietet und trotzdem die Dominanz des Christentums auch in der Schule optisch sichtbar beibehält. Nach der Rechtsprechung des BVerfG ist das, wie gesagt, nicht möglich. Die Grundstruktur des GG erlaubt auch keine andere Auffassung. Das GG ist zwar sehr aufgeschlossen für Religion und Weltanschauung, behandelt aber alle Richtungen formal gleich (§§ 3 III, 4 I, 33 III GG, 137 VII WRV/ 140 GG). Daran ändern auch vermeintliche rechtliche Bevorzugungen wie Gottesklausel und Religionsunterricht bei näherer Betrachtung nichts. Denn erstere ist anerkanntermaßen nur ein Hinweis auf die Motivation des Verfassungsgebers und keine religiöse Rechtsnorm, die den Gehalt des GG ändert, und letzterer ist zu ergänzen durch die Zulässigkeit von Weltanschauungsunterricht. Das GG ist nicht einmal im Ansatz kirchlich oder auch nur in irgendeiner Hinsicht religiös oder gar christlich zu nennen. Der religiös-weltanschaulich neutrale Staat muss gleiche Distanz zu allen Religionen und Weltanschauungen halten, darf sich insbesondere mit keiner identifizieren. Er darf keine bevorzugen und keine benachteiligen. Neutralität bedeutet, entsprechend dem allgemeinen Wortverständnis, nichts anderes als Unparteilichkeit, und diese Auffassung ist rechtlich-theoretisch nahezu unbestritten.
Dass sich der Staat in der politischen und rechtlichen Praxis in erheblichem und sehr finanzträchtigem Umfang zugunsten der großen christlichen Kirchen nicht daran hält, ist ein anderes Thema.
Für das islamische Kopftuch bedeutet das: Es gibt allgemein einsehbare Gründe, Trägern staatlicher Ämter wie z. B. Lehrern im Rahmen der Ausübung ihres Amtes das Kopftuch auch bei gegebener Amtseignung generell zu verbieten. Denn diese Kopftücher sind irritierende, im Hinblick auf den Islamismus problematische Zeichen, deren Vereinbarkeit mit der staatlichen Neutralität einer Einzelfallprüfung bedarf und die zudem keine allgemeine Akzeptanz finden. Auf der Grundlage der Basisprinzipien des GG einschließlich des Neutralitätsgebots gibt es aber auch keinen allgemein einsehbaren rationalen Grund, bei Amtsträgern christliche Kleidung oder deutlich sichtbare Kleidungsteile wie die jüdische Kippa zuzulassen. Andernfalls würden die dadurch repräsentierten religiösen Richtungen unzulässig privilegiert, mögen sie auch insgesamt kaum Reibungsflächen mit dem GG aufweisen. (Freilich gilt das keineswegs für alle christlichen und jüdischen Richtungen.)
Wenn islamische Kopftücher generell untersagt werden, so müssen nach allem bei jeder Betrachtungsweise alle deutlichen Zeichen anderer Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften ebenfalls verboten sein. Nur so kann Unparteilichkeit, hier in Form der distanzierenden (ausklammernden) Neutralität, gewahrt werden.
Im Ergebnis gibt es verfassungsrechtlich keine Möglichkeit, das islamische Kopftuch zu verbieten, gleichzeitig aber die – ohnehin neutralitätswidrige – faktische Dominanz des Christentums in der Schule (sei es optisch oder inhaltlich) aufrecht zu erhalten. Mit solchem Dominanzstreben bzw. seiner Duldung untergräbt der Staat seine eigene ideologische Kernbasis und somit seine Identität als „Heimstatt aller Bürger" (BVerfG). Wenn als Ergebnis des Kopftuchstreits die ideologisch zentrale Bedeutung des Neutralitätsgebots endlich verstanden und akzeptiert würde, hätten sich die Auseinandersetzungen mehr als gelohnt. Staat und Gesellschaft würden gerechter, und der Kampf gegen den verfassungsfeindlichen Islamismus könnte ehrlicher und mit mehr Aussicht auf Erfolg geführt werden. Die Muslime könnten und müssten sich als Großgruppe klarer entscheiden, ob sie den Staat mit seiner pluralistischen, aber religionsfreundlichen Basisideologie im allseitigen Interesse akzeptieren, also den Weg in Richtung „Euro-Islam" (Bassam Tibi) gehen wollen oder nicht. Ein Staat, der seine eigenen geistigen Existenzgrundlagen nicht ernst nimmt, kann nicht überzeugen. Die Behandlung der Kopftuchfrage ist eine Frage der staatlich-gesellschaftlichen Reife, der Ehrlichkeit und Gerechtigkeit.