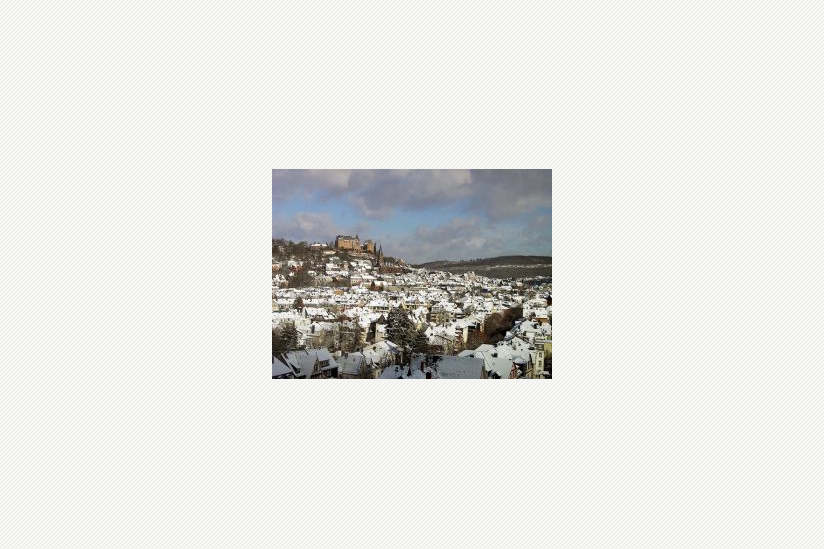MARBURG. (hpd) „Politik ist für das Wohl der Menschen zuständig, Religion für ihr Heil.“ Auf diese Formel brachte Wolfgang Thierse seine Antwort auf die Ausgangsfrage des 13. Marburger Religionsgesprächs: „Wie viel Demokratie braucht Religion, wie viel Religion braucht Demokratie?“
Unter diesem Tagungstitel referierten neben dem Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags auch der evangelische Religionshistoriker Prof. Dr. Christoph Markschies von der Humboldt-Universität (HU) Berlin und der Soziologe Prof. Dr. Johannes Weiß aus Kassel. Gut 300 Interessierte hatten den Weg in die Alte Aula gefunden, wo die gemeinsame Veranstaltung der Fachbereiche Katholische Theologie und Evangelische Theologie der Philipps-Universität sowie der Universitätsstadt Marburg bereits zum 13. Mal in würdigem Rahmen stattfand.
Bei seiner Begrüßung brachte Dekan Prof. Dr. Wolf-Friedrich Schäufele vom Fachbereich Evangelische Theologie die Fragestellungen des Vormittags bereits auf den Punkt. Als Vertreter einer Disziplin, die trotz ihrer Ausrichtung auf eine ganz bestimmte Weltanschauung aus Steuergeldern der Allgemeinheit finanziert wird, müsse er die zunehmende Entfremdung der Menschen von den Kirchen mit Sorge betrachten.
Weniger souverän ging der Moderator Prof. Dr. Dietrich Korsch mit dem Thema um. Für ihn schien völlig außer Frage zu stehen, dass der demokratische Staat nicht ohne Religion als Wertlieferanten auskomme und ohne sie gar nicht entstanden sei.
Markschies hingegen zeigte anhand der eigenen evangelischen Konfession sehr kenntnisreich auf, dass Religion nicht notwendigerweise demokratisch strukturiert sein müsse. Selbst in der Weimarer Republik habe die Mehrheit der evangelischen Christen in Deutschland die Staatsform der Demokratie abgelehnt.
Als Grund dafür machte der einstige Präsident der HU Berlin ein „Revolutionstrauma“ aus: Die Französische Revolution ebenso wie die von 1848 in Deutschland habe die Christen stark verunsichert. Die Weimarer Republik hätten viele ebenfalls als Folge einer Revolution betrachtet. Deswegen seien die Monarchisten auch nach dem Ende des Ersten Weltkriegs in der Kirche weiterhin tonangebend geblieben.
Selbst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs habe sich das nicht gleich geändert. Die vorherrschende Auffassung unter führenden Vertretern der evangelischen Kirche sei seinerzeit gewesen, dass man sich mit der unvermeidbaren Demokratie nun notgedrungenerweise arrangieren müsse. Das habe sogar für Christen gegolten, die die Nazi-Diktatur aus ethischer Überzeugung heraus entschieden abgelehnt hatten.
Allerdings habe sich die Mehrheit der Christen schon früh sehr deutlich für Rechtsstaatlichkeit eingesetzt. Grundlage dafür sei ihre Sicht auf den Menschen als Ebenbild Gottes gewesen, dem eine unveräußerliche Würde innewohne.
Aber erst 1985 habe die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in einer Denkschrift das demokratische Engagement für die Allgemeinheit und den Staat als christliche Pflicht definiert. Auch die innerkirchlichen Strukturen seien erst allmählich demokratisiert worden.
Im Gegensatz dazu habe sich die Kirche in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) schon kurz nach Kriegsende für mehr Demokratie eingesetzt. Allerdings sei die häufigste Forderung dabei die nach Reisefreiheit gewesen.
Dennoch fiel der Vergleich der west- und der ostdeutschen Kirche im Verhältnis zur Demokratie bei Markschies sehr eindeutig aus: „Die Leistung der westdeutschen Kirche war eine schmale Denkschrift; die der ostdeutschen war eine erfolgreiche Demokratiebewegung!"
Die Titelfrage des Ökumenegesprächs beantwortete Markschies sybillinisch: Die Politik brauche ebenso nicht zu viel Religion wie die Religion nicht zu viel Demokratie. Allerdings müssten die Kirchen sich hier selbst beschränken, forderte er. Eine Eingrenzung des kirchlichen Einflusses auf den Staat durch die Politik hält Markschies für problematisch.
Im Anschluss an diesen gelungenen Vortrag hatte der folgende Referent es sicherlich schwer. Weiß begann mit der soziologischen Feststellung, dass wissenschaftliche Vorträge in angelsächsischen Ländern meist mit einem Witz beginnen, wogegen sie in Deutschland mit einer Definition anfangen. Konsequent hielt er sich dann an die deutsche Wissenschaftstradition.
Dabei hatte der Soziologe durchaus interessante Beobachtungen gemacht. So war ihm aufgefallen, dass Kirchenvertreter bei Diskussionen in der Öffentlichkeit sich meist der sogenannten „Werte-Sprache“ bedienen. Unter Begriffe wie Gerechtigkeit, Freiheit oder Ehrlichkeit könne man jedoch sehr unterschiedliche Vorstellungen subsumieren, sodass diese Sprache relativ nebulös werden könne.
Die Politik hingegen bediene sich öfter der religiösen Sprache, merkte Weiß an. So sei beispielsweise oft vom „Schutz der Schöpfung“ die Rede, wenn für Umweltschutz geworben werde. Meist aber benutze die Politik religiöse Sprache und Rituale nach Attentaten, Naturkatastrophen oder anderen Ereignissen, die den Rahmen des normalen Denkens sprengen.
Angesichts der Vereinzelung in der konsumorientierten Massengesellschaft habe sich auch das Verhalten der Menschen zu religiösen Institutionen verändert. Nur noch 15 Prozent der Bundesbürger sind bereit, den Weisungen oder Vorgaben religiöser Instanzen zu folgen. Vielmehr definieren die meisten Kirchenmitglieder ihren Glauben heutzutage ganz individuell.
Für den folgenden Referenten Thierse ist die Religion aber eine Triebfeder zu gesellschaftlichem Engagement. Gläubigen sei der Schutz der Mitmenschen und der sozialen Gerechtigkeit schon wegen der Gottesgleichheit aller Menschen ein wichtiges Anliegen. Denn Glauben dürfe sich nicht in die Innerlichkeit zurückziehen, sondern müsse nach außen wirksam werden.
Allerdings hält Thierse die Religion hier für ein stabilisierendes Element, das dem Einzelnen bei der Entwicklung seiner persönlichen Ethik helfen und ihn vor Gleichgültigkeit oder Korrumpierbarkeit schützen könne. Allerdings dürfe die religiöse Überzeugung dabei nicht andere Haltungen ausgrenzen.
Letztlich sahen alle drei Referenten die Toleranz als wesentliches Element für den Umgang religiös geprägter Menschen mit ihrer Umwelt an. Während Thierse hier aber auch das offene Bekenntnis zur eigenen Religiosität lobte, warnte Weiß gerade vor einer solchen Konfrontation anderer Mitbürger in der - für Andersgläubige oft unverständlichen - religiösen Sprache.
Franz-Josef Hanke