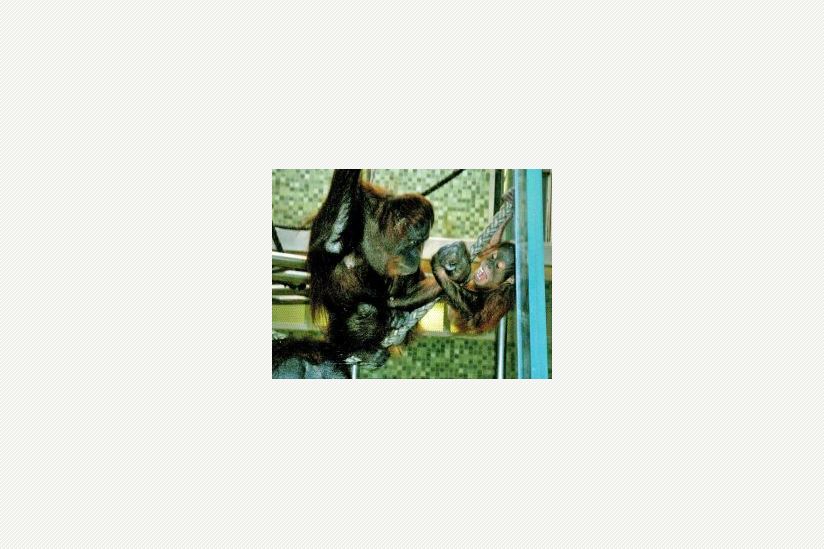BERLIN. (hpd) Die Ähnlichkeit zwischen Menschenaffen und Menschen in Gestik und Mimik ist frappierend. Die Moralisten des Mittelalters schockierte das. Heute amüsiert es eher, wenn Menschen und Gibbons sich gegenseitig im Zoo imitieren. Aber was sagt das über den Grad der Verwandtschaft aus? Diese Fähigkeiten können sich auch jeweils unabhängig voneinander entwickelt haben.
Was also macht den Menschen in dieser Hinsicht einzigartig, und wie kam es dazu? Diesen bis heute unbeantworteten Fragen geht die Primatenforscherin Katja Liebal, seit zwei Jahren Leiterin des Exzellenzclusters "Language of Emotion" am Fachbereich Erziehungswissenschaften und Psychologie der Freien Universität Berlin, nach.
Wir sind alle Primaten. Mensch und Affe haben einen gemeinsamen Vorfahren, der ungefähr dem nachtaktiven insektenfressenden Spitzhörnchen glich, sagt die Wissenschaft. Doch wie nah ist die Verwandtschaft wirklich? 99 Prozent der Gene haben wir bekanntlich mit den Schimpansen gemein, aber auch 70 Prozent mit dem Rettich.
Die 35-jährige Biologin, die seit zehn Jahren ihre Versuche am von Michael Tomasello geleiteten Wolfgang-Köhler-Primaten-Forschungszentrum in Leipzig macht, untersucht nach einer Etappe als Gastprofessorin am Department of Psychology der University of Portsmouth in England mit ihrem Team nun, wie Emotionen Sprache beeinflussen können und ob der Mensch Sprache braucht, um Emotionen auszudrücken.
Ihre vorläufigen Erkentnisse dazu präsentierte sie in Berlin in der Urania. Dabei will die Wissenschaftlerin herausfinden, ob auf dem langen Weg zur Menschwerdung Töne und schließlich die Kombination einzelner Laute die Vorläufer von Sprache waren oder Gesten. Beide Theorien schließen sich, so Katja Liebal, gegenseitig aus. Bei den Grünen Meerkatzen lässt sich immerhin beobachten, dass sie mit unterschiedlichen Lautkombinationen Alarm schlagen, je nachdem, ob sich eine Pythonschlange am Boden, ein Adler aus der Luft oder ein Leopard aus dem Busch oder Baum nähert. Sollte sich aber die Sprache aus Mimik und Gesten entwickelt haben, so setzt das voraus, dass die Primaten sie willentlich einsetzen können und im Laufe des Lebens neue Gesten dazu gewonnen werden können. Da dies beobachtet wurde, scheint dieser zweite Ansatz weiter zu führen.
Vor etwa dreißig Jahren erhoffte man sich eine Antwort auf diese Frage über den Versuch, Menschenaffen Sprache beizubringen, seien es Laute oder Symbole auf einer Computertastatur, erinnert Katja Liebal. Die Versuche mussten letzten Endes aufgegeben werden. Nach jahrelangem Training konnte ein Schimpansenmädchen gerade vier Worte aussprechen. So etwa das Wort „Cup“, Tasse. Dies aber nur, indem es die Finger zu Hilfe nahm, um die Lippe entsprechend zu Formen. Auch in der Gebärdensprache kam man nicht viel weiter. Denn die Schimpansen lernten sie nur, indem man ihnen die Hände zuvor zu der gewünschten Geste formte, also durch Berührung, nicht durch Imitation.
Aber schon da stellte sich eine Einschränkung unseres „zurückgebliebenen Verwandten“ heraus: Affen lernen nur solche Gesten, die Aufforderungen sind, die sich auf die eigene Person beziehen, also ausdrücken, was der Affe selbst möchte oder haben möchte.
Der amerikanische Anthropologe Michael Tomasello hat die Standards dafür gesetzt, was als Gesten gelten kann. Sie müssen gerichtet sein. Sie müssen variiert werden können und sie müssen eine flexible Verwendung haben. Auf 20-35 Gesten ist er je nach Menschenaffenart gestoßen. Nach zehn Jahren Forschungsarbeit am Leipziger Primaten-Forschungszentrum schränkt er den Rahmen der Möglichkeiten, innerhalb derer unsere nächsten Verwandten Gesten einsetzen können, deutlich ein. Sie sind bei den Affen stets sehr handlungsnah und Primaten benutzen keine symbolischen Gesten. Ihre Bedeutung ergibt sich aus der Interaktion im Kontext und sie benutzen keine Zeigegesten. Sie zeigen zwar auf Futter, wenn ihr Pfleger ihr Futter versteckt, aber dies ist bei der natürlichen Interaktion nicht zu beobachten. Die Gesten bleiben in der Regel diadisch, sie werden kaum je referentiell.