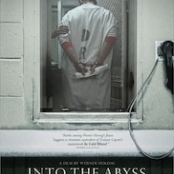BERLIN. (hpd) Der große Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki meinte, die Literatur habe eigentlich nur zwei Themen: “Die Liebe und den Tod”. Diese beiden Gegenpole – Liebe und Tod – sind ständige Begleiter unseres Lebens. Während wir die Sehnsucht nach dem einen äußern, der Liebe stets huldigen, versuchen wir dem Tod in jedweder Weise zu entkommen. Obgleich die Gewissheit wie ein Damokles-Schwert über uns waltet und unser Handeln mitbestimmt, versuchen wir stets, uns diesem Thema zu entziehen. Doch: Gestorben wird immer!
Alan Ball, Drehbuchautor des mit fünf Oscars prämierten Spielfilms “American Beauty”, durchschnitt nun mit einem Hieb den Faden und präsentierte uns im Jahr 2001 eine Serie, die nicht nur messerscharf durch Mark und Bein fährt, sondern in jeglicher Konsequenz dem Leben die Maske vom Gesicht reißt. Und zum Vorschein kommt die ungeschönte Wahrheit, die nirgends anders zu verorten ist als “Six Feet Under” (dt. sechs Fuß unter der Erde).
Der Tod ist in “Six Feet Under – Gestorben wird immer” Autor, Plot, Schauplatz und Hauptdarsteller in Personalunion. Die Familie Fisher ereilt er bereits zu Beginn der ersten Folge – in Form eines tödlichen Verkehrsunfalls des Familienoberhaupts Nathaniel (Richard Jenkins). Er hinterlässt seine Frau Ruth (Frances Conroy), seine beiden Söhne Nate (Peter Krause) und David (Michael C. Hall) sowie seine pubertierende Tochter Claire (Lauren Ambrose).
Dieser unverhoffte Vorfall reißt jeden der Protagonisten aus seinem vermeintlich wohl gestalteten Leben und zerwirft das scheinbar harmonische Familiengefüge: Ruth, die sich mit ihrer Ehe arrangiert hat und nebenbei eine Liebesbeziehung mit ihrem Frisör führte, soll nun wieder der Familie als Mutter dienen. Claire, für die die Welt sowieso schon völlig aus den Fugen geraten ist, versucht sich gerade abzunabeln. Der jüngere Sohn David hat es bisher mit Bravour geschafft, seine Homosexualität und seine Beziehung zu einem Polizisten vor seiner Familie zu verheimlichen. Und nicht zuletzt der älteste Sohn Nate, ein Lebegeist, der sein Glück in der Großstadt versuchte, wird nun bedrängt, das Unternehmen seines Vaters zu übernehmen und zu leiten. Und “natürlich” handelt es sich um ein Bestattungsinstitut.
Jede Folge der Serie beginnt mit einem Todesfall – mal skurril, mal melodramatisch und dann wieder spektakulär. Jeder dieser Fälle landet schließlich auf dem Tisch der Fishers, die – jeder für sich – versuchen, das Leben zu meistern. Den Tod des Vaters hinter sich, den Tod der Fremden um sich und den eigenen Tod vor sich.

Wie trauert man richtig? Inwiefern bedeutet Trauer auch Aufarbeitung, Neuanfang, Aufgabe und Selbstfindung? Wie einem Voyeur, oder etwas wohlmeinender: wie einem Laboranten erschließen sich in diesem Mikrokosmos einer Gesellschaft aber auch neue Fragen. Der Auflösung eines Patriarchats, mit dem sich alle Protagonisten bisher arrangiert haben, können welche Modelle folgen? Wie ordnet sich ein mehr oder weniger laufendes System des Zusammenlebens neu? “Six Feet Under” ist ein Clash der Kulturen, der Generationen, der Geschlechter und birgt eine explosive Mischung.
Wenn in den ersten der fünf Staffeln noch viel schwarzer Humor die Szenerie beherrscht, entwickelt sich “Six Feet Under” zum Ende hin zu einem tiefenpsychologischen Familienepos, in dessen Mittelpunkt mehr und mehr das Zerwürfnis des ältesten Sohnes Nate Fisher steht. Inzwischen selbst Vater, Ehemann und Geliebter lernt er seinen Vater, vielmehr dessen Rolle, erst lange nach dessen Tod immer besser kennen. Und so stellt sich eine neue Frage: Ist der Wunsch, unbedingt nicht wie “die Alten” zu werden, nicht erst recht ein Zwang? Bedeutet Emanzipation nicht auch die Befreiung vom Vergleich mit dem Objekt an sich?
“Six Feet Under” ist Therapie, ist Selbsterfahrung und kann der Beginn einer eigenen Abrechnung sein. Auf jeden Fall ist sie gelebte Trauer – mit all ihren Facetten, Makeln und Chancen. Diese Serie ist ein zutiefst menschliches Meisterwerk – eine Hymne an das Leben. Denn: Gestorben wird immer!
Persönlicher Nachtrag: Als mein Vater viel zu früh verstarb und ich in leichtsinniger und naiver Weise versuchte, dem männlichen Rollenbild während der familiären Trauer zu entsprechen, um meinen vornehmlich weiblichen Familienangehörigen Trost zu spenden – selbstvergessen und arrogant – stauten sich unterdrückte Wut, Trauer und blanke Ohnmacht. Wären da nicht das liebevolle Obdach und die Empfehlung meiner Frau, gerade in dieser Phase verdrängter Trauer gemeinsam die Serie “Six Feet Under” zu sehen, ich hätte mich wohl kaum oder viel zu spät diesem schweren Verlust ergeben, hätte nicht geweint, nicht laut vermisst. Dafür danke ich ihr.
Six Feet Under – Intro:
Informationen zur Serie: moviepilot.de
hbo.com
Six Feet Under – Gestorben wird immer (USA, 2001–2005), Idee: Alan Ball; Darsteller u.a.: Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose, Mathew St. Patrick, Freddy Rodríguez, Rachel Griffiths, Jeremy Sisto, Lily Taylor.
Dieser Artikel ist Teil einer Serie auf hpd.de. An Freitagen werden verschiedene Autoren ihre Lieblingsserien oder -filme vorstellen, die nicht unbedingt aktuell sein müssen, aber (aus humanistischer Perspektive) interessant sein sollten.