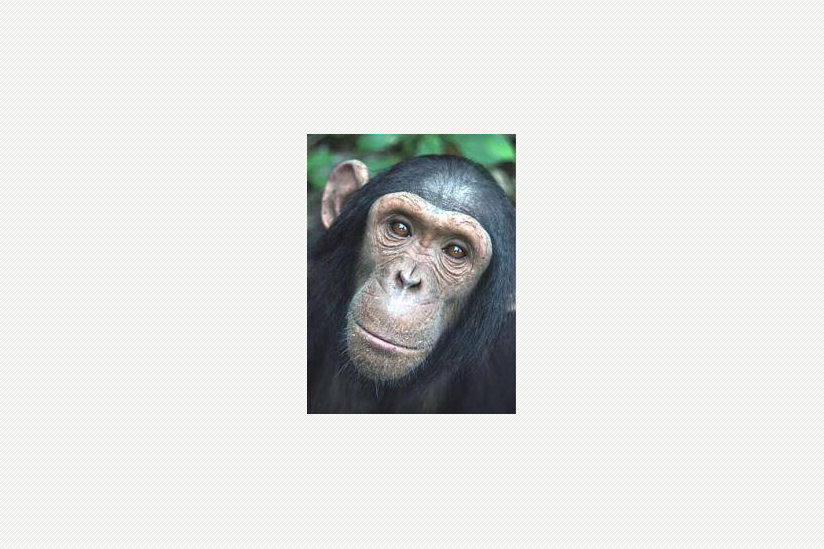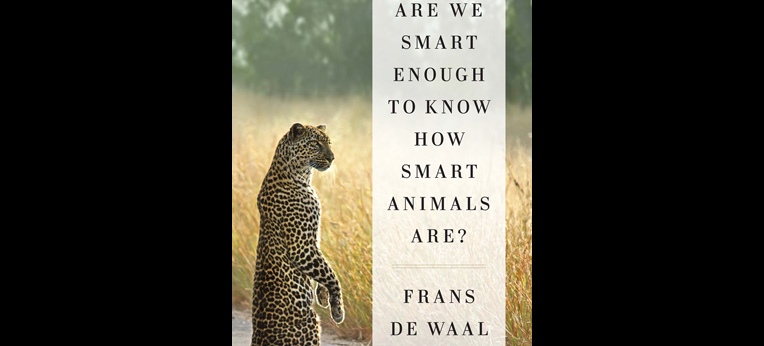Max-Planck-Forscher liefern den experimentellen Beweis, dass Schimpansen Artgenossen „selbstlos" helfen.
Trotzdem ist Altruismus wohl nur eine spezielle Form des Eigennutzes.
LEIPZIG. Was macht einen Schimpansen zum Helfer? Bisher antworteten Verhaltensforscher darauf häufig: der unmittelbare eigene Nutzen. Dass das Bild vom egozentrisch-egoistischen Primaten nicht stimmen kann, haben Untersuchungen von Felix Warneken und Kollegen vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie nun gezeigt: "Wir wollten herausfinden, ob Schimpansen und Kleinkinder helfen, um dafür eine sofortige Belohnung zu erhalten, oder ob sie helfen, weil die andere Person ein Problem hat", sagte Projektleiter Warneken. Das Forscherteam konzipierte Aufgaben für 36 Schimpansen aus dem Ngamba Schutzgebiet in Uganda und führte diese gleichzeitig mit einer Gruppe von 36 Kleinkindern durch. "Sowohl Kinder als auch Schimpansen halfen, unabhängig davon, ob ihnen daraus ein Vorteil erwuchs oder nicht", fasste Warneken die Ergebnisse zusammen.
Hilfe auch ohne Belohnung
In der ersten Aufgabe sah der Schimpanse zu, wie eine unbekannte Person sich vergeblich bemüht, nach einem Stock zu greifen. Der Stock war außerhalb der Reichweite des Menschen, befand sich aber in Reichweite des Schimpansen. Nach seinen verzweifelten Versuchen nahm der Mensch Blickkontakt mit den Affen auf. 12 von 18 Schimpansen hoben den Stock daraufhin auf und reichten ihn weiter, obwohl sie keine Belohnung dafür erhielten. Auch 16 von 18 Kindern halfen selbstlos der Person, indem sie ihr den Gegenstand gaben. Wichtig war aber offenbar der Faktor Hilflosigkeit. "Wenn der Gegenstand außer Reichweite war, die betroffene Person aber gar nicht versuchte, ihn aufzuheben, so boten Schimpansen und Kinder dem Gegenüber den Gegenstand auch nicht an", führte Warneken aus. Offensichtlich helfen sowohl Affen als auch Kleinkinder nur in Problemsituationen. Für beide gilt: Sie sind in der Lage zu erkennen, wann jemand Hilfe benötigt, und helfen dann ohne unmittelbaren Eigennutz - in der vorliegenden Studie bis zu zehnmal hintereinander. Verblüffend war auch, dass eine Belohnung die Helfer-Rate nicht weiter erhöhte.
Natürliche Hilfsbereitschaft
Ein anderer Versuchsaufbau, bei dem die Schimpansen keinem Menschen, sondern einem Artgenossen Hilfe zukommen lassen konnten, sah wie folgt aus: Futter wurde hinter einer Tür platziert, die versperrt war. Ein Affe stand vor der Tür, konnte sie aber nicht öffnen. Der potenzielle Helfer war in einem anderen Käfig ohne Zugang zum Futter, konnte aber dem Artgenossen die Tür zum Futter öffnen. Dabei zeigte sich, dass knapp 80 Prozent der potenziellen Helfer ihren Artgenossen die Tür öffneten und ihnen damit Zugang zum Futter verschafften, obwohl sie selbst leer ausgingen. "Wir konnten nicht einmal beobachten, dass die Helfer den Begünstigten um Futter anbettelten oder ihn einschüchterten", sagte Warneken. Die Studie liefere den Beweis, hieß es in der Presseerklärung des Max-Planck-Instituts, „dass unsere nahen Verwandten auch altruistisch handeln und bereits Kleinkinder dies tun." Warneken selbst zog folgendes Resümee: „Wir sollten uns von der Idee verabschieden, dass wir als Egoisten auf die Welt kommen und allein durch Kultur und Erziehung zu hilfsbereiten Wesen heranwachsen."
„Wie du mir, so ich dir"
Letzterem darf man, sofern man den Begriff „Egoist" sehr eng fast, darunter also ausschließlich einen „egozentrischen Egoisten" versteht, getrost zustimmen. Verwunderlich ist allerdings, dass die Pressestelle des Max-Planck-Instituts den Anschein erweckte, Warnekens Forschungsergebnisse würden eine völlig neue Perspektive eröffnen. Dem ist ganz sicher nicht so. So interessant die Forschungsergebnisse Warnekens zweifellos auch sind, sie stehen keineswegs im Widerspruch zu den gängigen Theorien zur Evolution altruistischen Verhaltens, vielmehr liefern sie diesen Theorien experimentelle Bestätigungen. Dass sozial intelligente Lebewesen wie Schimpansen eben nicht nur den unmittelbaren Vorteil einer Handlung einkalkulieren, sondern auch längerfristige Verhaltensstrategien verfolgen, sollte eigentlich klar sein. Schimpansen verfahren dabei häufig nach dem Reziprozitätsprinzip („Wie du mir, so ich dir!"). Langfristiger Vorteil: Wer anderen aus einer Notlage hilft, steigert die Chancen, dass er selbst in einer ähnlichen Lage Hilfe erhält. Der Selektionsvorteil eines solchen eigennützig-altruistischen Verhaltens wurde bereits vor Jahrzehnten im Rahmen spieltheoretischer Modelle demonstriert. Insofern belegen Warnekens Untersuchungen an einem interessanten Praxisbeispiel, was theoretisch ohnehin zu erwarten gewesen wäre.
Das Geheimnis der Spiegelneuronen
Auch aus neurophysiologischer Sicht sind die Forschungsergebnisse des Max-Planck-Forschers keineswegs erstaunlich. Denn schon 1996 wurde bei Primaten die Existenz so genannter „Spiegelneuronen" nachgewiesen. Diese Neuronen werden bei der Beobachtung Anderer aktiv, sie simulieren gewissermaßen die hirnphysiologischen Vorgänge, die stattfinden würden, wenn das Individuum von einer beobachteten Aktion (beispielsweise dem Zufügen von Schmerz) selbst betroffen wäre. Dank dieser hirnphysiologischen Ausstattung sind unsere nächsten tierlichen Verwandten - wohl in etwas geringerem Maße als wir, aber doch hinreichend - in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen. Mitgefühl, Mitleid und Mitfreude sind also keine exklusiven Eigenschaften von homo sapiens. Dass „mitfühlende Schimpansen" unter geeigneten Bedingungen auch Formen von Hilfsbereitschaft zeigen, sollte von daher niemanden verwundern.
Altruisten: die clevereren Egoisten
„Selbstlos", wie es in der Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts hieß, sind die Schimpansen deshalb aber keineswegs. Eine solch komplexe Fähigkeit wie die Fähigkeit zu emotionaler Perspektivübernahme hat sich evolutionär nur unter der Voraussetzung entwickeln können, dass sie mit klaren Selektionsvorteilen verbunden, also genetisch eigennützig war. Eine scharfe Gegenüberstellung von Altruismus und Egoismus, wie sie sich im Text des Max-Planck-Instituts widerspiegelt, ist aus evolutionärer Perspektive also unsinnig. Vielmehr lässt sich zeigen, dass Altruisten - sofern sie ihre Hilfsbereitschaft nicht übertreiben - im Spiel des Lebens die clevereren Egoisten sind. Wer nämlich anderen niemals hilft, wer sie vielleicht sogar regelmäßig übervorteilt, der wird sozial schnell isoliert und steht am Ende schlechter da als kooperationsbereite Artgenossen. Das gilt für Schimpansen offenbar in ähnlicher Weise wie für Menschen.
Halten wir fest: Warnekens Forschungsergebnisse stellen das biologische Eigennutzprinzip keineswegs in Frage, sie demonstrieren vielmehr, dass dieses Prinzip auch im Falle der Menschenaffen sehr viel differenzierter begriffen werden muss, als dies gemeinhin geschieht. Die Unterschiede zwischen Menschen und Menschenaffen sind auf jeden Fall geringer, als viele meinen. Dies mit interessanten neuen Daten empirisch belegt zu haben, ist vielleicht das größte Verdienst der Leipziger Verhaltensforscher.
Michael Schmidt-Salomon