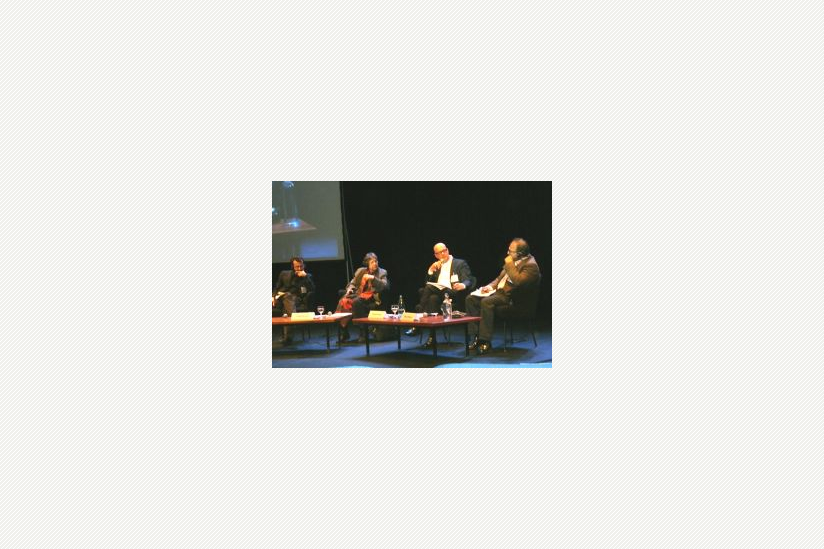BERLIN. (hpd) Intellektuelle aus dem Nahen und Mittleren Osten erörtern im Haus der Kulturen der Welt den „Code des Religiösen“. In Zeiten des Kalten Krieges und vor dem 11. September kämpften Papst und Bin Laden noch Seite an Seite, so drastisch formuliert es Fadi Bardawil in der Diskussionsrunde im Rahmen der Debattenreihe „9/11: Politik, Sprache, Bilder im 21. Jahrhundert“. Doch was passierte dann, darauf konzentriert sich die Auseinandersetzung, und was seit dem 11. September?
 Fadi Bardawil, in Beirut geboren, Anthropologe und Fellow des Berliner Forschungsprogramms „Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa“, zeigt sich auf der Veranstaltung unter dem Motto „Zehn Jahre 9/11“ im Rahmen der Reihe „Forum Berlin“ im Haus der Kulturen der Welt überzeugt, dass die sogenannten islamischen Revolutionen der Vergangenheit „kein Oxymoron“ sind, kein in sich widersprüchlicher Begriff. Ihnen vorausgegangen waren Erschöpfungserscheinungen der nationalen Bewegungen im Nahen Osten, Massenrevolutionen in den Siebzigern, sowjetische Interventionen und die Friedensvereinbarungen zwischen Israel und Jordanien. Die 80-iger und 90-iger Jahren brachten den Menschen dann aber keine neue ideologische Alternative und auch nicht mehr Wohlstand. Es waren vor allem eine Reihe politischer Fakten, die zur Politisierung der Religion führten. Sie füllte ein Vakuum, das sich also politisch, ökonomisch und psychologisch erklären lässt, und, man ahnt, dem auch nur so zu begegnen ist. Die Frage, ob dem Islam selbst ein politischer Anspruch innewohnt, bleibt an diesem Tag peinlich bemüht draußen vor.
Fadi Bardawil, in Beirut geboren, Anthropologe und Fellow des Berliner Forschungsprogramms „Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa“, zeigt sich auf der Veranstaltung unter dem Motto „Zehn Jahre 9/11“ im Rahmen der Reihe „Forum Berlin“ im Haus der Kulturen der Welt überzeugt, dass die sogenannten islamischen Revolutionen der Vergangenheit „kein Oxymoron“ sind, kein in sich widersprüchlicher Begriff. Ihnen vorausgegangen waren Erschöpfungserscheinungen der nationalen Bewegungen im Nahen Osten, Massenrevolutionen in den Siebzigern, sowjetische Interventionen und die Friedensvereinbarungen zwischen Israel und Jordanien. Die 80-iger und 90-iger Jahren brachten den Menschen dann aber keine neue ideologische Alternative und auch nicht mehr Wohlstand. Es waren vor allem eine Reihe politischer Fakten, die zur Politisierung der Religion führten. Sie füllte ein Vakuum, das sich also politisch, ökonomisch und psychologisch erklären lässt, und, man ahnt, dem auch nur so zu begegnen ist. Die Frage, ob dem Islam selbst ein politischer Anspruch innewohnt, bleibt an diesem Tag peinlich bemüht draußen vor.
 Manan Ahmed, Juniorprofessor für Islamstudien in Süd- und Südostasien an der Berlin Graduate School, will Entwicklungen im Osten nicht unabhängig von denen in der westlichen Welt sehen. Er nimmt die religiöse Sprache und Ikonografie des Westens ins Visier. Hatte nicht George W. Bush selbst seinen Irak-Krieg damit legitimiert, „dass ihn Gott instruiert habe“? Manan Ahmed kritisiert kühl und doch vehement eine Geographie, die einen Teil der Welt für religiös, den anderen für säkular hält. Zum Kapitel der „religiösen Ikonografie“, und zwar jener, mit der im Westen operiert wird, meint er, gehören von US-amerikanischen Drohnen übertragene Aufnahmen, auf denen betende Dörfler gezeigt werden, die deshalb Taliban sein sollen, also zum politischen Feind werden. Aus Pakistan weiß Manan Ahmed zu berichten, dass alle religiöse Parteien zusammen bis 2004, bevor in Ahmeds Heimatstadt Lahore unter Perves Musharraf, der zur Kooperation mit den USA praktisch genötigt wurde, ein Sufi-Schrein bombadiert wurde, nicht mehr als 7 bis 8 Prozent der Wählerstimmen für sich verbuchen konnten. Ist also die politische Meinung im Orient eigentlich gar nicht so religiös motiviert, wie wir denken? Operiert vielmehr der Westen nur mit Vorliebe mit der Kategorie des Religiösen zur Legitimierung seine Politik? Vom Iran sprach an diesem Sommernachmittag in Berlin keiner.
Manan Ahmed, Juniorprofessor für Islamstudien in Süd- und Südostasien an der Berlin Graduate School, will Entwicklungen im Osten nicht unabhängig von denen in der westlichen Welt sehen. Er nimmt die religiöse Sprache und Ikonografie des Westens ins Visier. Hatte nicht George W. Bush selbst seinen Irak-Krieg damit legitimiert, „dass ihn Gott instruiert habe“? Manan Ahmed kritisiert kühl und doch vehement eine Geographie, die einen Teil der Welt für religiös, den anderen für säkular hält. Zum Kapitel der „religiösen Ikonografie“, und zwar jener, mit der im Westen operiert wird, meint er, gehören von US-amerikanischen Drohnen übertragene Aufnahmen, auf denen betende Dörfler gezeigt werden, die deshalb Taliban sein sollen, also zum politischen Feind werden. Aus Pakistan weiß Manan Ahmed zu berichten, dass alle religiöse Parteien zusammen bis 2004, bevor in Ahmeds Heimatstadt Lahore unter Perves Musharraf, der zur Kooperation mit den USA praktisch genötigt wurde, ein Sufi-Schrein bombadiert wurde, nicht mehr als 7 bis 8 Prozent der Wählerstimmen für sich verbuchen konnten. Ist also die politische Meinung im Orient eigentlich gar nicht so religiös motiviert, wie wir denken? Operiert vielmehr der Westen nur mit Vorliebe mit der Kategorie des Religiösen zur Legitimierung seine Politik? Vom Iran sprach an diesem Sommernachmittag in Berlin keiner.
Trendwende von der Ideologie zur Religion
Doch womit sind die Phänomene auf einen Begriff zu bringen? Bardawil, der die Religion lediglich als eine Art kulturellen Unterbau sehen will, zitiert die Trendwende weg von der Ideologie, an deren Stelle nun seit Samuel Phillips Huntingtons Buch vom „Clash of Civilazations“ angeblich verschiedene Kulturen die Welt politisch spalten. Die neue Zweiteilung arbeitet vor allem mit Bildern - auf Titelseiten. Es fehlen ihr die Geschichten, die den Blick differenzierter machen würden, urteilt Maman Ahmed.
 Heute beschäftigen sich die bedeutendsten Führer der Welt und Staatsmänner mit den Frauen in der islamischen Welt und dem Islam, wundert sich Leila Ahmed, Professorin für „Women´s Studies in Religion“ an der Harvard Divinity School. Burka und Hijab werden zur Staatsangelegenheit für westliche Länder, was vorher höchstens in Ländern wie Saudi-Arabien dar Fall war. „Die Burka“ entwickelt sich zum Kampfwort für den Krieg in Afghanistan. In Folge gerät dann der Islam der Migranten in den Fokus. Warum nicht die im Christentum unterdrückten Frauen in Nigeria oder Argentinien?, fragt Leila Ahmed. Und ist der Schleier überhaupt heute noch ein in erster Linie ein religiöses Symbol? Ihrer Meinung nach nicht mehr. Oft habe sie von jungen Frauen gehört, dass sie ihn tragen, um auf sexistische Praktiken in ihrer Gesellschaft aufmerksam zu machen. Leila Ahmed misst dem Schleier etwa die Bedeutung zu, wie sie der Afro-Look in den siebziger Jahren hatte. Als Praxis von Frauen einer Minderheit, von ihrem Recht auf Meinungsäußerung Gebrauch zu machen. Auf sehr ikonografische Weise, möchte man hinzufügen – indem sie sich selbst zur Ikone stilisieren.
Heute beschäftigen sich die bedeutendsten Führer der Welt und Staatsmänner mit den Frauen in der islamischen Welt und dem Islam, wundert sich Leila Ahmed, Professorin für „Women´s Studies in Religion“ an der Harvard Divinity School. Burka und Hijab werden zur Staatsangelegenheit für westliche Länder, was vorher höchstens in Ländern wie Saudi-Arabien dar Fall war. „Die Burka“ entwickelt sich zum Kampfwort für den Krieg in Afghanistan. In Folge gerät dann der Islam der Migranten in den Fokus. Warum nicht die im Christentum unterdrückten Frauen in Nigeria oder Argentinien?, fragt Leila Ahmed. Und ist der Schleier überhaupt heute noch ein in erster Linie ein religiöses Symbol? Ihrer Meinung nach nicht mehr. Oft habe sie von jungen Frauen gehört, dass sie ihn tragen, um auf sexistische Praktiken in ihrer Gesellschaft aufmerksam zu machen. Leila Ahmed misst dem Schleier etwa die Bedeutung zu, wie sie der Afro-Look in den siebziger Jahren hatte. Als Praxis von Frauen einer Minderheit, von ihrem Recht auf Meinungsäußerung Gebrauch zu machen. Auf sehr ikonografische Weise, möchte man hinzufügen – indem sie sich selbst zur Ikone stilisieren.
„Arabischer Frühling“
Der Nordamerika-Spezialist der Süddeutschen Zeitung und Moderator der Debatte, Andrian Kreye, konstatiert im Westen wie im Osten die übereinstimmende Tendenz, jegliche Utopie durch die Neigung zur religiösen Apokalypse zu ersetzen. Das, so Leila Ahmed, habe es in den USA durchaus schon einmal gegeben, als man die Mormonen bekämpfte, und zwar weil man sie als Herätiker empfand, also aus immanent religiöser Perspektive. Die in Kairo geborene Grand Old Lady unter den Gelehrten des Nahen und Mittleren Ostens sieht im Übrigen mit dem arabischen Frühling den Höhepunkt des Islamismus schon überschritten. Das könnte beruhigen.
Die intellektuelle Elite des Orients ist bestrebt, die Macht des Religiösen zu entzaubern, indem man sie erklärt. Dies ist seit jeher ein durchaus aufklärerisches Unterfangen. Betitelte nicht schon Goethe im west-östlichen Divan ein Gedicht „Offenbar Geheimnis“. Und das Volk? Es grillt vor dem Haus der Kulturen der Welt. Manche verschleierte Mutter schiebt vorsichtig ihren Kinderwagen näher, studiert das Programmheft auf der Bank – und bleibt draußen.
Simone Guski