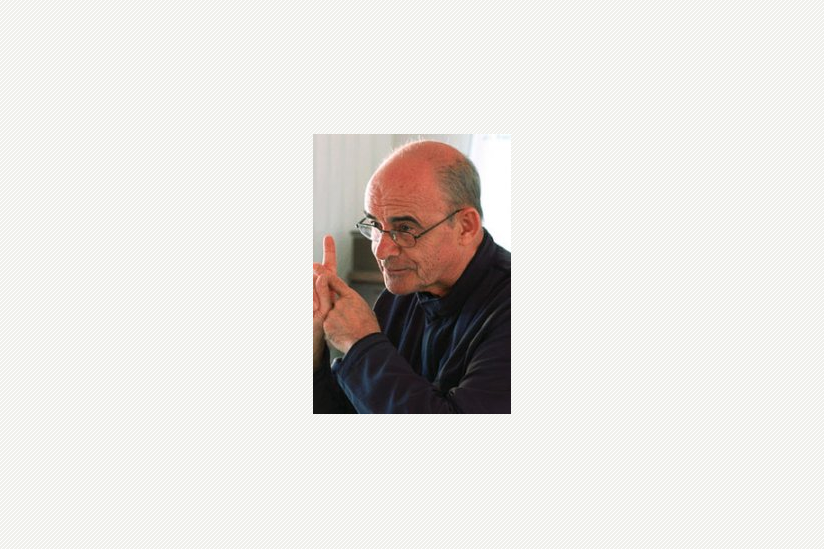(hpd) Jean-Luc Nancy untersucht mit strukturalistischer Methode das Christentum. Er analysiert so, wie im Christentum sein eigenes Ende immer bereits angelegt war, und das, was an seine Stelle zu setzen ist, sogar in ihm selbst seit langem im Begriff ist.
Nichts ist bloß, was es ist, immer schon enthalten sind in ihm: ein Überschuss bis hin zum Gegenteil. Da ist zum einen das Universum, das sich aus Elementen und Dimensionen zusammensetzt. Und da ist die Welt der Sprache, die einerseits aus dem Benennen entsteht und andererseits in sich unendliche Bezugsmöglichkeiten enthält. Sie ist nie abgeschlossen. Die Sprache kann nicht vollständig benennen, was sein kann. Nicht einmal das, was ist. Dazu gibt es verschiedene Sprachen. Je nach dem wovon man spricht.
 Und da ist die Frage, wie wir miteinander und der Welt umgehen sollen. Aber wie beziehen wir die physikalische Welt, Sprache und Werte aufeinander, wie lassen sich also Normen begründen? Da scheint sich ein Abgrund aufzutun. Diese Brüche spürten schon Generationen der Menschheit. Darin kann man den Ursprung der Religionen sehen. Die Religionen rangen um ein Begründungsproblem, das ist die These des französischen Philosophen Jean-Luc Nancy in seiner Essay-Sammlung „Dekonstruktion des Christentums“, zu der gerade der zweite Band „Die Anbetung“ erschienen ist.
Und da ist die Frage, wie wir miteinander und der Welt umgehen sollen. Aber wie beziehen wir die physikalische Welt, Sprache und Werte aufeinander, wie lassen sich also Normen begründen? Da scheint sich ein Abgrund aufzutun. Diese Brüche spürten schon Generationen der Menschheit. Darin kann man den Ursprung der Religionen sehen. Die Religionen rangen um ein Begründungsproblem, das ist die These des französischen Philosophen Jean-Luc Nancy in seiner Essay-Sammlung „Dekonstruktion des Christentums“, zu der gerade der zweite Band „Die Anbetung“ erschienen ist.
Die Wissenschaft zeigt uns, wie unabgeschlossen unsere Welt selbst ist. Heute lernen wir jedes Individuum, alles Leben als offen zu anderen Lebewesen zu begreifen, als abhängig von seiner Umwelt. Wir staunen immer mehr, wie es zu den mannigfaltigen Formen des Austausches kommt. Den Rändern und Leerstellen kommt eine entscheidende Bedeutung zu.
Nancy interpretiert die Religionen als ein Ahnen davon. Sie sind so wenig endgültig für Nancy wie alles, was ist. Dabei sagt er: „Warum soll man vom Christentum sprechen? Eigentlich möchte ich davon so wenig wie möglich sprechen.“ Er tut es doch ausführlich. Das Christentum ist tot, zitiert er frei nach Nietzsche, weil es die Welt zu einer letztendlich abgeschlossenen gemacht hat. Als von einem zureichenden Grund, das heißt letzten Ursache abhängig. Es entstand als Pendant ein hierarchisches System, das für jeder Frage eine Antwort bereitstellte. Damit gedieh in ihm auch das, was Nancy das „Böse“ nennt, denn dieses beginnt mit der Festlegung bis hin zu dem Urteil, was zu sein und vor allem was nicht zu sein hat, gar infolgedessen kein Recht auf Existenz hat. Dieser Prozess ist dem Christentum genauso immanent wie seine Überwindung. Schließlich deutet die Dreifaltigeit schon auf die Bezüglichkeit hin und ein Gott, der in seinem eigenen Sohn auf Erden stirbt, auf seine Immanenz.
Nancy versucht demgegenüber, eine Moral aus der doch auch in den Religionen gerade von ihren Außenseitern immer wieder geahnten strukturellen Offenheit der Welt heraus zu begründen. Aus der Ratlosigkeit, weil keiner einen direkten Draht zu einem Letztbegründenden hat. Aus der unbeantworteten Frage heraus. Was für Nancy davon gültig bleibt, ist eine Moral der Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit in der Tradition der Französischen Revolution. Gleichheit, weil keiner sagen könnte, dass ihm die Antworten auf seine Fragen zugekommen wären. Freiheit, weil keiner vor dem anderen beanspruchen könne, für die anderen sprechen zu können. Brüderlichkeit, weil wir alle gleich erst denkend einmal allein sind. Gerechtigkeit kann und muss dann heißen: jeder hat das Recht zu sprechen und gehört zu werden.
Religion schöpfe aus einem Trieb zur Überschreitung, über sich hinauszugehen, einem Streben, einer Bemühung, aus dem die Tugend entstand. In seiner Bereitschaft zur Hingabe ist dieser Trieb eine Sucht.
Anstelle der Anbetung, einer altbekannten Haltung, nicht nur des Christentums, kann heute, soll nicht die Sucht im vielfältigsten Sinne allein bleiben, für die Nancy die Menschen unserer Gesellschaft für so anfällig wie nie zuvor hält, nach ihm nur ein in jener Anbetung bereits vorgezeichnetes Offensein in einer Welt unendlicher Bezugsmöglichkeiten treten. Es entspricht – im wörtlichen Sinne – das heißt antwortet einer prinzipiellen Offenheit oder Unabgeschlossenheit der Welt, wie sie schließlich die Systemtheoretiker wie Humberto Maturana – Nancy erwähnt sie nie explizit! – gedacht und bezeichnet haben.
Nancy dekliniert schließlich das ganze Vokabular der Mystik durch, als Haltungen, die ihre Bedeutung haben, aber nur auf diese Welt bezogen, deren Sinn selbst gefunden werden muss und dann doch nie abschließend gefunden werden kann. Was bleibt, ist Aufmerksamkeit. Und damit viel Schweigen. Denn nach Nancy ist diese Welt per se selbst abgründig, weil alles ein „Zwischen“ ist, und sie hat die ureigene Tendenz, ständig über sich hinauszugehen. Das Andere öffnet sich in jedem Augenblick im Leben selbst.
Entwickelt wird dies anhand der Sprache, Nancy ist ein sehr literarischer Philosoph. Er untersucht und spielt mit Sprache. Dabei wendet er die Wörter um und um. Gleichzeitig denkt er noch einmal ganz in der Tradition der Existenzialisten. Aber er ist genauso mit dem derzeitigen Stand der Philosophie und Wissenschaften vertraut wie mit der Geschichte. Dass diese auch rückwärts betrachtet offen gehalten wird, ist nur eine logische Konsequenz seines Denkansatzes. Nichts ist, was es ist, immer ein Stückchen mehr, das meint der strukturalistische Ansatz, in dem die Differenz zum Prinzip erhoben wird. Nancy hat ihn konsequent auf das Christentum angewendet. Und diese Differenz, das, woran es sich gerieben hat, zum Vorschein gebracht.
Simone Guski
Jean-Luc Nancy: „Die Anbetung. Dekonstruktion des Christentums 2“, diaphanes Verlag, Zürich 2012, 160 Seiten, 19,95 Euro.