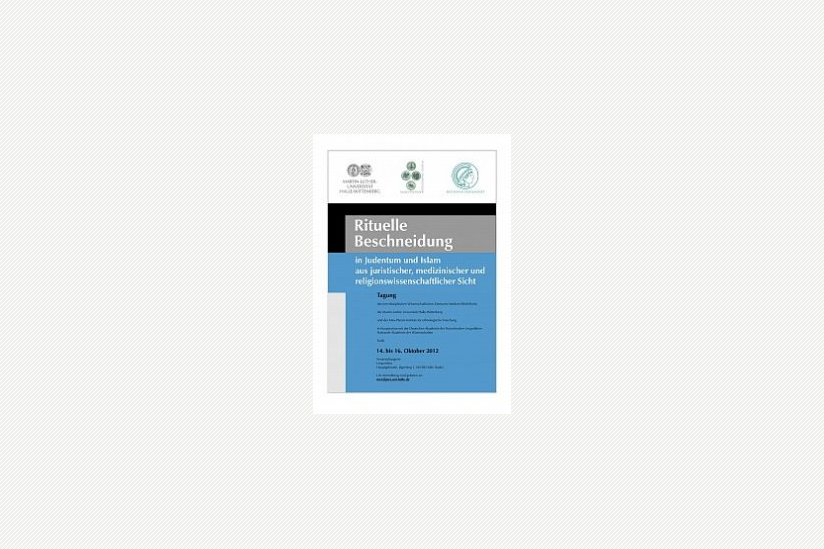HALLE. (hpd) Einen sachlichen Beitrag zur Debatte zu leisten, das war der selbst erklärte Anspruch der Organisatoren der Tagung "Rituelle Beschneidung in Judentum und Islam aus juristischer, medizinischer und religionswissenschaftlicher Sicht", die vom 14. bis 16. Oktober in Halle stattfand.
Unter dem Dach des Interdisziplinären Wissenschaftlichen Zentrums "Medizin-Ethik-Recht" (IWZ) der Martin-Luther-Universität (MLU) wurden 14 Vortragende unterschiedlicher Provenienz in die Nationalen Akademie der Wissenschaften "Leopoldina" eingeladen, um vor einem größtenteils universitärem Publikum, die eigenen Standpunkte zur Diskussion zu stellen. Die erklärbare Eile der Vorbereitung brachte manch Defizit in der Öffentlichkeitsarbeit mit. Die Tagung fand in der örtlichen Presselandschaft bisher keine Erwähnung.
Spannend aus humanistischer Sicht war die zu erwartende Diskursfähigkeit der Teilnehmer. Für die weitere Entwicklung der bundesweiten Diskussion ist es notwendig, die Gründe zu verstehen, warum intellektuelle und auch emotional unverdächtige Menschen bei dem Thema der Beschneidung häufig aus einer religiösen Betroffenheit heraus keine ergebnisoffene Diskussion führen. Eine Erfahrung, die sich bitter durch die letzten Wochen zieht.
Eröffnet wurde die Tagung am Sonntag durch den sachsen-anhaltinischen Staatsekretär Marco Tullner. Eine (un)gewollte Einstimmung auf die Debattenperspektive in Deutschland leisteten sich die Organisatoren mit der nach folgenden Musikaufführung und mündlichen Einführung der "Kantate zum Fest der Beschneidung Christi" von J. S. Bach (BWV 248, Teil 4).
In der Folge wird nicht auf alle Referate eingegangen werden können. Das erste Referat vom Sonntag über die theologische Begründung der Beschneidung in der hebräischen Bibel zählt hierzu ebenso, wie ein späterer Vortrag über die medizinischen Techniken der Zirkumzision und die Ausführungen des Rabbiners der Jüdischen Gemeinde Berlin, Tovia Ben-Chorin über die jüdische Beschneidung. Aus ihnen ging kein nennenswerter Kenntnisgewinn hervor.
Der Montag wurde mit einem Grußwort der Präsidentin der Landesärztekammer, Dr. med. Simone Heinemann-Meerz eröffnet. Sie zielte vor allem daraufhin, dass ein medizinischer Eingriff ausschließlich von approbierten Ärzten zu erfolgen habe. Ihre Worte "Befragen Sie für potentielle Nebenwirkungen aber bitte auch die Ärzte!" sollte dann auch eine der Klammern der Veranstaltung bilden. An diesem Tage folgten neun weitere, halbstündige Vorträge, die mit einer jeweiligen kurzen Diskussion abgeschlossen wurden.
 Den Anfang machte Prof. Dr. iur. Hans Lilie vom Lehrstuhl für Strafrecht an der MLU mit "Vom Flügelschlag eines Schmetterlings zum Sturm - vom Landgericht Köln zu der Debatte um die Beschneidung". Als Direktor des IWZ gehörte er zu den Mitorganisatoren der Tagung. Er klassifizierte das Urteil des Landgerichtes Köln als nicht präjudizierend für Deutschland. Auch wenn seiner Meinung nach das Landgericht "jegliches Fingerspitzengefühl" vermissen hat lassen, so sei es unstrittig, dass strafrechtlich die Beschneidung Körperverletzung sei. Es bedarf schon einer erheblichen Rechtfertigung für diesen Eingriff, der mit seiner, wenn auch im vorliegenden Gesetzesentwurf versteckten religiösen Begründung, sofort eine Grundrechtsdebatte nach sich ziehe. Eine Debatte eben darum sei noch lange nicht zu Ende. Der Entwurf der Regierung leide zudem an drei Schwächen. Die Rede von der "ärztlichen Kunst" kaschiere, dass es immer nur um medizinische Standards gehen könne. Die Aufforderung, dass Eltern sich mit dem Kindeswohl auseinandersetzen müssen, sei viel zu schwammig und die 6-Moantefrist für die Einsetzung jüdischer Mohels werfe u. a. die Frage nach einer eigentlich notwendigen Dokumentationspflicht auf. Im Übrigen verstößt eben auch das Heilpraktikergesetzes gegen medizinische Standards.
Den Anfang machte Prof. Dr. iur. Hans Lilie vom Lehrstuhl für Strafrecht an der MLU mit "Vom Flügelschlag eines Schmetterlings zum Sturm - vom Landgericht Köln zu der Debatte um die Beschneidung". Als Direktor des IWZ gehörte er zu den Mitorganisatoren der Tagung. Er klassifizierte das Urteil des Landgerichtes Köln als nicht präjudizierend für Deutschland. Auch wenn seiner Meinung nach das Landgericht "jegliches Fingerspitzengefühl" vermissen hat lassen, so sei es unstrittig, dass strafrechtlich die Beschneidung Körperverletzung sei. Es bedarf schon einer erheblichen Rechtfertigung für diesen Eingriff, der mit seiner, wenn auch im vorliegenden Gesetzesentwurf versteckten religiösen Begründung, sofort eine Grundrechtsdebatte nach sich ziehe. Eine Debatte eben darum sei noch lange nicht zu Ende. Der Entwurf der Regierung leide zudem an drei Schwächen. Die Rede von der "ärztlichen Kunst" kaschiere, dass es immer nur um medizinische Standards gehen könne. Die Aufforderung, dass Eltern sich mit dem Kindeswohl auseinandersetzen müssen, sei viel zu schwammig und die 6-Moantefrist für die Einsetzung jüdischer Mohels werfe u. a. die Frage nach einer eigentlich notwendigen Dokumentationspflicht auf. Im Übrigen verstößt eben auch das Heilpraktikergesetzes gegen medizinische Standards.
 Im weiteren Verlauf des Tages kamen weitere Juristen mit zu Wort. Prof. Dr. iur. Günter Jerouschek vom Lehrstuhl für Strafrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena legte mit klaren Worten dar, das wir uns an einem juristischem Scheideweg befänden. Wem schenken wir unsere Empathie? Dem Kind und dessen körperlicher Unversehrtheit oder den Eltern und deren Religionsfreiheit? Für Jerouschek, der sich als Jurist und Psychoanalytiker seit 2005 mit diesem Thema befasst, sei die Seite des Kindes eindeutig zu bevorzugen. Denn im Kontext einer psychoanalytischen Perspektive verwundere es auch gar nicht, dass die Risiken klein und die positiven Aspekte groß geredet werden. Diese Strategie entspreche der Verleugnung und Marginalisierung von erlittenem Schmerzen, Traumata und Störungen.
Im weiteren Verlauf des Tages kamen weitere Juristen mit zu Wort. Prof. Dr. iur. Günter Jerouschek vom Lehrstuhl für Strafrecht an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena legte mit klaren Worten dar, das wir uns an einem juristischem Scheideweg befänden. Wem schenken wir unsere Empathie? Dem Kind und dessen körperlicher Unversehrtheit oder den Eltern und deren Religionsfreiheit? Für Jerouschek, der sich als Jurist und Psychoanalytiker seit 2005 mit diesem Thema befasst, sei die Seite des Kindes eindeutig zu bevorzugen. Denn im Kontext einer psychoanalytischen Perspektive verwundere es auch gar nicht, dass die Risiken klein und die positiven Aspekte groß geredet werden. Diese Strategie entspreche der Verleugnung und Marginalisierung von erlittenem Schmerzen, Traumata und Störungen.
Ihm folgte direkt Prof. Dr. Michael Germann vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der MLU. Er wies daraufhin, dass sämtliche juristischen Diskurse irgendwann verfassungsrechtlich relevant werden. Dabei ist dann eine verfassungsrechtliche Dogmatik wichtig. Deren Rahmen dürfe man nicht verlassen.
 Er führte aus, dass Art. 4 Abs 2 (Religionsfreiheit) und Art 6 Abs. 2 GG (Elternrecht) eine Abwehrdimension beinhalten, währenddessen Art. 2 Abs. 2 (Unverletzlichkeit) eine Schutzpflichtdimension in sich trägt. Die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzip mache es dem weltanschaulich strikt neutralem Staate nicht möglich, in die Religionsfreiheit des Kindes einzugreifen, in dem er es für dieses auf ein bestimmtes Alter hin verschiebt. Das Recht des Kindes lässt sich hier nicht mit dem der Eltern verrechnen. Er gehe davon aus, dass nach jetzigem Stand der Diskussion eine strafrechtliche Freistellung der rituellen Beschneidung grundgesetzkonform möglich und auch geboten ist. Dabei wies er aber darauf hin, dass das Elternrecht "ehern" sei, also bei weitem älter als das Grundgesetz, der Begriff des Kindeswohles dagegen ein sehr evolutionärer und dynamischer. In Folge könne es zu neuen Abwägungen kommen, wenn die verfassungsrechtlichen Teilnehmer von Seiten der Verfechter der jeweiligen Grundrechtsparagrafen mit neuem Wissen und neuen Argumenten versorgt werden, vor allem durch die Integration evidenzbasierter medizinischer Forschungsergebnisse in die juristische Argumentation.
Er führte aus, dass Art. 4 Abs 2 (Religionsfreiheit) und Art 6 Abs. 2 GG (Elternrecht) eine Abwehrdimension beinhalten, währenddessen Art. 2 Abs. 2 (Unverletzlichkeit) eine Schutzpflichtdimension in sich trägt. Die Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzip mache es dem weltanschaulich strikt neutralem Staate nicht möglich, in die Religionsfreiheit des Kindes einzugreifen, in dem er es für dieses auf ein bestimmtes Alter hin verschiebt. Das Recht des Kindes lässt sich hier nicht mit dem der Eltern verrechnen. Er gehe davon aus, dass nach jetzigem Stand der Diskussion eine strafrechtliche Freistellung der rituellen Beschneidung grundgesetzkonform möglich und auch geboten ist. Dabei wies er aber darauf hin, dass das Elternrecht "ehern" sei, also bei weitem älter als das Grundgesetz, der Begriff des Kindeswohles dagegen ein sehr evolutionärer und dynamischer. In Folge könne es zu neuen Abwägungen kommen, wenn die verfassungsrechtlichen Teilnehmer von Seiten der Verfechter der jeweiligen Grundrechtsparagrafen mit neuem Wissen und neuen Argumenten versorgt werden, vor allem durch die Integration evidenzbasierter medizinischer Forschungsergebnisse in die juristische Argumentation.
 Sein Redebeitrag wurde im Folgenden von Prof. Dr. Winfried Kluth, ebenfalls vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der MLU, um die Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) ergänzt. Nach einem kurzem Rekurs auf die Geschichte der KRK machte er deutlich, dass durch das Ziel der KRK, die rechtliche Subjektstellung des Kindes zu stärken, hier ein Perspektivenwechsel auch für das Grundgesetz vollzogen wird. Er argumentiert mit Prof. Dr. iur. Bea Verschraegen von der Universität Wien, dass dem Kind Rechte zu stehen, weil es Kind ist und nicht verwehrt werden, weil es noch kein Erwachsener ist. Vor diesem Hintergrund beurteilte er die rechtlichen Konsequenzen der Art. 3 KRK (Beachtung des Kindeswohles), Art. 5 (Elternrecht) und Art. 24 (Gesundheitsschutz und Überprüfung von Bräuchen). Die beiden Art. 5 und Art. 24 besitzen in Deutschland gesetzlichen Charakter. Dagegen besitzt Art. 3 als Querschnittsklausel eine verfassungsrechtliche Dimension. Für ihn sprechen gute Gründe gegen eine pauschale Freigabe der Beschneidung, wie im Gesetzesentwurf geplant. Die KRK geht über die Betrachtung medizinischer Aspekte weit hinaus. Sie stellt das Kind als Subjekt in den Mittelpunkt. Somit kommt es mit der nach Habermas detektivistischen Funktion der Menschenrechte und neuen Evidenzen zu modernen Herausforderungen an die Religionsgemeinschaften. Prof. Kluth schloss mit der Aufforderung an die Politik, sich Zeit in ihrer Arbeit zu nehmen, um so ein Sonderrecht für religiöse Bräuche zu vermeiden.
Sein Redebeitrag wurde im Folgenden von Prof. Dr. Winfried Kluth, ebenfalls vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht an der MLU, um die Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention (KRK) ergänzt. Nach einem kurzem Rekurs auf die Geschichte der KRK machte er deutlich, dass durch das Ziel der KRK, die rechtliche Subjektstellung des Kindes zu stärken, hier ein Perspektivenwechsel auch für das Grundgesetz vollzogen wird. Er argumentiert mit Prof. Dr. iur. Bea Verschraegen von der Universität Wien, dass dem Kind Rechte zu stehen, weil es Kind ist und nicht verwehrt werden, weil es noch kein Erwachsener ist. Vor diesem Hintergrund beurteilte er die rechtlichen Konsequenzen der Art. 3 KRK (Beachtung des Kindeswohles), Art. 5 (Elternrecht) und Art. 24 (Gesundheitsschutz und Überprüfung von Bräuchen). Die beiden Art. 5 und Art. 24 besitzen in Deutschland gesetzlichen Charakter. Dagegen besitzt Art. 3 als Querschnittsklausel eine verfassungsrechtliche Dimension. Für ihn sprechen gute Gründe gegen eine pauschale Freigabe der Beschneidung, wie im Gesetzesentwurf geplant. Die KRK geht über die Betrachtung medizinischer Aspekte weit hinaus. Sie stellt das Kind als Subjekt in den Mittelpunkt. Somit kommt es mit der nach Habermas detektivistischen Funktion der Menschenrechte und neuen Evidenzen zu modernen Herausforderungen an die Religionsgemeinschaften. Prof. Kluth schloss mit der Aufforderung an die Politik, sich Zeit in ihrer Arbeit zu nehmen, um so ein Sonderrecht für religiöse Bräuche zu vermeiden.
Kulturwissenschaftliche Beiträge legten weitere Aspekte der Debatte offen. Aus dem Vortrag von Prof. Dr. theol. Stefan Schorch vom Institut für Bibelwissenschaften der MLU konnten die Zuhörer nicht nur Wissen über die hermeneutischen, historischen und religionsgesetzlichen Hintergründe des Beschneidungsgebotes im Judentum erfahren, sondern auch die Erkenntnis mitnehmen, dass zwar das Gebot ein "a priori"- Gesetz sei, es allerdings aus dem Judentum selbst heraus jederzeit Möglichkeiten gab und gibt, dieses Gebot in ein anderes Selbstverständnis zu transformieren. Die Frage nach einer medizinischen Indikation sei so historisch schon immer ein innerjüdischer Debattengeber gewesen. Zudem sei der jüdische Diskursraum größer als die bisherigen Einlassungen, z. B. von Frau Knobloch. Mit seinen Ausführungen zur Geschichte des kulturellen Brauches des Epispasmus, dem Wiederherabziehen der beschnittenem Vorhaut über die Eichel in hellenistischen Zeiten, lenkte er den Blick auf die innerjüdischen Veränderbarkeit der Ausführungen der Brit Mila.
 Die Darstellung der Perspektive auf die Beschneidung aus der Sicht des Islam oblag dem Islamwissenschaftler Prof. Dr. Ralf Elger vom Seminar für Arabistik und Islamwissenschaften der MLU. Im Gegensatz zu der in der deutschen Öffentlichkeit von Vertretern der muslimischen Verbände immer wieder vorgetragenen Haltung, dass die Beschneidung auch im Islam einen "a priori"-Charakter ohne Wenn und Aber habe, führte Prof. Elger über die Geschichte der Hadithen und der Koranexegese aus, dass die islamische Rechtsauslegung seit je her dynamisch und unklar und der juristische Dissens im Islam der Normalfall ist. Anschaulich machte er dies über eine mögliche "wissenschaftlich" titulierte Koranexegese, die die Hadithen als "menschlich und daher fehleranfällig" betrachte. Aus dieser religiös-othodoxenPerspektive , die textlich älter als die meisten anderen islamischen Strömungen ist, folgt, dass die Beschneidung nicht "göttlich" begründet werden kann. Denn die "Unversehrtheit" des Menschen ist ein Gebot (Sure 2:256) und Beschneidung ist aus dieser Perspektive ein Werk des "Satans". Er machte deutlich, dass diese Perspektive nur eine von vielen möglichen ist. Angesichts dieser Heterogenität des Islam, ist es wichtig, danach zu fragen, was deutsche Muslime denken. Bekannt sind momentan hauptsächlich die Meinungen von Verbandsvertretern. Bei einer zu vermutenden sehr hohen Anzahl von nicht organisierten, daher "schweigenden Geburtsmuslimen" unter den 3,4 Millionen Muslimen in Deutschland, ergeben die Äußerungen von Verbänden im Rahmen politischer Veranstaltungen wie der "Islamkonferenz" immer nur ein Partikularbild.
Die Darstellung der Perspektive auf die Beschneidung aus der Sicht des Islam oblag dem Islamwissenschaftler Prof. Dr. Ralf Elger vom Seminar für Arabistik und Islamwissenschaften der MLU. Im Gegensatz zu der in der deutschen Öffentlichkeit von Vertretern der muslimischen Verbände immer wieder vorgetragenen Haltung, dass die Beschneidung auch im Islam einen "a priori"-Charakter ohne Wenn und Aber habe, führte Prof. Elger über die Geschichte der Hadithen und der Koranexegese aus, dass die islamische Rechtsauslegung seit je her dynamisch und unklar und der juristische Dissens im Islam der Normalfall ist. Anschaulich machte er dies über eine mögliche "wissenschaftlich" titulierte Koranexegese, die die Hadithen als "menschlich und daher fehleranfällig" betrachte. Aus dieser religiös-othodoxenPerspektive , die textlich älter als die meisten anderen islamischen Strömungen ist, folgt, dass die Beschneidung nicht "göttlich" begründet werden kann. Denn die "Unversehrtheit" des Menschen ist ein Gebot (Sure 2:256) und Beschneidung ist aus dieser Perspektive ein Werk des "Satans". Er machte deutlich, dass diese Perspektive nur eine von vielen möglichen ist. Angesichts dieser Heterogenität des Islam, ist es wichtig, danach zu fragen, was deutsche Muslime denken. Bekannt sind momentan hauptsächlich die Meinungen von Verbandsvertretern. Bei einer zu vermutenden sehr hohen Anzahl von nicht organisierten, daher "schweigenden Geburtsmuslimen" unter den 3,4 Millionen Muslimen in Deutschland, ergeben die Äußerungen von Verbänden im Rahmen politischer Veranstaltungen wie der "Islamkonferenz" immer nur ein Partikularbild.
 Ein Partikularbild ganz anderer Art ergab sich aus den durch Dr. med. Richard Stern vorgetragenen "Erfahrungen am Jüdischen Krankenhaus Berlin". Die Neigung des Arztes zu Anekdoten lockerte den Vortrag in Bezug auf die Historie des Krankenhauses auf, ließ aber argumentative Kraft an entscheidenden Stellen vermissen und legte so offen, woran es der Debatte in der Öffentlichkeit an vielen Stellen fehlt - an intellektueller Redlichkeit. Seiner Behauptung, als Vertreter evidenz-basierter Medizin zu sprechen, ließ er fast ausschließlich fehlerhafte Argumentationsketten folgen. Er verwies immer wieder auf eine groß angelegte israelische Studie, die gezeigt belegt, dass die Komplikationsrate bei Beschneidungen durch ausgebildete Mohels angeblich unter 0,5 % liege und dies hinnehmbar sei. Dabei reflektierte er nicht, dass bei einem nicht-indizierten medizinischen Eingriff an Nichteinwilligungsfähigen aus medizin-ethischer Sicht dieses halbe Prozent immer noch 0,5 % zu viel ist. Die von Prof. Jerouschek vorher ins Feld geführten Überlegungen zu Schmerztraumata blendete er völlig aus. Als klassisches Autoritätsargument baute er dann die aktuelle Empfehlung der "American Acadamy of Pediatrics" (AAP) auf. Eine kritische und datenbasierte Darstellung fehlte ebenso wie der Verweis auf die überwiegende Mehrheit von Kinderarztverbänden weltweit mit gegenteiligen Schlüssen. Der Hinweis darauf, dass weltweit 1/3 der Männer beschnitten sei, durfte leider nicht fehlen und bleibt eben nur ein leeres argumentum ad populum. Seine abschließende Bemerkung, dass er als Arzt sich im persönlichen Konflikt zwischen staatlichen und religiösen Gesetzen bewege, machte an seiner Person deutlich, wo das Problem in der Debatte genau liegt.
Ein Partikularbild ganz anderer Art ergab sich aus den durch Dr. med. Richard Stern vorgetragenen "Erfahrungen am Jüdischen Krankenhaus Berlin". Die Neigung des Arztes zu Anekdoten lockerte den Vortrag in Bezug auf die Historie des Krankenhauses auf, ließ aber argumentative Kraft an entscheidenden Stellen vermissen und legte so offen, woran es der Debatte in der Öffentlichkeit an vielen Stellen fehlt - an intellektueller Redlichkeit. Seiner Behauptung, als Vertreter evidenz-basierter Medizin zu sprechen, ließ er fast ausschließlich fehlerhafte Argumentationsketten folgen. Er verwies immer wieder auf eine groß angelegte israelische Studie, die gezeigt belegt, dass die Komplikationsrate bei Beschneidungen durch ausgebildete Mohels angeblich unter 0,5 % liege und dies hinnehmbar sei. Dabei reflektierte er nicht, dass bei einem nicht-indizierten medizinischen Eingriff an Nichteinwilligungsfähigen aus medizin-ethischer Sicht dieses halbe Prozent immer noch 0,5 % zu viel ist. Die von Prof. Jerouschek vorher ins Feld geführten Überlegungen zu Schmerztraumata blendete er völlig aus. Als klassisches Autoritätsargument baute er dann die aktuelle Empfehlung der "American Acadamy of Pediatrics" (AAP) auf. Eine kritische und datenbasierte Darstellung fehlte ebenso wie der Verweis auf die überwiegende Mehrheit von Kinderarztverbänden weltweit mit gegenteiligen Schlüssen. Der Hinweis darauf, dass weltweit 1/3 der Männer beschnitten sei, durfte leider nicht fehlen und bleibt eben nur ein leeres argumentum ad populum. Seine abschließende Bemerkung, dass er als Arzt sich im persönlichen Konflikt zwischen staatlichen und religiösen Gesetzen bewege, machte an seiner Person deutlich, wo das Problem in der Debatte genau liegt.
 Die persönliche Höhergewichtung religiöser Annahmen und gruppendienlicher "Gesetze" über die Grundverfassungen des bürgerlichen Staates birgt in der Entwicklung juristischer Standards eben genau die Gefahr, die Prof. Dr. Winfried Hassemer in seinem Abendvortrag zu dem Schluss kommen ließ, dass die Einführung von Sonderrechten das Recht an sich verdirbt und das Vertrauen der Bürger als eigentliche Verfassungsvoraussetzung untergräbt. Seine vorgetragene These: "Wenn wir das Beschneidungsverbot aufheben, bekommen wir Probleme!" ist vorher von ihm in der Zeitung für Rechtspolitik (ZRP) - der hpd berichtete - schon dargelegt worden. Gerade weil der politische Tenor darauf hinaus laufe, dass das strafrechtlich bestehende Beschneidungsverbot mit einem zwar technisch sauberen Gesetz aufgehoben werden solle, sei es wichtig, an die Konsequenzen zu erinnern. Ob eine Beschneidung "richtig" oder "falsch" sei, ist unerheblich. Eine pragmatische Rechtsauslegung ist eine Gefahr für eine konsistente Rechtssprechung. "Wir sind kein Gottesstaat.", so sein immer wieder eingebrachter Hinweis. Den bestehenden Konflikt "Schadenskultur" vs. "Brauchtumskultur" kann man nur mit der Vermeidung von Sonderrechten für Teile der Bevölkerung, welcher Art auch immer, entschärfen.
Die persönliche Höhergewichtung religiöser Annahmen und gruppendienlicher "Gesetze" über die Grundverfassungen des bürgerlichen Staates birgt in der Entwicklung juristischer Standards eben genau die Gefahr, die Prof. Dr. Winfried Hassemer in seinem Abendvortrag zu dem Schluss kommen ließ, dass die Einführung von Sonderrechten das Recht an sich verdirbt und das Vertrauen der Bürger als eigentliche Verfassungsvoraussetzung untergräbt. Seine vorgetragene These: "Wenn wir das Beschneidungsverbot aufheben, bekommen wir Probleme!" ist vorher von ihm in der Zeitung für Rechtspolitik (ZRP) - der hpd berichtete - schon dargelegt worden. Gerade weil der politische Tenor darauf hinaus laufe, dass das strafrechtlich bestehende Beschneidungsverbot mit einem zwar technisch sauberen Gesetz aufgehoben werden solle, sei es wichtig, an die Konsequenzen zu erinnern. Ob eine Beschneidung "richtig" oder "falsch" sei, ist unerheblich. Eine pragmatische Rechtsauslegung ist eine Gefahr für eine konsistente Rechtssprechung. "Wir sind kein Gottesstaat.", so sein immer wieder eingebrachter Hinweis. Den bestehenden Konflikt "Schadenskultur" vs. "Brauchtumskultur" kann man nur mit der Vermeidung von Sonderrechten für Teile der Bevölkerung, welcher Art auch immer, entschärfen.



Der Dienstag brachte dann noch drei weitere Vorträge und eine Abschlussdiskussion, die allerdings recht müde und kurz ausfiel. Ziemlich viel aufmunterndes Feuer lag zuvor aber im vorgetragenen Entwurf einer normativ sich einmischenden Ethnologie durch die Juristin Prof. Dr. Marie-Claire Foblets. Die ethnologische Perspektive sei gemeinhin bisher eine Beschreibende. Ohne nur auf die Beschneidungsdebatte abzuzielen, forderte sie die Ethnologie und die Justiz auf, stärker normativ zusammen zu arbeiten. So können ethnologische Expertisen vor Gericht zur "Aufdeckung erfundener Traditionen" führen.
Nachdem Rabbiner Ben-Chorin seine vom bisher bekannten religiösen Diskurs nicht abweichende Darstellung der jüdischen Beschneidung vortrug, kam mit Prof. Dr. phil. Florian Steger vom Institut für Geschichte und Ethik der Medizin der MLU ein nächster Stichwortgeber einer ethischen Perspektive. Er referierte über "Medizinethische Annahmen zur Beschneidung". Die exklusiv religiöse Begründung einer nicht-indizierten Beschneidung an nichteinwilligungsfähigen Dritten weise mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf die volle Verantwortung dem an sich schützenswerten Berufsstand des Arztes zu. Dieser sei an ethische Normen gebunden. Ängste, Traumata und Schmerz seien aus ethischer Perspektive eindeutig als medizinischer Schaden zu klassifizieren. Es gibt keine belastbaren Studien, die die rituelle Beschneidung als medizinische Indikation ausweisen. Beides in Verbindung mit einer bestehenden Komplikationsrate lassen die pädiatrischen Verbände die rituelle Beschneidung aus medizinisch-ethischen Prinzipien heraus ablehnen.
Falls es zu einer Rechtslage kommt, die diese Form der Beschneidung juristisch erlaube, so bleibe es letztendlich dem Gewissen des einzelnen Arzt - und nur diesem! - überlassen, ob er den Kinderschutz nun neu verschärft unter das Elternrecht ordnet, wie rechtlich geplant. Niemand könne Ärzte zwingen, eine medizinisch nicht indizierte Beschneidung vorzunehmen. In seinem zweiten Teil des Vortrages entwickelte Prof. Steger die heute unter der Ärzteschaft bestehende Annahme, dass Kinder vollständige Menschen seien. Er verwies auf die Ethik von Claudia Wiesemann und die Arbeiten des dänischen Therapeuten Jesper Juul zur präfigurabler Moralität von Kindern. Unter Berücksichtigung auch dessen, sei nicht das Recht der zukünftigen Erwachsenen auf einen unbeschnittenen Körper zu beachten (!), sondern das Recht der Kinder auf Selbstbestimmung. Dieses auszuhebeln, bedarf schon sehr starker Rechtfertigungsgründe. Diese sind nicht zu sehen. Prof. Steger: "Soziokulturelle Ansprüche sind hier nicht zu würdigen. Sie sind untergeordnet, weil das Kind jetzt Patient ist." Im Rahmen einer folgenden Diskussion widersprach er klar den angesprochenen Studien von Dr. Stern. Diese Studien seien vom Deutschen Ethikrat begutachtet und als nicht hinreichend klassifiziert worden.
Aus der anschließenden Diskussion lässt sich vor allem das Statement von Rabbiner Ben-Chorin hervorheben. Er habe "heute zum ersten Male verstanden", so wandte er sich an Prof. Steger, "dass es in der Diskussion einen Gegensatz zwischen den Standpunkten der Gruppenerfahrung/ Erfahrungsgemeinschaft und dem einer anthropologischen Zentrumsstellung gibt."
Denn hilflos, fast trotzig wird in der bestehenden Debatte von religiöser Seite immer wieder gesagt: "Es ist so! Ich habe es nicht zu verantworten! Es ist Tradition. Ich kann nicht anders!" Die Subjektivierung des Kindes als Rechtsträger steht aktuell der versuchten Nivellierung der säkularen Autonomie durch religiöse Gruppenmerkmale gegenüber. Einen pragmatischen Ausgleich kann es so nur auf Kosten des Rechtssubjektes Kindes geben. So sehr auch die Tagung die Erkenntnis zulässt, dass es momentan weitaus wichtiger ist, sachlich und gemeinsam eine breit gefächerte Debattenkultur zu pflegen, als schnell Gesetze zu erlassen, so unverrückbar ist auch die Erkenntnis, dass der Weg zu einer gemeinsamen ethischen Basis, für religiöse Befürworter der Beschneidung weiter und viel schwieriger ist, als für die Gegner der Beschneidung. Diesen Weg aber gibt es sehr wohl. Er ist leicht zu erkennen. Vielleicht muss man aus humanistischer Sicht den religiösen Verteidigern von "a priori" Argumenten nur mehr stoisch und beharrlich das Licht zu einer anthropologischen Zentrumsstellung halten. Die besseren Argumente dafür sind da.
Thomas Jeschner
_________________
Fotografien jeweils von den Seiten der Universitäten Halle und Jena, dem Jüdischen Krankenhaus Berlin und der Jüdischen Gemeinde.