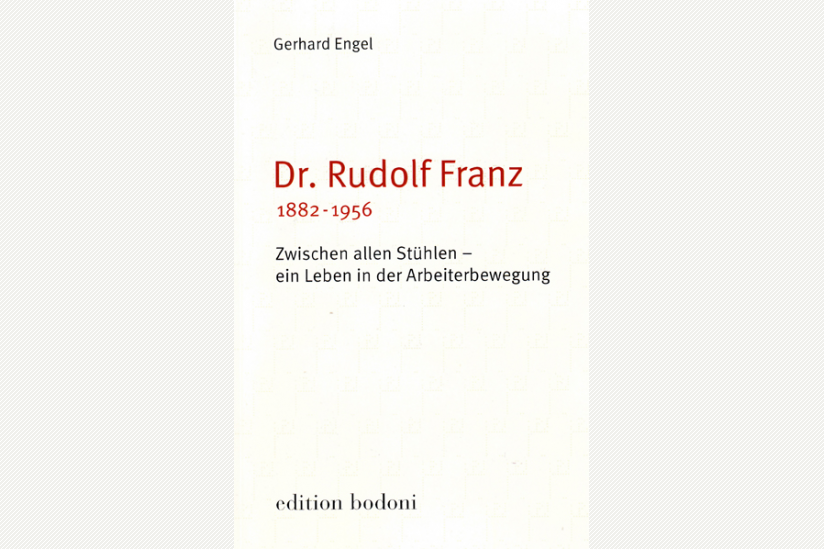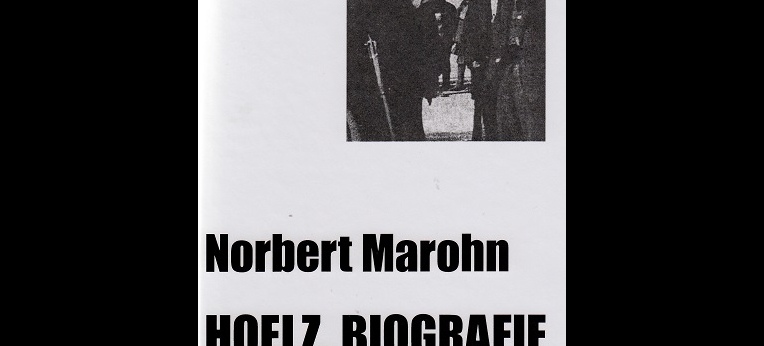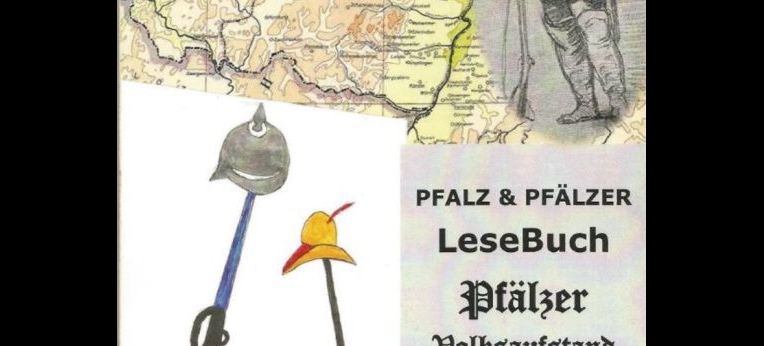ZWICKAU. (hpd) Dr. Rudolf Franz (geb. 1882 in Köln, gest. 1956 in Leipzig) teilt das Schicksal vieler Freidenker der “Zwischenkriegszeit” (1918–1939) schon allein dadurch, dass diese Geschichte wenig erforscht und die betroffenen Personen, wenn sie denn 1945 den Nationalsozialismus und den Krieg überlebt hatten, oft in die deutsch-deutschen Parteimühlen gerieten, hüben wie drüben. Der Historiker Gerhard Engel hat einen von ihnen der Vergessenheit entrissen.
Engels Befunde zur Freidenkerei sind eher ein Nebenprodukt seiner umfänglichen, durch viel Quellenarbeit (vgl. Liste S. 183 ff.) gestützten Forschungen über Leben und Werk seines Protagonisten. Rudolf Franz war ein “Kulturarbeiter” im wahrsten Sinne des Wortes: Germanist, Lehrer an der SPD-Parteischule für “Deutsche Sprache”, Journalist, in Marburg über den Dramatiker Ibsen promovierter Literaturwissenschaftler, Feuilletonist, Schriftsteller, Dichter, Festorganisator, “Volksbildner” … Er war Theaterkritiker bei der “Bremer Bürger-Zeitung”, bekannter linkssozialistischer Satiriker, kurzzeitig beim “Vorwärts”, dann an der “Leipziger Volkszeitung” und der “Roten Fahne” tätig – und er war Leipziger Kommunalpolitiker (1924–1926, 1945–1949, hier 1949 verantwortlich für die Goethefeier).
Der Biograph Engel stellt in nahezu vollständiger Rekonstruktion (siehe zeitlich geordnete Auswahlbibliographie, S. 193 ff.) die letztlich bittere Lebensgeschichte eines Menschen vor, der in seinem Wissen stets weit über seinem Umfeld stand, es seine Kollegen und Leser spüren ließ, und vor allem eines sein wollte: Redakteur und Ästhetiker der Arbeiterklasse, manchmal in der Konsequenz deren “Oberlehrer”. Engel druckt einige Leseproben von dessen typischen Texten (vgl. S. 147–182).
Das typographisch sehr angenehme Buch ist gut lesbar geschrieben. Es informiert über das Schaffen eines rastlosen Denkers und Vielschreibers, der sich, wie er zum Lebensende hin resignierend bekannte, als “parteiloser Marxist” der Arbeiterbewegung weiter verbunden fühlte und der sich trotzig weder seines Lehrers Alfred Kerr, noch seiner Zusammenarbeit mit Franz Mehring rühmte. Er wollte selbst im Mittelpunkt stehen und bäumte sich deshalb auch nicht gegen seinen “Weg in die Namenlosigkeit” auf (vgl. S. 131 ff.). Es hätte auch keinen Sinn gehabt.
Engel gibt ein treffendes Charakterbild dieses bürgerlichen Intellektuellen, der Haus und Heimat verlässt, sich der Sozialdemokratie anschließt, 1914 vehement gegen die Kriegspolitik wendet, sich in der Revolution 1918/19 den (Bremer) Linksradikalen (Freundschaft mit Johann Knief, Bekanntschaft mit Wilhelm Pieck) anschließt. Franz wendete sich dann nach ultralinks, wurde Spartakist und Syndikalist, ging 1920 mit der USPD in die KPD und wurde hier 1926 zum “Renegaten” (“Korruptionspartei Deutschlands (KPD)” (S. 118).
1933 aus einer Anstellung entlassen, sich bis Kriegsende mehr schlecht als recht durchschlagend, ging er dann doch 1945 wieder in die KPD und mit ihr in die SED. Dort hatte man seine Kapriolen von 1926 nicht vergessen, ließ ihn zwar nicht links liegen, aber ihn nicht hochkommen und stets spüren, dass er einmal in ihren Augen gründlich versagt hatte. Man beförderte ihn nicht zu einem “Arbeiterveteranen”, was – wie immer in seinem Leben – zu geldwerten Nachteilen führte. Und im Westen, wer hätte sich dort an diesen ehemaligen Kommunisten erinnern sollen?
Franz war, das zeigt Engel, eine Art “intellektueller Besserwisser”, der, das ist wichtig zu sagen, es in der Regel als Studierter und Promovierter auch tatsächlich besser wusste, zumal auf dem etwas klassenkampffernen Feld der Literatur, der aber nie in der Lage war, taktisches Verhalten zu zeigen (vgl. S. 140). Um welche Debatte es auch ging, und gerade immer dann, wenn sein Job auf dem Spiel stand, zeigte er den Klügeren, der nicht nachgibt. Es hatte dies etwas Masochistisches. Franz führte Grundsatzdebatten dann, wenn Kompromisse nötig waren. Er lehnte in der Arbeiterbewegung und dann in der DDR, vor Entlassungen stehend, andere Arbeitsverhältnisse ab: Etwa Anfang der 1950er Jahre, Leiter des Völkerschlachtdenkmals zu werden. Das wie anderes erschien ihm opportunistisch.
Auch trat Franz mit verprellenden Vorschlägen auf, so dem, das die sächsischen Arbeiter richtiges Deutsch reden sollten, um ihre Emanzipationschancen zu verbessern. Nun war da aber Leipzig schon sein Lebensmittelpunkt. Er verdarb es sich mit seinen Eltern und Geschwistern sowie (in drei Ehen) seinen Kindern und allen Freunden … bis auf einen: Das Urgestein der Linken, Hermann Duncker, hielt bis zum Ende freundschaftlich zu ihm.
Um Franz als Freidenker zu würdigen, Atheist wurde er wohl schon in der Studienzeit und er war (bis zu dessen Bewilligung der Kriegskredite 1914) ein Kampfgefährte des Freidenkers und späteren preußischen Kultusministers Konrad Haenisch, lohnt sich zunächst ein Blick in seine Arbeit als Kommunalpolitiker der KPD in Leipzig. Während seine Partei das System entlarven will, wird er richtig praktisch. So schlägt er etwa vor, die Reitwege an den Straßenrändern der Stadt in Fahrradwege zu verwandeln, setzt sich für Spiel- und Sportplätze ein. Er will die Zuschüsse zu Privatschulen streichen (vgl. S. 116).

Über diesen Gedankengang, in Verbindung mit seinem Spezialgebiet, dem Theater-, Musik- und Denkmalwesen, stößt Franz auf das Problem der Unterbezahlung von Logenschließern und Garderobenfrauen. Er polemisiert aber nun nicht nur gegen die Mittelzuweisungen an bürgerliche Theater (das Geld würde im Sozial- und Schulwesen dringender gebraucht), sondern findet im städtischen Haushalt den Titel Kommunale Zuschüsse für Kirchenmusik (in Kirchen). Daraus schließt er freidenkerisch, die Stadt bezuschusse Gottesdienstbesuche, deren Teilnahme rückgängig sei (vgl. S. 117).
Engel geht an dieser Stelle genauer auf die freidenkerischen Vorstellungen von Rudolf Franz ein, gibt wichtige Hinweise auf die Zeitschrift “Proletarische Heimstunden”, in der Franz 1923 etwa über “Die Schlacht mit den Heiligenknochen” schreibt. Vor allem auf dessen Grundsatzartikel “Vom Wesen des freien Denkens” verweist der Autor, den Franz (vgl. S. 122 f.) für den “Freidenker-Taschen-Kalender 1928” geschrieben hatte und den “Der Syndikalist” am 26.11.1927 nachdruckte.
Dieser Text war insofern anstößig, als er gegen den Begriff des “proletarischen Freidenkertums” polemisierte. Gerade begann parallel dazu die KPD eine politische Spaltung der (bis dahin wesentlich sozialdemokratischen) Bewegung zu organisieren. Freies Denken, so Franz dagegen völlig richtig, sei nicht nur eine klassenübergreifende Haltung, sondern auch eine Position, die absolute Wahrheiten ablehne. Letzteres zielte auf die KPD.
Im Folgenden geht Engel auf den Hauptbeitrag von Rudolf Franz zur Freidenkerbewegung ein, den Sammelband “Freidenkergeschichten aus der Weltliteratur” (Berlin 1929, 313 S.), mit dem einleitenden Essay “Die Freidenkerbewegung in der Literaturgeschichte” (13 S., abgeschlossen April 1929). Ein zweiter Band kam nicht zustande und der Verlag von Ludwig Thoma lehnte einen Abdruck aus “Jozef Filsers Briefwexel” ab (Franz bringt daraus im Vorwort ein langes Zitat (S. XIX ff.).
Es versteht sich aus den bisherigen Anmerkungen zu Rudolf Franz, dass dieser gerade dann “humanistisch” argumentierte, wenn in der Partei, von der er bezahlt werden wollte, wert auf die Feststellung gelegt wurde, der Kommunismus von Marx habe den Humanismus abgelöst; und als dann die SED “humanistisch” argumentierte wegen der Blockpolitik in der Gründungszeit der DDR, war es Franz, der den sozialistischen Gehalt von Goethes Werk betont haben wollte.
Wir begegnen bei der Lektüre einem schwierigen Menschen, dessen Individualismus andere verstörte, der wohl vielleicht gerade deshalb heute zu würdigen ist – und damit auch das Buch von Gerhard Engel.
Gerhard Engel: Dr. Rudolf Franz (1882–1956). Zwischen allen Stühlen – ein Leben in der Arbeiterbewegung. Berlin: edition bodoni 2013, 206 S., ISBN 978–3–940781–46–8, 18,00 Euro