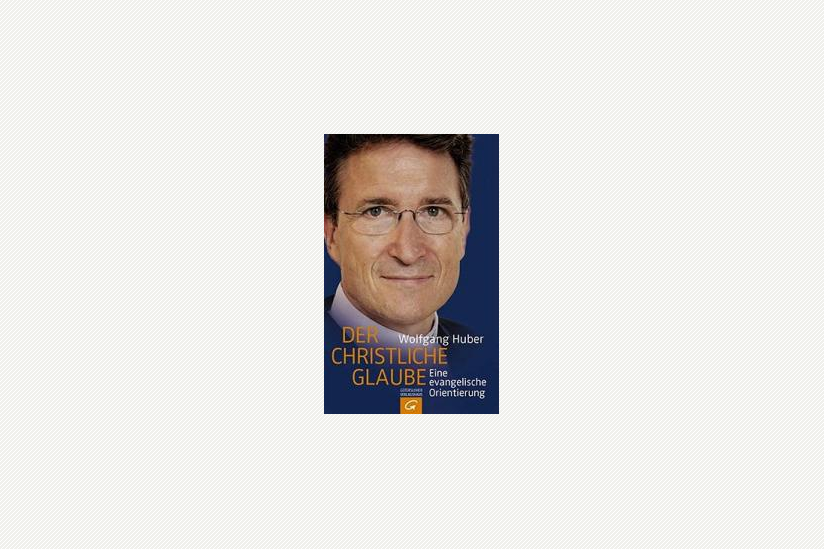(hpd) Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, richtet sich mit seinem neuen Buch „Der christliche Glaube" an „Menschen, die nach religiöser Klarheit suchen" und an „diejenigen, die das Zweifeln noch nicht verlernt haben". Diesen möchte er eine Orientierung aus protestantischer Glaubensperspektive geben und eine „tragfähige Grundlage" für ihr Leben aufzeigen.
In der Tat verschafft das Buch dem Leser einen guten Überblick darüber, wie in weiten Teilen des heutigen Protestantismus gedacht wird. Ob das aber für eine „tragfähige" Lebensgrundlage ausreicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. So wird der Leser leider oft Zeuge von unzähligen Pauschalurteilen basierend auf typisch christlichem Schwarz-Weiss-Denken von „gut" und „böse", zudem verschwimmen viele Antworten auf spannende Fragen des Glaubens im Nebel theologisch schwammiger Ausdrucksweise oder bleiben gänzlich unbeantwortet. Als Alternativen zum christlichen Glauben betrachtet er nur religiösen Fundamentalismus oder das ziellose Dahinvegetieren in einer von Materialismus und Wohlstandsdenken geprägten postmodernen Spaßgesellschaft.
Nicht nachweisbare Schöpfung
Schon beim Lesen der ersten Seiten wird deutlich, dass Huber viele Stellen der Bibel symbolisch deutet. So sei der Schöpfungsbericht dann auch nicht als historischer Bericht über die Entstehung der Welt zu begreifen, sondern sage etwas aus über „die Stellung des Menschen in der Welt", der Mensch „soll in der Schöpfung Heimat finden", der Schöpfungsglaube sei „Grundlage einer Daseinsgewissheit, die unserem Leben verlässlichen Halt gibt". Den Auftakt der Erzählung vom Sündenfall, die Erschaffung des Gartens Eden, reißt er aus dem Zusammenhang und behandelt ihn als zweiten Schöpfungsbericht. So wird aus Gottes Gebot, seinen Garten zu „bebauen und zu bewahren" das Gebot von der „Bewahrung der Schöpfung". Dass die Menschen im Anschluss daran aus genau diesem Garten vertrieben wurden, es also im ursprünglichen Sinne gar nichts mehr zu bewahren gibt sondern wir in der, wie es Christen oft nennen, „gefallenen Welt" leben, kümmert Huber dabei nicht.
Von Vertretern des Kreationismus oder des Intelligent Design distanziert er sich eindeutig, diese würden den Schöpfungsglauben als „wissenschaftliche Welterklärungstheorie" missbrauchen, Glaube und Evolutionstheorie seien miteinander vereinbar. Trotzdem legt Huber großen Wert darauf, dass am Schöpfungsglauben festgehalten werde. Dabei sei die Schöpfung aber kein einmaliger Akt in sechs Tagen gewesen, wie etwa in der deistischen Auffassung von einem „Uhrmacher-Gott", sondern Gott habe auch die Zeit geschaffen und Schöpfung geschehe fortschreitend bis an das Ende der Zeit. Aber dieses Schöpfungswirken lasse sich nicht, wie Vertreter des Intelligent Design meinen, mit Hilfe empirischer Forschung nachweisen, denn damit würde man ja Gott den „Ursachen in Raum und Zeit gleichsetzen" und Gott würde so nur ein Gegenstand des Erfahrungswissens.
Gott meint es gut mit dem Welt und dem Menschen
Den Glauben an die Schöpfung versucht Huber nun dadurch schmackhaft zu machen, indem er auf die Wirkung dieses Schöpfungsglaubens verweist. Der Mensch gewänne durch diesen Glauben „einen Zugang zum inneren Sinn" der Welt. „Der Glaube an Gott als den Schöpfer vermittele die Gewissheit, dass diese Welt die Möglichkeit zum Guten in sich enthält". „Dass Gott es mit der Welt im Ganzen ebenso wie mit meinem persönlichen Leben gut meint", sei "der Grundsinn des Schöpfungsglaubens". Der Eindruck drängt sich auf, dass mit solchen Argumenten aus dem Glauben an die Schöpfung nur ein Glauben an den Schöpfungsglauben propagiert wird.
Huber liefert auch einen kurzen Abriss über den wissenschaftlichen Stand zur Erklärung des Universums. Dabei betrachtet er das Universum sowohl zeitlich als auch räumlich. Zeitlich, so folgert er, sei die Entwicklung des Universums zwar offen, aber nicht ewig. Hubers Ausführungen über den räumlichen Aspekt des Universums dürfte dann bei den meisten Physikern wohl lustiges Schenkelklopfen zur Folge haben. So schließt Huber aus der Einsteinschen Relativitätstheorie messerscharf, dass das Universum gekrümmt sei, und man deshalb, wenn man sich so lange wie denkbar in gerader Richtung durch das Universum fortbewegt, irgendwann zum Ausgangspunkt zurückkommt. Damit will Huber in mittelalterlich scholastischer Denkart darauf hinaus, dass das Universum sowohl zeitlich als auch räumlich begrenzt ist, also endlich und vergänglich sei, so dass man Ewigkeit und Unendlichkeit nur mit Gott verbinden könne.
Mittelalterliches scholastisches Denken
Das Lächeln vergeht dem naturwissenschaftlich denkendem Leser aber spätestens an der Stelle, wo Huber den „neuen Atheisten" Dawkins und sein bekanntes Buch „Der Gotteswahn" abkanzelt. Die Tatsache, dass Dawkins Biologe ist, nimmt Huber zum Anlass ihn zu entmenschlichen und ganz auf die Rolle des Naturwissenschaftlers zu reduzieren. Dementsprechend richtet er an Dawkins den Vorwurf, die Grenzen der Wissenschaft zu überschreiten, das wissenschaftliche Material, dass er entfalte, stünde ja von „vorneherein in einem weltanschaulichen Zusammenhang". Wissenschaftler wie Dawkins, sagt Huber, würden „dadurch zu dem, was sie verachten: zu Vertretern eines Glaubens, ja zu dessen Priestern und Propheten" und so bezichtigt Huber Dawkins als einen Anhänger des Szientismus. Inhaltlich geht er allerdings in keinster Weise auf die Ausführungen im „Gotteswahn" ein, vielleicht hat er das Buch auch nie gelesen. Denn dann wäre ihm aufgefallen, dass Dawkins keineswegs mit Hilfe der Evolutionstheorie die Nichtexistenz Gottes beweisen möchte, ja dass er sogar sagt, dass dies unmöglich sei. Dawkins betrachtet die Existenz Gottes lediglich als eine Hypothese, die er, als vernunftbegabter Mensch, nicht nur als Wissenschaftler, kritisch hinterfragt. Aber die Denkweise des kritischen Rationalismus ist Huber vollkommen fremd, in Punkto Aufklärung und Erkenntnistheorie scheint er auf dem Stand von Kant stehengeblieben zu sein, wie aus seinen Ausführungen über Glaube und Vernunft deutlich wird.
Erkenntnistheorie des 18. Jahrhunderts
Mehrmals zitiert er Kant mit seiner Aussage, er habe „das Wissen aufheben müssen, um zum Glauben Platz zu bekommen". Er folgert daraus, dass Kant den Gottesgedanken aus dem Einzugsbereich des Erfahrungswissens befreit, die „Reichweite der Erfahrungswissenschaften", die sich der Beobachtung und des Beweises bedienen, sei eingeschränkt. In der Auffassung, sich dadurch gegenüber Kritik immunisieren zu können philosophiert er weiter: „Der Glaube ist der Zugang zum Ganzen der Wirklichkeit" und „indem er das Verhältnis zur Wirklichkeit im Gottesverhältnis verankert, eröffnet er einen Zugang zur inneren Einheit des Daseins, in welchem das Verhältnis des Menschen zu sich selbst, zu den anderen Menschen und zur Welt miteinander verbunden ist".
Die „Vernunft müsse durch den Glauben aufgeklärt werden", sonst bleibe sie „unerfahren und unaufgeklärt, weil sie sich keine Rechenschaft über ihre Grenzen ablege". Vernunft folge „dem Glauben nach und tritt in seinen Dienst". Andererseits räumt er ein, dass ein nicht durch die Vernunft aufgehellter Glaube die Gefahr in sich trage, barbarisch und gewalttätig zu werden und hat dabei vornehmlich den Islam im Blick. Durch Glaube initiierte Gewaltakte in der Bibel, wie sie beispielsweise der König Josia in seinem laut Bibel einzigartig vorbildichen Glauben verübt haben soll, kommen nicht zur Sprache, so wie alle anderen fragwürdigen Ereignisse in der Bibel auch nicht.
Auch das Theodizee-Problem kommt in dem Buch zur Sprache. Hier räumt Huber ein, dass es sich zwar nicht abschließend lösen lasse, aber er hat einen Trost parat: Gott leidet mit.
Ganz besonderen Stellenwert räumt Bischof Huber dem Begriff der „Menschenwürde" ein. Anhand diverser Stellen in der Bibel versucht er deutlich zu machen, dass Gott allen Menschen gleiche Würde verliehen habe. Die Aussage aus der Geschichte vom Sündenfall, der Mensch sei „Ebenbild Gottes" ist dabei zentral. Inwiefern aber die Bevorzugung eines Volkes „Israel", die mit Vernichtungen von Städten wie Jericho und ganzen Völkern einhergeht, mit der Menschenwürde vereinbar ist, erläutert Huber nicht.
Fehlgriffe und Peinlichkeiten
Einen Fehlgriff erlaubt er sich dagegen bei der Analyse des Gleichnisses von den Arbeitern im Weinberg. Aus der gleichen Belohnung für ungleiche Arbeit schließt er, dass „das Gleichnis auf die Begründung der gleichen Würde jedes Menschen in der unausforschlichen Güte Gottes" verweise. Dass er mit dieser Deutung zugleich den Nichtarbeitern im Weinberg, also den Ungläubigen, die Menschenwürde abspricht, entgeht ihm.
Nahezu ungeheuerlich sind seine Ausführungen zum Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau. Zunächst beklagt er die Situation, dass die Gleichberechtigung der Frauen bislang nur „Stückwerk" sei, die gesellschaftliche Realität bliebe noch lange hinter den formal zuerkannten Gleichheiten zurück. Der „Gleichheitsethos des Heiligen Geistes", so sagt er, gehe aber weit über politische Gleichheitsvorstellungen hinaus. Als Beispiel zitiert er den Apostel Paulus, der von der „Gleichheit der Verschiedenen" in „den höchsten Tönen" rede: „Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seit allesamt einer in Christus".
Bibel als Bastelbogen
Einmal abgesehen davon, dass auch hier wieder nur von Christen und nicht von Menschen im Allgemeinen die Rede ist, kann wohl Paulus nicht gerade als ein Vorkämpfer für geschlechtliche Gleichberechtigung herangezogen werden, sagt dieser Apostel doch an anderer Stelle: „der Mann ist nicht geschaffen um des Weibes willen, sondern das Weib um des Mannes willen" und „der Mann ist des Weibes Haupt, gleichwie auch Christus das Haupt ist der Gemeinde". An diesem Beispiel wird besonders deutlich, wie hochselektiv Huber sich, einem Bastelbogen gleich, Bibelstellen herauspickt, um sie dann in seinem Sinne interpretieren zu können. Vertrauen in die Verkündigung kirchlicher Amtsträger schafft das bei den Gläubigen sicher nicht. Zudem ist es ausgesprochen dreist, die aktuelle Situation der Gleichberechtigung als „Stückwerk" zu kritisieren, wo doch das, was man bislang erreicht hat, gegen den Widerstand des Christentums erstritten wurde.
Eine theologische Überraschung gibt es an der Stelle, wo Huber auf den Begriff „Sünde" zu sprechen kommt. Hier hat sich im Christentum eine Doppelbedeutung dieses Begriffs eingebürgert. Zum einen bezeichnet Sünde ganz allgemein eine „Trennung von Gott", zum Anderen wird unter Sünde eine Tat im Sinne einer Zielverfehlung verstanden, die zu einer Schuld bei Gott führt. Diese zweite Bedeutung in einer quasi Gleichsetzung von Schuld und Sünde, so Huber, sei ein Missverständnis resultierend aus den Überlieferungen des Vaterunser-Gebetes. Dies sei aber eine Ausnahme im Neuen Testament.
Bibelkenner reiben sich hier verwundert die Augen, werden doch an einer Vielzahl von Stellen im Neuen Testament Sünde und Schuld miteinander verknüpft, so zum Beispiel auch in der Erzählung von Jesus und der Sünderin aus dem Lukasevangelium, die Huber in seinem Buch behandelt. Aber Huber nutzt dieses neue Sündenverständnis als Auftakt für seine Interpretation des Todes Jesu am Kreuz. Denn wenn Sünden bei Gott keine Schuld mehr verursachen, dann muss ja das Verständnis des Opfers Jesu als stellvertretendes Sühnopfer im Sinne einer Satisfaktion falsch sein. Diese Satisfaktionslehre gehe, so sagt Huber, auf Anselm von Canterbury, also vorreformatorische Zeit zurück. Für Huber ist aber eine solche Lehre nicht mit dem Gottesbild Jesu vereinbar, er sieht in Kreuzestod und Auferstehung „Akte einer Versöhnung der Welt und des Menschen mit Gott", es ginge um „eine Erneuerung einer - zerbrochenen - Beziehung zwischen Mensch und Gott". Einer Geschichtsfälschung kommt es dann gleich, wenn Huber zudem behauptet, den Reformatoren sei es darum gegangen, die Versöhnung des Menschen mit Gott durch Christus in diesem Sinne neu zu verstehen. Ein Blick in den reformatorischen Heidelberger Katechismus aus dem 16. Jahrhundert bringt Klarheit, dort wird die Satisfaktionslehre des Anselm von Canterbury haarklein wiedergegeben.
Mehrere „Christologien" möglich
Überhaupt sind viele Äußerungen Hubers dazu geeignet, altkirchliche und altreformatorische Bekenntnisse aufzuweichen. So könne eine „neutestamentliche Entfaltungsform", welche die Jungfrauengeburt als historische Wahrheit begreife, nicht „zum allein bestimmenden Maßstab" gemacht werden, die Evangelien ließen mehrere „Christologien" zu, der historische Jesus sei „nicht aus den Evangelien freizulegen". Vielmehr sei das Bekenntnis zu dem „Christus des Glaubens" als Sohn Gottes entscheidender, das Bekenntnis „Herr ist Christus" sei „die Brücke zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens". Das Jesus nach seinem Tod, in das „Reich des Todes hinabgestiegen" sei (Niederfahrt zur Hölle), wurde laut Huber deshalb in das christliche Bekenntnis eingefügt, weil der „Triumpf über den Tod so umfassend wie nur irgend möglich verstanden werden sollte". Das christliche Bekenntnis sei „von einer Konzentration geprägt", dass sich von „Jesus Christus alles erhoffe": „das Heil und das Leben, die Freiheit von der Schuld und die Auferstehung der Toten". Ist das Bekenntnis also nur ein Ausdruck der Hoffnung?
Dem Thema Liebe widmet Huber einen eigenen großen Abschnitt. Umso überraschender ist es für den Leser, dass das Thema der gleichgeschlechtlichen Liebe vollkommen ausgespart bleibt. Gerade hier hätte man sich eine klare Positionierung gewünscht, war doch Huber dieses Jahr Besucher und Redner der evangelikalen Veranstaltung „Christival", auf der Homosexualität als therapierbare Krankheit angesehen wurde.
Dafür kommt Hubers pazifistische Grundhaltung zum Ausdruck, wenn er über christliche Feindesliebe philosophiert. Befremdend sind in diesem Zusammenhang aber Aussagen des Augsburger Bekenntnisses, dass er an anderer Stelle des Buches als „grundlegend" bezeichnet. In diesem Bekenntnis werden nicht nur all diejenigen „unter den ewigen Gotteszorn verdammt, die nicht durch die Taufe und den Heiligen Geist wieder neu geboren werden" sondern auch solche, die es als unchristlich bezeichnen, wenn „Übeltäter mit dem Schwert" bestraft oder „rechtmäßige Kriege" geführt werden. Was denn nun ein „rechtmäßiger Krieg" ist, hätte man von Herrn Huber gern erfahren, im Buch steht jedoch nichts darüber, außer dass Kritik am Kriegsgebaren der USA geübt wird.
Zeugnis der Zerrissenheit des heutigen Protestantismus
Insgesamt muss man sich fragen, auf welcher „tragfähigen Grundlage" denn nun Hubers „evangelische Orientierung" überhaupt beruht, die „heiligen Schriften" werden nur hochselektiv ausgewertet, die christlichen Bekenntnisse aufgeweicht. Viele Behauptungen scheinen völlig aus der Luft gegriffen und Leben nur von Hubers Autorität als ranghoher Bischof. So wirft das Buch mehr Fragen auf, als es beantwortet und wird so zum Zeugnis der Zerrissenheit des aktuellen Protestantismus zwischen bibeltreuem Evangelikalismus und „säkularem Humanismus". Auch die Frage nach dem Sinn des Lebens wird letztendlich nur zum Schein beantwortet. Was macht es für einen Sinn im Diesseits nach einem ewigen Leben zu trachten, wo doch der Sinn eines ewigen Lebens im Jenseits, der „Teilhabe an der Ewigkeit Gottes" in einem „geistlichen Leib", unklar bleibt?
Carsten Werner
Wolfgang Huber: Der christliche Glaube: Eine evangelische Orientierung, : Gütersloher Verlagshaus, Auflage: 1 (August 2008), ISBN-10: 3579064495, ISBN-13: 978-3579064499, 286 Seiten, 19,95 €.