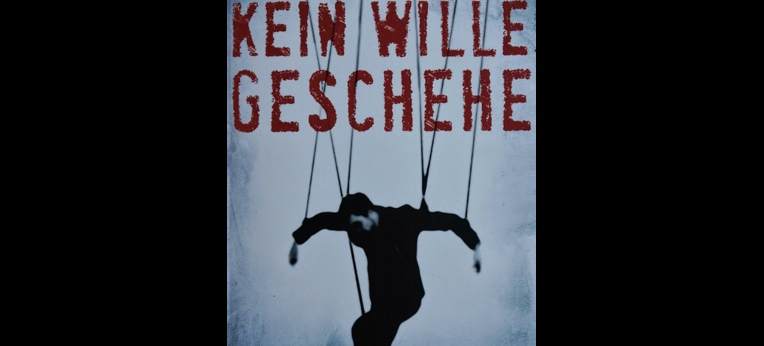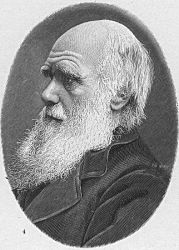 Ich denke, dass es einen Weg gibt, das Prinzip der Makrodetermination zu berücksichtigen, ohne hierdurch die wissenschaftlich so sinnvollen und erfolgreichen, naturalistischen Grundannahmen zu verletzen. Die Lösung dieses Problems besteht darin, dass man die abwärtsgerichtete Wirkung emergenter Systeme eben nicht im Sinne des newtonschen oder einsteinschen Kausalitätsprinzips versteht, sondern vielmehr im Sinne des darwinschen Evolutions- bzw. Selektionsprinzips!
Ich denke, dass es einen Weg gibt, das Prinzip der Makrodetermination zu berücksichtigen, ohne hierdurch die wissenschaftlich so sinnvollen und erfolgreichen, naturalistischen Grundannahmen zu verletzen. Die Lösung dieses Problems besteht darin, dass man die abwärtsgerichtete Wirkung emergenter Systeme eben nicht im Sinne des newtonschen oder einsteinschen Kausalitätsprinzips versteht, sondern vielmehr im Sinne des darwinschen Evolutions- bzw. Selektionsprinzips!
Hierzu muss man sich Folgendes vergegenwärtigen: Emergente Systeme (unterschiedliche Individuen, Familien, Kulturen, Moden etc.) sind nicht gleichermaßen stabil oder erfolgreich. Einige sind sehr flüchtig, andere haben länger Bestand und pflanzen sich fort. Wir können hier also von einem „Darwinschen Wettbewerb der emergenten Systeme“ sprechen. Doch was hat dies mit den Teilen auf den niederen Integrationsebenen zu tun? Nun, der Wettbewerb der emergenten Systeme ist letztlich ein „Wettbewerb der Ordnung der Teile“. Insofern kann man die abwärtsgerichtete Wirkung emergenter Systeme als ein Resultat des Wirkens von emergenten Selektionskräften verstehen, die bestimmte „Ordnungen der Teile“ begünstigen oder diese unwahrscheinlich machen.
Wenn ich mich nicht irre (was ich keineswegs ausschließen mag!), so handelt es sich hierbei um ein allgemeines Gesetz, das auf unterschiedlichsten Ebenen zu beobachten ist: Wenn sich in einem See eine bestimmte Fischart gegen andere Fischarten durchsetzt, so hat dies selbstverständlich keinen Einfluss auf den grundlegenden Mechanismus der Vererbung, der darauf beruht, dass Erbinformationen mithilfe von Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin gespeichert werden, wohl aber hat es Einfluss auf die Häufigkeit, in der bestimmte Anordnungen diese Nukleinbasen auftreten. Wenn in einer Kultur Horrorfilme erfolgreicher im Kino laufen als Liebesromanzen, hat dies keinen Einfluss darauf, dass romantische Gefühle durch das Neuropeptid Oxytocin und Stressreaktionen durch das Hormon Adrenalin ausgelöst werden, aber es hat sehr wohl Einfluss auf die relative Häufigkeit der Ausschüttung von Oxytocin und Adrenalin in einer Kultur. Ebenso hat Katja Epsteins erfolgreicher Schlager „Wunder gibt es immer wieder“ keineswegs das „Wunder“ vollbracht, den physikalischen Mechanismus der Entstehung und Übertragung von Tonfrequenzen bzw. den biologischen Mechanismus der Interpretation von Schallwellen im Ohr bzw. im Gehirn zu verändern. Wohl aber sorgte dieser Schlager dafür, dass eine spezifische (von der GEMA deshalb auch geschützte) Anordnung von Tonfrequenzen in einer ganz bestimmten geografischen Region (deutschsprachiger Raum) in verstärktem Maße auftrat und von lebenden Organismen neuronal verarbeitet wurde.
Den grundlegenden Mechanismus der Makrodetermination können wir also folgendermaßen formulieren: Der Selektionsprozess S*1 bewirkt auf emergenter Ebene, dass U*1 --> W*1 häufiger auftritt als U*2 --> W*2. Das wiederum hat auf basaler Ebene zur Folge, dass U1 --> W1 häufiger auftritt als U2 --> W2. Mit anderen Worten: Die „abwärtsgerichtete Verursachung“ des emergenten Prozesses U*1 --> W*1 wirkt nicht in einem kausal-deterministischen Sinne, da U*1 --> W*1 nicht U1 --> W1 hervorrufen kann, aber sie hat sehr wohl einen selektiven Einfluss auf die Häufigkeit, in der U1 --> W1 auftritt.
Wie man sieht, beruht das von mir vertretene „Konzept einer starken, naturalistischen Emergenz“ auf der Annahme, dass emergente Systeme tatsächlich (nicht bloß scheinbar!) eigene Gesetzmäßigkeiten aufweisen, die a) nicht restlos auf Ursachen auf niederer Integrationsebene zurückzuführen sind und die b) ihrerseits Einfluss auf die Häufigkeit des Auftretens von Prozessen auf niederer Integrationsebene haben. Kultur ist somit zwar biologisch bedingt, aber nicht hinreichend über biologische Prinzipien zu erklären. Ebenso beruht Leben auf spezifischen physikalischen und chemischen Voraussetzungen, kann jedoch nicht auf diese reduziert werden, ohne dass wir dabei Wesentliches übersehen. In Formelsprache übersetzt heißt dies: U1 --> W1 ist zwar die notwendige Voraussetzung für U*1 --> W*1, aber U*1 --> W*1 ist deshalb noch lange nicht identisch mit U1 --> W1.
„So viel Reduktionismus wie möglich, so viel Komplexität wie nötig!“
Diese Grundausrichtung der Argumentation hat weitreichende Konsequenzen, beispielsweise wissenschaftstheoretische: So ist etwa die Ausdifferenzierung der Wissenschaft in verschiedene Disziplinen darüber legitimiert, dass die Forschungsgegenstände von Ökonomie, Pädagogik, Literatur- oder Musikwissenschaft als emergente Systeme jeweils eigenen Gesetzmäßigkeiten folgen, die sich nicht in Biologie, Chemie oder gar Physik überführen lassen. Allerdings liegt dieser Vielfalt der Disziplinen eine von vielen übersehene „Einheit der Wissenschaft“ zugrunde, die nicht zuletzt durch den unaufhörlichen Strom der aufwärtsgerichteten Verursachung (Mikrodetermination) bedingt ist. Dabei gilt: Je höher der Emergenzgrad eines Systems, desto größer ist auch das „reduktionistische Erbe“, das ihm zugrunde liegt.
Dieses „reduktionistische Erbe“ muss in der wissenschaftlichen Erforschung emergenter Systeme selbstverständlich berücksichtigt werden. Es sollte klar sein: Etwas, das physikalisch unmöglich ist, ist auch ökonomisch unmöglich; etwas, das schon biologisch absurd ist, ist auch philosophisch absurd! Trotzdem haben Geistes- und Sozialwissenschaftler Recht, wenn sie vor einer Überinterpretation naturwissenschaftlicher Erkenntnisse warnen, schließlich ist Physik (siehe die Darlegungen zur Makrodetermination) nicht gleichbedeutend mit Ökonomie und Biologie nicht mit Philosophie! Unrecht haben diese Geistes- und Sozialwissenschaftler allerdings, falls sie meinen, naturwissenschaftliche Erkenntnisse in irgendeiner Weise ignorieren zu dürfen, denn das „reduktionistische Erbe“ ihrer emergenten Forschungsgegenstände ist unaufhebbar! Insofern sollte der naturwissenschaftliche Reduktionismus auch nicht als Bedrohung, sondern vielmehr als notwendige Basis geistes- und sozialwissenschaftlicher Forschung begriffen werden. Als Leitsatz der Forschung können wir also folgenden Leitsatz formulieren: „Soviel Reduktionismus wie möglich, soviel Komplexität wie nötig!“