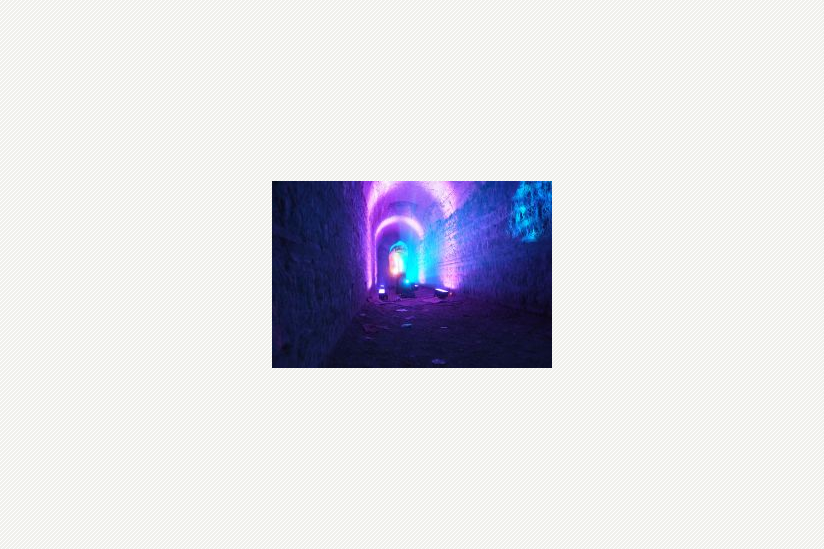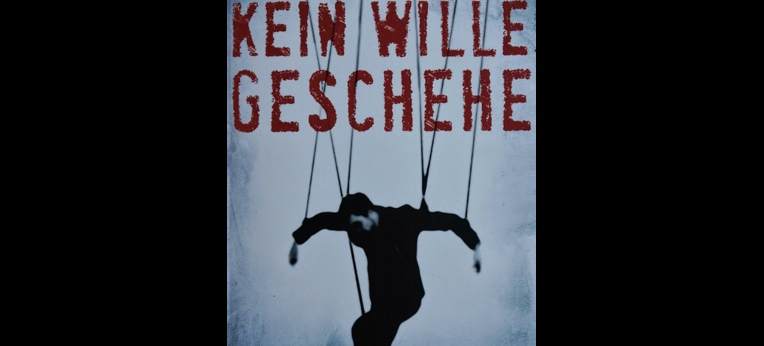(hpd) Im abschließenden dritten Teil seiner Replik auf Andreas Müller erklärt Michael Schmidt-Salomon, warum eliminatorische Reduktionisten eine „Zombie-Psychologie“ vertreten und warum der Glaube an Irreales durchaus mit realen Konsequenzen verbunden ist. Außerdem zieht er eine Bilanz der Debatte und bedankt sich bei seinem Kritiker.
Im zweiten Teil dieser Replik habe ich das Konzept einer „starken, naturalistischen Emergenz“ erläutert. Da ich in den nachfolgenden Überlegungen auf dieses Konzept zurückgreifen werde, halte ich es für angebracht, hier noch einmal einige zentrale Arbeitsergebnisse zusammenzufassen.
Erstens: Leben ist, was niemanden verwundern sollte, durch physikalische und chemische Prozesse bestimmt. Das Prinzip der „aufwärtsgerichteten Verursachung“ (Mikrodetermination) besagt, dass basale Prozesse die notwendige kausale Voraussetzung für emergente Prozesse bilden. Daher gilt: Was physikalisch unmöglich ist, ist auch biologisch unmöglich! Dennoch besitzt Leben eine Eigengesetzlichkeit, die sich nicht vollständig auf chemische oder physikalische Prozesse zurückführen lässt.
Zweitens: Emergente Systeme wie Organismen (oder auf noch höherer Emergenzstufe: Kulturen) haben einen selektiven Einfluss auf die Häufigkeit, in der basale physikalische und chemische Prozesse auftreten. Es gibt also neben der „aufwärtsgerichteten Verursachung“ (Mikrodetermination) auch eine „abwärtsgerichtete Verursachung“ (Makrodetermination), d.h. eine Rückwirkung des emergenten Ganzen auf die Teile der tieferen Integrationsebene. Diese Rückwirkung ist nicht kausal-deterministisch (im Sinne der Physik), sondern evolutionär-selektiv (im Sinne Darwins) zu interpretieren. Wenn beispielsweise Spezies A Spezies B aufgrund positiv wirkender Selektionskräfte verdrängt, so verändert dies nichts an den biochemischen Mechanismen der Vererbung, jedoch treten bestimmte Anordnungen von Biomolekülen häufiger auf als zuvor.
Drittens: Die Rückwirkungen emergenter Systeme auf niedere Integrationsebenen „bedienen“ sich der Gesetzmäßigkeiten dieser niederen Ebenen, weshalb sie aus der Perspektive der niederen Integrationsebenen in gewisser Weise „unsichtbar“ sind. Im obigen Beispiel: Wenn Spezies A Spezies B verdrängt, heißt dies, dass die spezifische Anordnung von Atomen, Molekülen etc., die für Spezies B charakteristisch war, nun nicht mehr auftritt. Auf physikalischer Ebene ist dabei nichts Ungewöhnliches passiert (es gab keine Verstöße gegen die Gesetze der Gravitation oder der starken, schwachen oder elektromagnetischen Wechselwirkung) – und doch ist in der Welt etwas Bedeutsames geschehen (zumindest für die Mitglieder der Spezies A und B), was sich letztlich auch im physikalischen Kosmos niederschlug, ohne dass dies aus einer rein physikalischen Perspektive als Besonderheit verbucht werden konnte!
Viertens: Da die Rückwirkungen emergenter Systeme aus der Perspektive der niederen Integrationsebene unsichtbar sind, kann der Ansatz eines eliminatorischen Reduktionismus, der reale Wirkungen emergenter Systeme bestreitet, als plausibel, ja sogar als „wissenschaftlich besonders elegant“ erscheinen. Allerdings fordert diese denkmögliche Position einen hohen Preis: Denn dieser Ansatz läuft daraus hinaus, dass alle Erscheinungen in der Welt (inklusive der menschlichen Kultur) nichts weiter sind als Epiphänomene physikalischer Prozesse. Unter dieser Voraussetzung würde es uns nur so erscheinen, als ob unsere Überzeugungen, Überlegungen, Gefühle etc. von Bedeutung sind, tatsächlich aber wären sie bloß vernachlässigbare Folgeerscheinungen der vier physikalischen Grundkräfte (Gravitation, starke, schwache und elektromagnetische Wechselwirkung). Jede Berufung auf die Wirksamkeit von Gründen, von Aufklärung und Selbstreflexion, jede Diskussion über die Güte von Argumenten, wäre damit hinfällig! Denn unter dieser Voraussetzung würden wir irrationale und/oder inhumane Standpunkte (etwa den Fundamentalismus bin Ladens) nicht deshalb kritisieren, weil wir uns dank rationaler Argumente von der Richtigkeit dieser Position überzeugt haben, sondern weil gänzlich unintelligente, physikalische Prozesse unsere Gehirne so determinieren, dass wir exakt so und nicht anders denken können (was im umgekehrten Falle für Osama bin Ladin selbstverständlich in gleichem Maße gelten würde).
Fünftens: Weil eliminatorische Reduktionisten die emergenten Eigenschaften von Leben ignorieren, meinen sie, dass es überhaupt keinen Unterschied mache, ob ein potentieller Roboter der Zukunft tatsächlich lebt, empfindet und seinen eigenen Erfahrungen Bedeutung zumisst, oder ob er derartige Eigenschaften bloß perfekt simuliert, ohne dass dies für ihn irgendeine Bedeutung hätte. Gegen diese reduktionistische Sichtweise hatte ich eingewendet, dass die Differenz von Leben- und Nichtleben für uns selbst dann noch die bedeutsamste Unterscheidung schlechthin bliebe, wenn wir in der Zukunft, getäuscht von raffinierten High-Tech-Maschinen, nicht mehr in der Lage sein sollten, diese Unterscheidung vorzunehmen.
An dieser Stelle möchte ich den argumentativen Faden wieder aufnehmen. Fragen wir uns zunächst: Was ist der Grund dafür, dass wir die Unterscheidung zwischen Leben und Nicht-Leben möglicherweise irgendwann einmal nicht mehr begründet vornehmen können? Und weshalb sollte eine solche Unterscheidung überhaupt noch bedeutsam sein, wenn wir sie unter bestimmten Umständen gar nicht mehr vornehmen können?
Ein Gedankenexperiment
Stellen wir uns vor, eine ethisch fragwürdige, aber uns technisch kolossal überlegene, außerirdische Intelligenz hätte uns darauf programmiert, in bestimmten Zeitintervallen zwischen zwei inneren Modi hin und her zu wechseln: Im ersten Modus, nennen wir ihn den „Real-Modus“, würden wir so weiterleben wie bisher. Wir würden lieben, lachen, hoffen, Schmerzen empfinden und all unsere Handlungen und Erfahrungen hätten für uns Bedeutung. Im zweiten Modus, dem „Zombie-Modus“, würden wir nach außen zwar weiterhin tun, was wir zuvor getan haben, doch wir würden all dies nicht mehr subjektiv erleben. Wir würden zwar schreien, wimmern, fluchen, wenn wir uns an einem spitzen Gegenstand stoßen, aber wir würden dabei keinerlei Schmerz oder Wut empfinden, da die entsprechenden Hirnregionen ausgeschaltet wären. Stattdessen würde ein raffinierter, außerirdischer Steuerungsmechanismus all die körperlichen Verhaltensmerkmale simulieren, die von der Außenwelt als Ausdruck „echter emotionaler Reaktionen“ interpretiert würden, in Wahrheit aber besäßen „wir“ nur das „reiche Innenleben“ eines Kühlschranks, Toasters oder Kaffeeautomaten.
In diesem hypothetischen Zombie-Modus wären wir in der Tat „lebende (oder besser gesagt: lebendig wirkende) Tote“, doch niemand könnte dies von außen erkennen und kein Außenstehender wäre in der Lage, zu unterscheiden, in welchem der beiden Modi wir uns gerade befinden. Allerdings wäre uns selbst der fundamentale Unterschied sofort klar, sobald wir vom „Zombie-Modus“ in den „Real-Modus“ wechseln würden. Denn nun würden wir ja wieder über unseren alten Empfindungsreichtum verfügen. Würde man uns in diesem Zustand Videoaufnahmen vorspielen, in denen zu sehen ist, wie wir im Zombie-Modus eine Bank ausgeraubt haben, so würden wir die Verantwortung für diese Tat strikt abstreiten – und zwar aus gutem Grund: Denn nicht wir hätten die Bank ausgeraubt, sondern eine gefühllose Maschine, die nur dank einer geschickten Simulation von äußeren Signalen den Anschein erweckte, es handele sich um eine echte Person. Leider aber würde uns kein Richter der Welt diese wichtige Differenzierung abkaufen, da von außen nun einmal keine Unterschiede zwischen den Modi feststellbar wären.
Das Zombie-Gedankenexperiment zeigt, dass der Unterschied zwischen Leben und Nichtleben, zwischen echten und bloß simulierten Empfindungen, für die Innenwahrnehmung eines Systems sehr wohl einen gewaltigen Unterschied macht – und zwar selbst dann noch, wenn dieser Unterschied von außen möglicherweise gar nicht mehr wahrgenommen werden kann. Wenn wir also über die Differenz von Leben und Nicht-Leben nachdenken, so müssen wir die Unterschiede zwischen der Ersten-Person- und der Dritten-Person-Perspektive berücksichtigen.