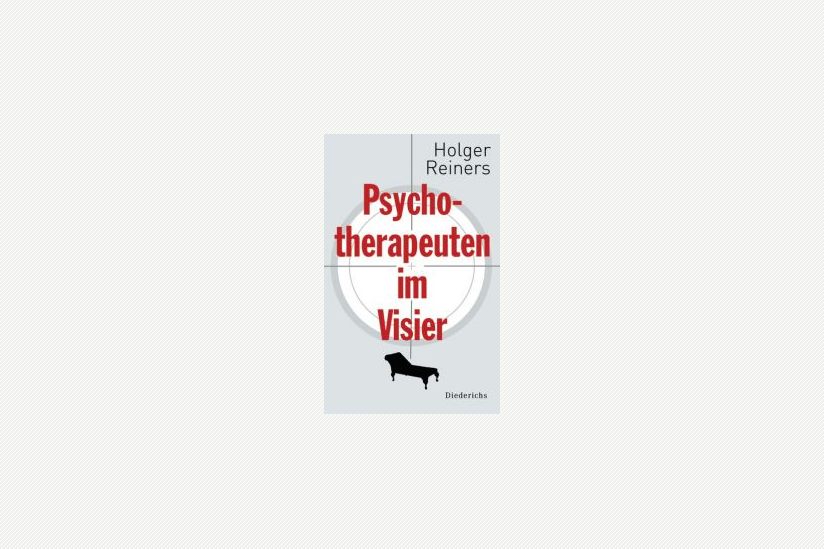(hpd) Auf der einen Seite steht der verzweifelte Patient, der sich nicht mehr zu helfen weiß, auf der anderen Seite der Therapeut, der mit undurchsichtigen Methoden und zwischenmenschlichen Defiziten keine Hilfe bieten kann – so könnte man Holger Reiners Erfahrungen resümieren.
Holger Reiners war 20 Jahre wegen Depression in Behandlung. Seine Erfahrungen hat der Architekt in mehreren Büchern zum Thema bearbeitet. Hier wirft er einen plakativen Blick auf die Therapeutenzunft und deren mitunter fragwürdige Arbeitsweise. In 13 Kapiteln plus Vor- und Nachwort handelt sein mahnendes Buch immer wieder von der Hilflosigkeit und Ohnmacht des Depressionskranken sowie von einer Zunft, die es versteht, ihre Pfründe zu sichern, ohne Nachweis über ihre Tauglichkeit erbringen zu müssen. Sein Plädoyer läuft darauf hinaus, als betroffener Laie ernst genommen zu werden.
Schon der therapeutische Ansatz, man müsse seine Vergangenheit aufarbeiten, sei in Frage zu stellen. Schließlich, so Reiners, ginge es nicht um Schuldzuweisungen an eventuelle ehemalige Aufsichtspersonen und die Ursache der Depression sei ohnehin nicht eindeutig klärbar. Dieselben Einflüsse können bei verschiedenen Menschen zu unterschiedlichen Resultaten führen. Vielmehr ginge es darum, „das eigene Kranksein in der Depression zu akzeptieren und alles zu tun, um sich möglichst schnell aus den Fängen des seelischen Leidens zu befreien.“ (S. 102)
Warten kann lebensgefährlich sein
Auch sei die Praxis der Terminvergabe äußerst ungünstig. Erst einmal muss der eventuell suizidale Patient mindestens drei Monate warten, bis er überhaupt einen Termin erhält. Dies sei schon Grund genug, bei einem „kalten“, arrogant wirkenden, einen „anstarrenden“ Therapeuten zu bleiben, ob man mit diesem zurechtkommt oder nicht. Zudem erlaubten die Krankenkassen keinen Wechsel bzw. die Tortur des Wartens käme dann wieder auf den Depressiven zu. Dann der wöchentliche Rhythmus, dieser sei, meint Reiners, viel zu lange. Besser sei es, häufiger auf einen warmen, zugewandten Therapeuten zu treffen, der einem eindeutige Handreichungen biete, einen hoffnungsvoll stimme, um einem die „Sehnsucht auf das Leben“ zu ermöglichen. In der gängigen Praxis jedoch verpuffe die Wirkung einer Therapiestunde bereits nach kurzer Zeit und die Warterei auf den nächstwöchigen Termin beginne erneut.
In diesem Zusammenhang rechnet der Auto auch mit „Wellness-Patienten“ ab, die lediglich der Selbsterfahrung wegen wertvolle Therapeutenstunden von jenen abzögen, die ernsthaft der Hilfe bedürften.
Auch über den Suizid schreibt Reiners (er verwahrt sich gegen die Bezeichnung „Selbstmord“) und regt sich im Kapitel „Depression und das Recht auf Suizid“ über „die Anmaßung religiöser Hardliner“ auf, „die den Suizidenten auch weiterhin verurteilen...“ (S. 80) Suizidabsichten oder -gedanken zu besprechen sei in der Therapie tabuisiert, dabei sei „absolute Offenheit das Geheimnis für einen Überzeugungserfolg.“ (S. 84)
Der Vergleich mit der Standardbehandlung durch Ärzte öffnet die Augen für die Absurdität psychotherapeutischer Vorgehensweisen. Die ärztliche Anamnese, Diagnose, klare Ziel- und Zeitvorgabe sowie ärztliche Behandlungspläne stehen dem psychologischen Wischiwaschi mit unklarer Methodik und jahrelangen Therapieverläufen diametral gegenüber. Da ist was dran. Als beispielhaft verweist Reiners auf die Tumorkonferenz bei Krebserkrankungen, in der Ärzte interdisziplinär zusammenarbeiten, um das bestmögliche Vorgehen für jeden Patienten abzuklären. Dagegen arbeite der Therapeut allein und unkontrolliert. Die Zukunft der Psychotherapie gegen Depressionen liegt für Herrn Reiners im Internet, was Kranken ermöglichen werde, „Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und nicht immer nur am Tropf der verordneten Therapietermine zu hängen.“ (S. 154)
Kritisch
Problematisch ist allerdings das Herangehen des Autors selbst. Es mag an seiner eigenen Betroffenheit liegen, aber man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, der Autor sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Er beschwört Mythen herauf, anhand derer er belegt, was „gut“ und was gewissermaßen „böse“ sei. Nach dem Motto „früher war alles besser“ gab es mal den „guten Landarzt“, der im Ort dasselbe Ansehen genossen habe wie der Pfarrer, der Apotheker, der Lehrer, der Gutsherr. Alte Menschen „sind“ für Reiners „eine Goldgrube – an Wissen, Erfahrung und Herzlichkeit“. (S. 143) Und Ärzte verfügten im Gegensatz zu Medizinern über „eine besondere seherische Fähigkeit in der Diagnostik“. (S. 29) – Wie bitte? Nun gut, das Buch ist plakativ.
Das Kapitel über Schweine wirft ebenfalls einige Fragen auf. Aus der Perspektive der Ähnlichkeit zwischen der Lebenssituation eines Patienten und der eines Schweins beschreibt Reiners die angeblich liebevolle Schweinehaltung in Spanien und Italien („sie lieben sie, sie hegen sie gut und verkaufen sie gut“; S. 27), bevor wir es, das Schwein, „seiner Bestimmung gemäß verspeisen.“ (S. 24) Hier wird wohl nicht nur dem Tierethiker mulmig zumute. Wie genau die Verbindung zwischen Schweinen und Depressionskranken aussieht, abgesehen davon, dass Herr Reiners Schweine mag und ein Plädoyer gegen Massentierhaltung bei Schweinen einbringt, bleibt unklar und es wird im Verlauf des Buchs, abgesehen von diesem Kapitel, kein Bezug mehr auf sie genommen.
Abgesehen davon wiederholt sich der Autor des Öfteren. Er argumentiert häufig assoziativ, man vermisst eine stringente und klare Argumentation und Struktur. Behauptungen wie etwa jene, dass nur zehn Prozent der Psychotherapien erfolgreich seien, bleiben unbelegt. Unvermittelte thematische Sprünge machen die Lektüre mitunter zu einem Rätselraten. Zwischendurch erfolgen kleine Exkurse, in denen Themen angeschnitten werden, die nichts zur Sache tun bzw. ihr Bezug zur Sache, um die es geht, bleibt verborgen. Der einerseits hochgelobten Ärzteschaft wird andererseits vorgeworfen, nie wirklich mit dem Schreckensregime der Nationalsozialisten gebrochen zu haben, was sich anhand ihrer starren hierarchischen Struktur zeige. Dieses und andere Beispiele für Widersprüche in der Argumentation verwirren eher als dass sie erhellen würden.
Und das ist schade, denn zwischendurch präsentieren sich köstliche Erkenntnisse und Offenlegungen, wie etwa zu den „zerstörerischen Blitzgedanken des spontanen Todeswunsches“ (S. 91). Kaum etwas könnte das Fiasko des Therapeutenwesens besser verdeutlichen als ein Patient, der bei drei verschiedenen Therapeuten drei „vollkommen unterschiedliche Behandlungsansätze erfahren hat“. Diese Behandlungsansätze variierten zwischen der sofortigen stationären Aufnahme in die psychiatrische Klinik bis zur Akupunktur! (S. 121) Patienten, die mit dem Therapeuten nicht zurechtkommen, werden – so Reiners – kurzerhand als „therapieresistent“ diagnostiziert, was ihre Situation ungleich verschlimmert.
Fazit
Reiners zieht über die Therapeutenzunft her. Das macht er recht plakativ und benutzt dazu als Stilmittel unter anderem persönliche Erfahrungen, Allegorien und unbelegte Behauptungen. Bei der Lektüre gewinnt man mitunter interessante Erkenntnisse. Wer aber eine klare Vorgabe sucht, wie denn eine gelingende Therapeuten-Patienten-Beziehung aussehen sollte, muss sich diese selbst aus verstreuten Textstellen zusammenbasteln und sich den Rest denken.
Fiona Lorenz
Holger Reiners : Psychotherapeuten im Visier. Diederichs, 160 Seiten, ISBN: 978-3-424-35060-9. € 14,99 [D] | € 15,50 [A]