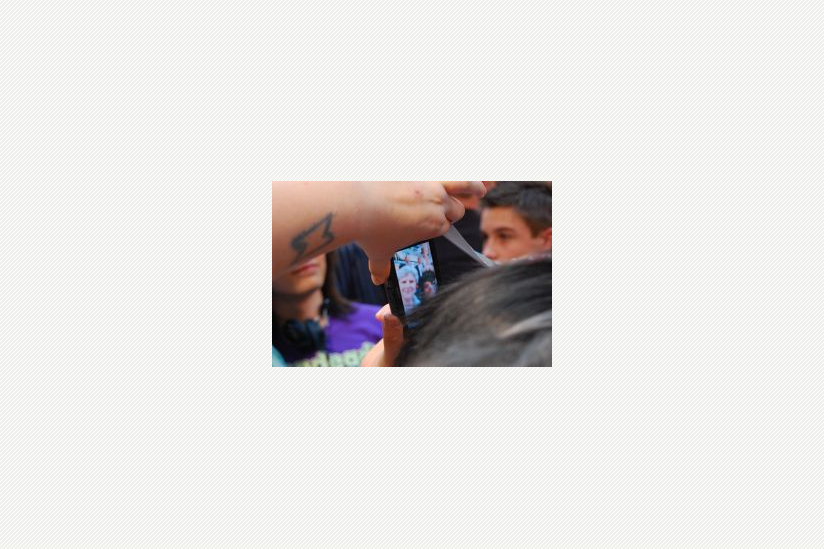WIEN. (hpd) Österreichs Jugendliche halten Arme für faul, finden, dass es zu viele Migranten im Land gibt und glauben an das Leistungsprinzip. Das ergibt eine aktuelle Studie aus Wien, die im Land für Aufmerksamkeit sorgt.
Es gibt schönere Geburtstagsgeschenke. Zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Jugendkulturforschung erhoben die dortigen Expertinnen und Experten, wie Österreichs und speziell Wiens Jugendliche ticken. Kurz gesagt: Die 400 Befragten haben die Existenzängste der Wirtschaftskrise, das neoliberale Leistungsprinzip und die seit Jahren anhaltende xenophobe Propaganda der Rechtsparteien verinnerlicht.
Sozialisation in einer Wettbewerbsgesellschaft
Knapp zwei Drittel etwa halten einen sicheren Arbeitsplatz für wichtiger als einen gut bezahlten bzw. als Karrierechancen. Und, so glauben die 16- bis 19-Jährigen der Bundeshauptstadt: Wer keine Matura (kein Abitur) hat, ist am Arbeitsmarkt nichts wert. Besonders oft sagen das Jugendliche, die Matura haben oder demnächst machen werden. Fazit von Studienautorin Beate Großegger: „Die heute junge Generation ist in einer Wettbewerbsgesellschaft sozialisiert worden.“
Deutlicher wird das, wenn man die Jugendlichen fragt, was für Armut verantwortlich ist. 36 Prozent attestierten armen Menschen Faulheit und zu wenig Willenskraft, deutlich mehr als vor zehn Jahren. Nur 21 Prozent sehen hinter Armut Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft. Diese Generation scheint die Propaganda des „Leistungsprinzips“ verinnerlicht zu haben. Dazu passt, dass es nicht einmal die Hälfte der Jugendlichen für wichtig hält, dass Zuwanderer die gleichen Chancen am Arbeitsmarkt haben. Gar nur ein Drittel tritt dafür ein, dass Geld von Reich zu Arm umverteilt wird.
Selbst bei Fragen, wo es einen breiten gesellschaftlichen Konsens gibt, klaffen die Meinungen auseinander: Gleiche Bezahlung für Männer und Frauen fordern 81 Prozent der Mädchen – und nur 48 Prozent der Burschen. „Was auffällt, ist, dass Jugendliche den Zugang zu sozialen Fragen weniger von grundsätzlichen weltanschaulichen Positionen aus, sondern eher vom Bezugspunkt der persönlichen Betroffenheit suchen. Das klassische Wording der Umverteilungsdebatte ist der Generation der heute 16- bis 19-Jährigen großteils fremd. Die Sozialpolitik diskutiert am Jargon der Jugend vorbei“, formuliert es Großegger.
Fremdenfeindlichkeit ist Konsens
Wer offen mit fremdenfeindlichen Parolen agiert, wird die Herzen der heute 16- bis 19-Jährigen vermutlich schnell auf seiner Seite haben. „Fast 44 Prozent der Befragten geben an, es gebe zu viele Türken im Land“, sagt Studienautorin Großegger. 40 Prozent attestieren Migranten, „echte Österreicher“ als „minderwertiges Volk“ zu sehen. Angesichts massiver Existenzängste und des politischen Klimas in Österreich überraschen solche Befunde wenig. Heute 16- bis 19-Jährige sind aufgewachsen mit FPÖ-Slogans à la „Daham statt Islam“, „Abendland in Christenhand“ und „Mehr Mut für unser Wiener Blut“.
Auch ein altes Feindbild taucht wieder auf: 18,2 Prozent stimmen der Aussage zu „Die Juden haben nach wie vor zu viel Einfluss auf die Weltwirtschaft.“ Immerhin 11 Prozent scheuen sich nicht, anzugeben: „Adolf Hitler hat für die Menschen auch viel Gutes getan.“
Zumindest die letzten beiden Werte dürften auch auf die Art der Befragung zurückzuführen sein. Die Befragungen wurden online durchgeführt. „Diese Methode hat zwar auch ihre Schwächen, aber in der Anonymität trauen sich Menschen Dinge zu sagen, die sie bei einem Telefoninterview nie aussprechen würden“, heißt es aus dem Institut. Das betreffe vor allem Jugendliche mit höherer Bildung. Gerade die würden bei anderen Befragungsmethoden wissen, wie man solche Formulierungen vermeidet.
Beinahe überraschend mutet angesichts dieser Ergebnisse an, dass viele Jugendliche sich mit der Occupy-Wall-Street-Bewegung identifizieren können. Das liegt vielleicht daran, dass es eine Protestbewegung ist. Wenn sich Jugendliche schon politisch interessieren, ist es diese Form des Engagements. In politischen Parteien sieht sich nur jede/r Vierte.
Christoph Baumgarten