Dass der Einsatz gegen die Diskriminierung von Minderheitenangehörigen eine gute Sache ist, dem dürften hierzulande vermutlich viele Menschen zustimmen. Doch ob der Weg, den linke Identitätspolitik hierbei einschlägt, der richtige ist, ist zweifelhaft. Aber was genau ist eigentlich an Identitätspolitik problematisch?
1. Einleitung und Fragestellung
Auch berechtigte Kritik kann aufgrund ihrer inhaltlichen Implikationen problematisch sein.1 Diese Auffassung durchzieht die folgende Erörterung, die einen analytischen Blick auf die Identitätspolitik wirft. Unter dieser Bezeichnung fasst man auch in Deutschland mittlerweile angekommene Debatten aus den USA: In ihnen geht es um die Diskriminierung von Minderheitenangehörigen. Dabei können die Akteure berechtigt auf Gegebenheiten verweisen, welche mit den eigentlichen normativen Maßstäben des sozialen Miteinanders nicht konform gehen. Die Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe, Kultur oder Religion gehört dazu, wird damit doch ein allgemeines Gleichwertigkeitspostulat in demokratischen Verfassungsstaaten negiert. Bereits am Anfang dieses Beitrags steht diese Grundposition. Denn die folgenden Betrachtungen wollen nicht das lobenswerte Engagement für Minderheiten hinterfragen, ihnen geht es um die damit einhergehenden problematischen Elemente als eben eher unterschwelligen Konsequenzen und Positionen.
Es wird etwa ein partikularer zugunsten eines universellen Antirassismus abgelehnt, womit sich die folgende Argumentation hier insbesondere an Martin Luther King orientiert. Diese eindeutige Aussage soll gewollte oder ungewollte Missverständnisse verhindern, ist doch die Identitätsdebatte von starker Polarisierung geprägt. Dabei stehen weniger die jeweiligen Argumente, sondern mehr politische Einordnungen im diskursiven Zentrum. Insofern erfolgt auch hier ausdrücklich noch einmal die Betonung: Nicht das gemeinte Engagement, sondern die damit einhergehenden Implikationen bilden das Problem. Es besteht darüber hinaus in einem Gegensatz von einem partikularen und universellen Verständnis. In den folgenden Ausführungen geht es hierbei um die Frage, ob bestimmte Gruppenidentitäten oder verallgemeinerbare Prinzipien für Wertungen relevant sein sollen. Diesbezügliche Antworten sind nicht nur für die Debatte um Identitätspolitik relevant, sie haben auch Folgen für das soziale Miteinander. Es geht um die normative Basis einer offenen Gesellschaft.
Am Beginn steht eine Definition von "Identität" bzw. (linker) Identitätspolitik (2.) und eine Erläuterung zu deren Kernpositionen (3.). Dem folgt die kritische Auseinandersetzung mit einzelnen Gesichtspunkten: dem Antiindividualismus und der Gruppenfixierung als Prinzipien (4.), der Essenzialisierung und Homogenisierung von Kulturen (5.), den Konsequenzen eines Kultur- und Menschenrechtsrelativismus (6.), der Betroffenheitsperspektive gegen Wissenschaftlichkeit (7.), der Etablierung stereotyper Geschichts- und Gesellschaftsbilder (8.) und dem partikularen statt universellen Antirassismus (9.). Ein Exkurs macht noch auf den Antisemitismus als identitätslinke Leerstelle aufmerksam (10.). Und dann wird auch auf die formalen Gemeinsamkeiten von identitätslinken und identitätsrechten Positionen (11.) verwiesen. Es geht bei diesen Ausführungen weder um pauschale Gleichsetzungen oder Verwerfungen. Die vorgetragenen Einwände beziehen sich auf die angesprochenen Implikationen.2
2. Definition: Identität – (linke) Identitätspolitik
Zunächst sollen die zentralen Arbeitsbegriffe für die vorliegende Erörterung definiert werden, wobei es auch, aber nicht nur um eine akademische Pflichtübung geht. Denn die angesprochenen Bezeichnungen kursieren im öffentlichen wie wissenschaftlichen Diskurs mit unterschiedlichen Verständnissen. Um daher mögliche Fehldeutungen des Folgenden erst gar nicht aufkommen zu lassen, sollen die zentralen Begriffe in der folgenden Erörterung zum besseren Verständnis erläutert werden. Am Beginn steht "Identität"3 : Damit ist ein Bewusstsein für mentale oder reale Gruppen- oder Wertezugehörigkeit gemeint. Diese formal gehaltene Definition von "Identität" sagt zunächst nichts darüber aus, um welche Formen und Inhalte es mit welchen Tiefen und Verbindlichkeiten gehen soll. Dazu können ethnische, geschlechtliche, kulturelle, politische, religiöse oder soziale Eigenschaften mit einem konstitutiven, maximalen oder partiellen Status zählen. Außerdem geht es um die Einstellung eines Individuums, die gegenüber einer Gruppe, Institution oder Werteordnung besteht.
Bei dem Begriff "Identitätspolitik"4 kommt noch „Politik“ als genutztem Terminus hinzu. Damit ist eine Bezeichnung für alle Einstellungen und Handlungen gemeint, welchen es um die verbindliche Ausrichtung des sozialen Miteinanders im moralischen oder rechtlichen Sinne geht. Demnach meint "Identitätspolitik" in diesem Kontext, dass die Anlehnung an eine Gruppe bzw. ein Kollektiv nicht nur für das Leben einer Person, sondern für die Praxis in der Zivilgesellschaft prägend sein soll. Die Eigenschaften der Identitätspolitik ergeben sich dann aus den Interessen, die der gemeinten Gruppe als objektiv eigenen Wertvorstellungen und Wünschen zugeschrieben werden. Dies veranschaulicht das Beispiel einer "rechten Identitätspolitik", ist sie doch an den behaupteten Einstellungen und Interessen der autochthonen Mehrheitsgesellschaft orientiert. Die identitätsrechten Akteure postulieren eine reale Gefahr für die "nationale Identität", solle doch eine darauf bezogene Einstellung etwa gegenüber "der Elite" oder "den Migranten" verteidigt werden.
Demgegenüber ist eine "linke Identitätspolitik" an bestimmten Minderheiten ausgerichtet, welche deren Akteuren aufgrund von ethnischer, geschlechtlicher, kultureller oder religiöser Orientierung als diskriminiert gelten. Dazu zählt man Homosexuelle, Muslime oder Schwarze. Aufgrund des Engagements für solche Gruppen ist hier von einer "Identitätslinken" gegenüber einer "Identitätsrechten" die Rede. Die Ausrichtung an den genannten Minderheiten bildet dabei das Unterscheidungskriterium. Indessen stellen sich bereits hier zwei grundsätzliche Fragen: Wenn "Gleichheit" für ein linkes Selbstverständnis konstitutiv ist, passt dann eine sozioökomisch eher indifferente Denkungsart in diese politische Kategorie hinein?5 Denn diesbezügliche Fragen spielen in der "Identitätslinken" kaum eine Rolle. Und zweitens: Gibt es neben den genannten Differenzen von "Identitätslinker" und "Identitätsrechter" nicht auch strukturelle Übereinstimmungen? Denn formale Gemeinsamkeiten mit umgekehrten Vorzeichen sind unübersehbar.
3. Auffassungen innerhalb linker Identitätspolitik
Bevor Antworten auf diese und andere Fragen formuliert werden, gilt es einige Auffassungen innerhalb linker Identitätspolitik zu veranschaulichen. Dazu muss zu deren konkreten Akteuren und sonstigen Erscheinungsformen konstatiert werden, dass sie als feste Organisation mit einem entwickelten Programm nicht existieren. Es geht um ein "Diskurskonstrukt" mit diversen Protagonisten. Diese eint die Ausrichtung an den folgenden Grundpositionen, was Differenzierungen und Unterschiede nicht ausschließt. Die Anhänger identitätslinker Positionen gehen davon aus, dass es eine gesellschaftlich verbreitete Diskriminierung von bestimmten Minderheiten gebe. Deren Identität und Rechte müssten gewahrt und gegenüber der Mehrheitsgesellschaft und deren Strukturen verteidigt werden. Damit einhergehen spezifische Konzepte, die inhaltliche Bezugspunkte für identitätslinke Positionen sind, sollen hier zunächst beschreibend ein gesondertes Thema sein.6 Auch dabei handelt es sich um Sammelbezeichnungen für teilweise unterschiedliche Vorstellungen.
Erstens ist damit die "Critical Race Theory", also "kritische Race7 -Theorie" gemeint. Hierbei geht es um die Aufmerksamkeit dafür, dass „race“ im Rechtssystem der USA überaus bedeutsam sei. Entgegen der Auffassung, wonach ein Gerichtsurteil von Neutralität und Objektivität geprägt wäre, gebe es Unterschiede aufgrund von Zugehörigkeiten. Insofern präge auch „race“ strukturell die Rechtsordnung, womit die Benachteiligung von Schwarzen systemisch festgeschrieben sei.8 Zweitens gehört zu den gemeinten Konzepten "Critical Whiteness", also "Kritisches Weißsein". Damit einher geht die Annahme, dass es eine gesellschaftliche Bevorzugung von Weißen geben würde. Deren Angehörige zählten zu einer "Dominanzkultur", die durch die Jahrhunderte vom Rassismus geprägt sei. Es gehe bei den Gemeinten darum, sich der bestehenden Privilegien kritisch bewusst zu sein. In beiden Fällen wird nicht in der Hautfarbe für sich das entscheidende Merkmal gesehen, handle es sich doch um ein Konstrukt für den einzunehmenden gesellschaftlichen Status.9
Drittens gehört dazu "cultural appropriation", also "kulturelle Aneignung". Es geht dabei um die Ablehnung von Handlungen, wobei Bestandteile einer als benachteiligt geltenden Kultur übernommen werden. Angehörige einer als dominant geltenden Kultur würden dabei kollektive oder persönliche Vorteile erlangen. Damit gemeint sind etwa Frisuren, Kleidungsstücke oder Musikformen, die eben einer besonderen Kultur eigen seien und ihr so durch eine Übernahme als Unterdrückungsakt entrissen werden würden.10 Und viertens sei hier "white fragility", also "weiße Empfindlichkeit" genannt. Gemeint ist damit eine Auffassung von Weißen, wonach diese über Rassismus ungern reden und sich so einer Selbstreflexion verweigern wollten. Derartige Einstellungen bestünden auch und gerade bei sich fortschrittlich wähnenden Weißen.11 Die folgenden kritischen Ausführungen bestreiten nicht einen "wahren Kern" bei den gemeinten Positionen. Sie beziehen sich auf bestimmte, ihnen eigene Elemente, die objektiv gegen universalistische Prinzipien gerichtet sind.12
4. Antiindividualismus und Gruppenfixierung als Prinzipien
Erstens soll es um den Antiindividualismus und die Gruppenidentität gehen, durchziehen doch derartige Einstellungen die identitätspolitischen Positionen. Diese Aussage setzt zunächst eine Erläuterung voraus: Die Ausrichtung am einzelnen Individuum ist konstitutiv für die kulturelle und politische Moderne, wobei der gemeinte Einzelne dabei nicht als isoliertes Wesen gedacht wird. Es geht lediglich um einen bestimmten Ausgangspunkt für soziale Ordnung, worin eben konstitutiv das Individuum mit seinen Rechten im Zentrum steht. Ihm obliegt dann in freier Entscheidung, sich einer besonderen Gruppe in unterschiedlicher Intensität zugehörig zu fühlen. Für die hier zu erörternden Aspekte ist es bei der Einschätzung einer Person wichtig, dass deren individuelles Agieren, nicht aber eine kollektive Identität den normativen Maßstab liefert. Anders formuliert: Der Charakter und nicht die Hautfarbe ist wichtig. Dieses konkrete Beispiel spielt auf bekannte Worte an, welche durch Antiindividualismus und Gruppenfixierung negiert werden.
Doch bevor diese Aussage belegt und erörtert werden soll, gilt es zunächst den Antiindividualismus zu veranschaulichen. Robin DiAngelo, die als Begründerin des erwähnten "weiße Empfindlichkeit"-Konzepts gelten kann, tritt ganz offen gegen "die Ideologie des Individualismus" ein. Dieses Denken habe die Funktion, "die Rassenhierarchie aufrechtzuerhalten."13 Damit wendet sie sich auch gegen die erwähnte Einstellung, die auf eine berühmte Aussage von Martin Luther King verwies. Er erklärte: "Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird."14 Individuelle Eigenschaften sollten demnach entscheidend sein, nicht kollektive. Für DiAngelo wurde damit "Farbenblindheit … als Mittel gegen Rassismus propagiert, und Weiße behaupteten, sie nähmen die 'Rasse' gar nicht mehr wahr …“15 Mit dieser Deutung wird indessen der Kern der gemeinten Position verkannt, geht es dabei doch um individuelle Verantwortung.
Die Autorin denkt demgegenüber in Gruppenkategorien, was auch die in den Formulierungen deutlich werdenden Pauschalisierungen veranschaulichen. Durchgängig wird die Botschaft vermittelt, dass Rassismus von den Weißen nicht wahrgenommen werde. Diese Auffassung dürfte für einige Bereiche der weißen Gesellschaft durchaus zutreffen, ist aber als allgemeine Aussage über alle Weißen faktisch unangemessen. Damit artikuliert sich die gemeinte Gruppenfixierung, die eine Aufteilung über die Rassismus-Thematik vornimmt. Einerseits bestehe die Opfergruppe der Schwarzen, andererseits die Unterdrückergruppe der Weißen. Die letztgenannte Ausrichtung geht dann mit einer Denkperspektive einher, die Unterschiede zwischen antirassistischen und rassistischen Weißen marginalisiert.16 Berichte über manche "Black Lives Matter"-Demonstrationen veranschaulichen dazu die praktischen Konsequenzen, etwa wenn auch dortigen Antirassisten pauschal ihr Weißsein vorgeworfen wird oder schwarze und weiße Demonstranten separat gehen sollen.17
5. Essenzialisierung und Homogenisierung von Kulturen
Zweitens geht es hier um die Essenzialisierung und Homogenisierung von Kulturen, welche in der Auseinandersetzung um die erwähnte "kulturelle Aneignung" deutlich wird. Dabei spielen die Einwände durchaus auf reale Probleme an. So kopieren Angehörige der weißen Mehrheitskultur etwa Mode, Musik oder Rituale aus anderen kulturellen Zusammenhängen. Ein hier immer wieder genanntes Beispiel sind die Dreadlocks als Frisur. Derartiges Agieren gilt als eine nicht legitime Aneignung aus einer anderen Kultur, welche als Ausdruck und Fortsetzung von Kolonialismus oder Rassismus wahrgenommen wird. Denn dadurch würden Geschäfte gemacht und Selbstdarstellungen gefördert, insofern handele sich um reale oder symbolische Benachteiligungen gegenüber diesen Kulturen und deren Repräsentanten. So meinte etwa Alice Hasters, Autorin des Buchs "Was weiße Menschen über Rassismus wissen sollten", angesichts einer Kopie von afrikanisch geprägten Möbeln, Musik, Ritualen oder Schmuck durch Weiße: "Es ist eine Fortsetzung kolonialer Strukturen."18
Auch wenn derartige Argumentationsmuster einen wahren Kern aufweisen, ergibt sich daraus eine problematische Position in einer nachfolgenden Verallgemeinerung. Denn hier artikulieren sich noch andere Implikationen: Sie bestehen in Annahmen über kulturelle Besonderheiten, die eben nur oder primär einer Kultur als innerem Wesen eigen sind. Gleichzeitig soll keine Aneignung durch Angehörige einer anderen Kultur erfolgen. Damit sehen die Anhänger dieses Denkens in den gemeinten Kulturen abgeschlossene und homogene Projekte. Denkt man diese Annahmen in ihrer Konsequenz weiter, würde dies auf die Etablierung "geschlossener Gesellschaften" hinauslaufen. Nur Angehörige besonderer Kulturen könnten dann entsprechend geprägte Kulturgüter nutzen oder Verhaltensweisen praktizieren. Derartige Auffassungen laufen aber in der Konsequenz, die hier bezüglich der gesellschaftlichen Folgen für das soziale Miteinander mitgedacht werden sollte, auf kulturelle Reinheitsvorstellungen und damit auf entsprechende Trennungen hinaus.
Indessen äußern sich die Anhänger des gemeinten Denkens nicht genauer hinsichtlich der Maßstäbe für die Praxis, was dann epistemologisch und nicht polemisch zu konkreten Rückfragen motiviert: Darf Falafel dann nicht mehr von Weißen gegessen werden? Darf dann Jazz nicht mehr von Weißen gespielt werden? Darf dann Rap von Weißen nicht mehr gehört werden? Bestimmte Eigenschaften aus einer Kultur lassen sich nicht nur exklusiv einer Kultur zuschreiben. In Form und Inhalt können sie identisch oder reformiert in anderen kulturellen und sozialen Zusammenhängen vorkommen. Gerade dadurch erfolgen kulturelle Bereicherungen und Weiterentwicklungen, welche eben durch Essenzialisierungen und Homogenisierungen verhindert werden würden. Die gegen "kulturelle Aneignung" vorgebrachten Einwände hätten demnach fatale Konsequenzen für eine kulturelle Vielfalt.19 Gerade die kulturell offenen Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft wären davon betroffen. Um im Beispiel zu bleiben: Dreadlocks werden weniger von Rassisten getragen.
6. Konsequenzen eines Kultur- und Menschenrechtsrelativismus
Drittens sollen die Konsequenzen eines Kultur- und Menschenrechtsrelativismus angesprochen werden, wobei es insbesondere um die Folgen der erwähnten Gruppenfixierung geht. Denn das identitätslinke Denken ist an bestimmten Kollektiven und ihren Kontexten, aber eben nicht an universellen Werten orientiert. Dabei gilt die Auffassung von Benachteiligung als entscheidendes Kriterium, etwa wenn Rassismus als System für eine Weltordnung verstanden wird. Die für "rassifizierte Gruppen" bestehende Hierarchie "lautet, ganz grob, so: Weiße ganz oben, Schwarze ganz unten."20 Diese Einschätzung der erwähnten Alice Hasters trifft für das rassistische Selbstverständnis zu. Indessen wird diese Auffassung dann mit der pauschalen Gruppenzugehörigkeit umgedreht, wonach es eben die Opfergruppe und die Unterdrückergruppe als Schwarze und Weiße gibt. Ähnliche Auffassungen kursieren zu anderen, als diskriminiert geltenden Minderheiten, etwa wenn Muslime primär als Objekte eines kursierenden "antimuslimischen Rassismus" wahrgenommen werden.
Dass deren Angehörige eine kritikwürdige Benachteiligung erfahren, soll hier nicht in Abrede gestellt werden, geht es doch um einen anderen Gesichtspunkt: die externen Einwänden gegenüber geschlossener Gruppen- bzw. Kulturidentität. Denn wenn ein bestimmtes Kollektiv pauschal als Opfer gilt, dann gilt nahezu jeder Einwand gegen dessen innere Gegebenheiten als rassistisch. Dass es ein bedeutsames Ausmaß von Frauenunterdrückung oder Homosexuellenfeindlichkeit unter Muslimen oder Schwarzen gibt, wird so hinsichtlich der Aufmerksamkeit für beide als diskriminierte Gruppen wahrgenommene Kollektive zu einem Tabuthema. Im identitätslinken Diskurs existiert auch kein inhaltlicher Maßstab, womit hier Einwände und Kritik begründet vorgetragen werden könnten. Diese stünden für eine normative Auffassung von Menschenrechten im universellen Sinne, die also nicht ihre inhaltliche Grenze an einer besonderen Kollektividentität hätte. Damit bestünde auch eine erklärte Frontstellung gegen einen hier präsenten Kulturrelativismus.
Gemeint ist damit eine postulierte Gleichrangigkeit von Kollektiven und Kulturen, wobei etwa die Einhaltung von Menschenrechten keine sonderliche Relevanz mehr hätte. Da aber der identitätslinke Diskurs angebliche Opferkollektive pauschal in Schutz nehmen will, läuft diese Denkungsart auf kultur- wie menschenrechtsrelativistische Konsequenzen hinaus. Normative Ansprüche gelten in diesem Sinne zutreffend als universalistische Werte. Dagegen positioniert sich etwa die als muslimische Feministin bekannt gewordene Kübra Gümüsy, die darin nur ein Herrschaftsinstrument sieht: "Um ihre eigene, partikulare Sicht auf die Welt zu einer universellen zu erklären, geben die Benennenden ihr Namen: universal, neutral, rational, objektiv."21 Angemessen an diesen Einwänden ist, dass die Menschenrechte auch vom Westen politisch instrumentalisiert wurden. Dies spricht aber nicht gegen deren kulturübergreifende Bedeutung für die Gestaltung des sozialen Miteinanders, was auch und gerade die Ablehnung von Minderheitenfeindlichkeit und Rassismus einschließt.
7. Betroffenheitsperspektive statt Wissenschaftlichkeit
Viertens soll die Ausrichtung an der Betroffenheitsperspektive statt der Wissenschaftlichkeit kritisch thematisiert werden. Es geht dabei um den Anspruch innerhalb der Identitätslinken, dass die Diskriminierung von Minderheiten nur von Minderheitenangehörigen angemessen thematisiert werden könne.22 Darüber hinaus wird auch im "Geschichten erzählen" ("storytelling") eine höhere Wahrheit gesehen.23 Beide Auffassungen machen berechtigt darauf aufmerksam, dass Benachteiligungen von Betroffenen anders als von Unbeteiligten empfunden werden. Diese besondere Perspektive müsste eine differenzierte Wahrnehmung mit berücksichtigen. Gleichwohl sollen dabei dann die Akteure von Aussagen und nicht deren Inhalte im Zentrum stehen. Die bereits erwähnte DiAngelo bemerkte: "Ich frage nicht: 'Ist diese Behauptung wahr oder falsch?' … Stattdessen frage ich: 'Welche Funktion erfüllt diese Behauptung im Gespräch?'"24 Durch diese Denkweise erfolgt für Gültigkeitsansprüche aber eine Verschiebung: hin zum persönlichen Empfinden, weg vom objektiven Sachverhalt.
Welche Folgewirkungen derartige Positionen hätten, macht ein Fallbeispiel zur Veranschaulichung deutlich: Ein bekannter Historiker sollte zur Kolonialismuswahrnehmung in der afrikanischen Welt sprechen. Er gehörte zu den bedeutendsten deutschen Forschern zum Thema, ist aber Weißer. Dies motivierte die Kommunikationssoziologin Natasha A. Kelly dazu, sich erfolgreich gegen dessen öffentlichen Auftritt zum Thema auszusprechen. Er könne nur aus einer weißen Perspektive und nicht für uns sprechen. Mit "uns" meinte Kelly allgemein die Schwarzen. Ein weißer Mann, so äußerte sie weiter, sei nicht in der Lage, die Perspektive schwarzer Menschen einzunehmen. Dabei gehe es nicht um den angesprochenen Historiker, sondern um das Machtsystem. Gemeint war ein "struktureller Rassismus".25 Diese Aussage setzt offen die Betroffenheits- gegen die Wissenschaftsperspektive. Es lässt sich ansonsten kaum mit Argumenten begründen, warum Folgewirkungen des Kolonialismus nicht auch von einem Weißen auf Wissenschaftsbasis thematisiert werden könnten.
Derartige epistemologische Auffassungen öffnen indessen dem ideologisch instrumentalisierenden Missbrauch den diskursiven Weg. Denn dann müssen bestimmte Kategorien nicht mehr über einen Merkmalskatalog definiert werden, genügt doch das von angeblichen Betroffenen artikulierte subjektive Empfinden. Auch vor Gericht ist bekanntlich der entscheidende Maßstab nicht die gemeinte Opferperspektive, sondern ein nach sorgfältiger Prüfung erfolgtes neutrales Urteil. Die erwähnte Auffassung richtet sich gegen ein solches Denken und damit ebenso gegen ein konstitutives Prinzip von Wissenschaftlichkeit. Deutlich wird dies bei den identitätspolitischen Diskursen etwa anhand der "Islamophobie"-Kategorie: Die Anhänger des Konzepts legen keinen trennscharfen Merkmalskatalog dazu vor, diffamieren aber mit dieser Bezeichnung willkürlich kritische Stimmen. So gelten dann Einwände gegen Frauendiskriminierung oder Judenfeindschaft unter Muslimen als "islamophob", mitunter auch bei liberalen Muslimen.26
8. Etablierung stereotyper Geschichts- und Gesellschaftsbilder
Fünftens soll die Etablierung stereotyper Geschichts- und Gesellschaftsbilder angesprochen werden, wobei es um eine einseitige bis falsche Deutung der westlichen Demokratien und deren durchaus nicht unproblematischer Vergangenheit geht. Dort entstanden Auffassungen zu kulturellen Räumen, die von Einseitigkeiten und Klischees mit normativen Verwerfungen verbunden sind. Dies kritisieren Identitätslinke durchaus zutreffend, wenn etwa von der herabwürdigenden "Orientalismus"-Vorstellung gesprochen wird. Diese Bezeichnung wurde von dem amerikanisch-palästinensischen Literaturwissenschaftler Edward Said geprägt, welcher in seinem gleichnamigen Buch auf das negative Konstrukt von einem "Orient" aufmerksam machen wollte.27 Damit würden Gesellschaften des Nahen Ostens allgemein als "bedrohlich", "mysteriös" oder "rückständig" wahrgenommen. So sei erst das Gegenbild vom "Orient" im Westen entstanden. Auch wenn dazu eine differenziertere Betrachtung nötig wäre, kann dieser Grundaussage eingeschränkt zugestimmt werden.
Gegenüber einer derartigen einseitigen Betrachtungsweise postulieren Identitätslinke ihren "Okzidentalismus", der das Bild von einem "imperialistischen", "materialistischen" und "rassistischen" Westen vermittelt. Die Bezeichnung stammt von Ian Buruma und Avishai Margalit, ein niederländischer Journalist und ein israelischer Philosoph, die in einem ebenso betitelten Buch diverse Gemeinsamkeiten von Feinden westlicher Gesellschaften und Werte herausarbeiteten.28 Dabei erblickten sie die ideengeschichtlichen Grundlagen dafür nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der westlichen Welt. Beide Fehldeutungen haben ihre wahren Kerne, gleichwohl stellen "Okzidentalismus" und "Orientalismus" ideologische Zerrbilder dar. Denn die aufklärerischen Errungenschaften werden von der Identitätslinke hinsichtlich des Westens ignoriert. Damit geraten auch die normativen Grundlagen, die einen universellen Antirassismus mit Gleichwertigkeit, Individualismus und Menschenrechten normativ prägen, aus der Wahrnehmung als eben relevantem Wertefundament.
Derartige Einseitigkeiten kann man auch in den Geschichtsbildern wahrnehmen, wofür als Beispiel die Geschichte der Sklaverei gelten soll: Es gehört zu Doppelmoral und Heuchelei, wenn die fundamentale Gleichwertigkeit von Menschen als konstitutives Prinzip des Selbstverständnisses beschworen wird und gleichzeitig im gesellschaftlichen Leben dann Menschen in der Sklaverei als verhandelbare Ware gelten. Genau diese Gegebenheit prägte dauerhaft und wirksam die frühe Geschichte der USA, ein bedeutender Teil des Westens. Die Empörung darüber ist angesichts der Fernwirkungen auch heute noch wichtig. Gleichwohl darf die Einsicht in diese historischen Fakten nicht vergessen machen, dass das Ausmaß und die Dauer der Sklaverei in der afrikanischen und arabischen Welt bedeutend höher waren.29 In Frankreich endete sie 1794 (bzw. 1848), in Großbritannien 1807, demgegenüber im Iran 1928 und in Saudi Arabien 1962. Doch die Identitätslinke blickt häufig nur auf die Sklaverei im Westen, während die Erinnerung an sie in anderen Regionen meist ein Tabu ist.
9. Antirassismus in partikularer und universeller Perspektive
Und sechstens soll der partikulare zugunsten des universellen Antirassismus einer kritischen Betrachtung unterzogen werden. Dazu bedarf es zunächst einer definitorischen Erläuterung: Die partikulare Auffassung ist vor allem auf spezifische Gruppen fixiert und streitet mitunter Rassismus für andere Varianten ab. Demnach mangelt es dabei an einer allgemeinen Blickrichtung, eben in Form einer universellen Perspektive. Diese Auffassung sieht in allen Diskriminierungsformen, die auf eine behauptete ethnische Besonderheit als inhaltliches Kriterium bezogen ist, letztendlich Formen von Rassismus. Demgegenüber erfolgen hierzu Ausweitungen wie Einschränkungen, die von Exponenten der Identitätslinken vorgenommen werden. Der letztgenannte Aspekt wird etwa in der Auffassung deutlich, dass es keinen Rassismus gegen Weiße geben könne und auch nie gegeben habe. Denn nur Angehörige einer Dominanzkultur könnten einschlägige Handlungen umsetzen, da eine existente Machtstruktur für Rassismuswahrnehmungen eine notwendige Vorgabe sei.
Dafür steht Susan Arndt, eine Anglistin und Kulturwissenschaftlerin, die auf eine selbst gestellte Frage "Gibt es auch in Ghana Rassismus?" antwortete: "Wenn weiße Migrant_innen aus Portugal oder Italien diskriminiert werden, handelt es sich nicht um Rassismus."30 Und in einem Interview postulierte sie als abgesichertes Wissen, "dass Schwarze Weiße nicht rassistisch diskriminieren können, denn es ist das Wesen des Rassismus, die Überlegenheit von Weißen und deren Privilegien, Diskriminierung und Gewalt zu postulieren."31 Diesen Ausführungen kann bezogen auf die Geschichte und Gesellschaft zugestimmt werden, gleichwohl ignorieren sie Benachteiligungen in anderen Dominanz- bzw. Mehrheitsverhältnissen. Dazu würde das im Beispiel genannte Ghana als Land gelten, wo Schwarze eben sehr wohl Weiße rassistisch kommentieren könnten. Denn allgemein ist damit eine Diskriminierung aufgrund von ethnischen Merkmalen gemeint, eben unabhängig von einer schwarzen oder weißen Hautfarbe des betroffenen Opfers.
Die gegenteilige Auffassung hat denn auch merkwürdige Konsequenzen. Die erwähnte Kommunikationssoziologin Natasha A. Kelly meinte: "Rassismus gegen weiße Menschen gibt es … nicht und hat es auch noch nie gegeben …"32 Derartige Aussagen ignorieren nicht nur die Judenverfolgung und Shoah, die eben für Rassismus von Weißen gegen andere Weiße stehen. So wird auch in umgekehrter Denkperspektive ignoriert, dass es einen von Schwarzen an Schwarzen begangenen Völkermord geben konnte. Dafür stehen die Ereignisse 1994 in Ruanda, wo bis zu eine Millionen eben Opfer eines Rassismus wurden. Der erwähnte partikulare Antirassismus kann dies nicht zur Kenntnis nehmen, ein Antirassismus im universellen Sinne schon. Die vorgetragenen Einwände richten sich gegen diese eingeschränkte Perspektive. Ihr kann die Aussage "Nicht mein Antirassismus" der türkischstämmigen Journalistin Canan Topcu entgegengestellt werden, welche gegen die Etablierung neuer Fronten durch eine pauschale Opfer-Täter-Zuschreibung votiert.33
10. Exkurs: Antisemitismus als identitätslinke Leerstelle
Und dann soll noch in einem Exkurs für die Identitätslinke auf eine auffällige Leerstelle aufmerksam gemacht werden. Man engagiert sich für diverse Minderheiten, wozu Diverse, Muslime oder Schwarze zählen. Indessen fällt auf, dass eine bestimmte Minderheit bei den vielen Minderheiten fehlt: die Juden. Warum geht es nicht auch gegen Antisemitismus, denn Juden werden nach wie vor bedroht? Allgemein wird ein Anstieg nicht nur für Deutschland, sondern für viele andere Länder konstatiert. Doch warum ist das bei der Identitätslinken kein relevantes Thema? Dafür gibt es wohl unterschiedliche Gründe. In bekannten Fällen von Gewalthandlungen waren es besondere Täter: arabischstämmige Muslime. Damit gehören sie auch einer diskriminierten Minderheit an. Indessen macht dieses Fallbeispiel deutlich: Angehörige einer benachteiligten Gruppe können auch selbst diskriminierend gegenüber Angehörigen einer anderen Gruppe wirken. Diese Einsicht passt indessen nicht in das von anderen Gegensätzen und Konfliktlagen dominierte identitätslinke Weltbild.
Denn dort gibt es nach den behandelten Auffassungen eine Dominanzkultur der Weißen, wovon dann die Diskriminierung von Minderheitenangehörigen ausgeht. Und insofern kann es aus dieser Denkperspektive keinen Rassismus von Schwarzen gegen Weiße geben. Doch wie steht es um die Angriffe in den genannten Fällen? Denn die erwähnten Juden waren auch Weiße. Gehörten sie damit ebenfalls einer Dominanzkultur an? Wie würde man diese Dominanzkultur benennen? Oder sollte sich in den Gewalthandlungen nur eine überspitzte "Israelkritik" artikulieren? Und gehörten die betroffenen Juden irgendwie zu diesem Kollektiv? Waren sie gar individueller Bestandteil eines "zionistischen Kollektivs"? Man könnte derartige Gedanken noch weiter spinnen, um die Absurdität mancher identitätslinker Denkungsarten gerade in der Frage der Judenfeindschaft und deren Konsequenzen zu veranschaulichen. Deutlich machen die Ausführungen aber schon hier: Es geht nicht grundsätzlich um alle Diskriminierungen und alle Minderheiten.
Durch die empirische Forschung in europäischen Ländern ist bekannt, dass antisemitische Einstellungen unter Muslimen überdurchschnittlich stark präsent sind. Sie liegen gegenüber den befragten Christen zwei- bis dreifach höher.34 Doch warum ist das in der Identitätslinken kein Thema? Eine Antwort lautet: Die Einsicht in diese Fakten stört ein simples Weltbild. Es orientiert sich an diskriminierten Gruppenidentitäten, nicht an universellen Menschenrechten. Ansonsten würde man Benachteiligungen nicht nur durch Individuen der Mehrheitsgesellschaft, sondern auch durch Individuen der Minderheitsgesellschaften kritisieren. Antisemitismus in Einstellungen und Handlungen lässt sich eben auch in solchen Kontexten ausmachen. Eine identitätspolitische Blickrichtung geht aber dualistisch von einer diskriminierenden Mehrheitsgesellschaft und diskriminierten Minderheitengesellschaften aus, was in dieser Pauschalität ohnehin nicht der sozialen Realität entspricht. Für Antisemitismus kann in diesem Dualismus dann aber keine Einordnung vorgenommen werden.
11. Formale Gemeinsamkeiten mit der Identitätsrechten
Abschließend soll noch auf die formalen Gemeinsamkeiten von Identitätslinker und Identitätsrechter hingewiesen werden.35 Dabei geht es nicht um eine Gleichsetzung beider Strömungen, was angesichts inhaltlicher Unterschiede unangemessen wäre. Denn während sich die Identitätslinke für diskriminierte Minderheiten engagieren will, will die Identitätsrechte für die autochthone Mehrheitsgesellschaft eintreten. Beide können für diesen Anspruch übrigens keine demokratische Legitimation vorweisen, fehlt es doch an Belegen für eine in den jeweiligen Bezugsgruppen existierende mehrheitliche Zustimmung.36 Gleichwohl bestehen fundamentale Differenzen hinsichtlich der propagierten Einstellungen, die etwa einmal für und einmal gegen Minderheitenrechte orientiert sind. In diesen inhaltlichen Auffassungen und den diversen Bezugsgruppen lassen sich denn auch die konstitutiven Unterschiede festmachen. Es gibt im jeweiligen Denken aber auch formale Gemeinsamkeiten, wobei sich nur die inhaltlichen Vorzeichen unterscheiden.
Beiden sind ein Antiindividualismus und eine Gruppenfixierung eigen, kommt doch der Identität gegenüber einem Kollektiv ein hoher Stellenwert zu. Bei der Identitslinken geht es um die angesprochene Minderheit, bei der Identititätsrechten um die behauptete Nation. Beide gehen auch von einer Essenz in der jeweiligen Kultur aus, welche nicht nur Bestand hat, sondern auch keiner Kritik ausgesetzt werden sollte.37 Bei der Identitätslinken ist es etwa das Muslimsein, bei der Identitätsrechten ist es die Volkszugehörigkeit. Beiden ist auch die Hautfarbe als Kategorie zur Unterscheidung wichtig. Dabei ist sie bei der Identitätslinken bezogen auf den Opferstatus, bei der Identitätsrechten hinsichtlich einer Volksidentität wichtig. Beide betreiben einen Kultur- und Menschenrechtsrelativismus, womit individuelle Grundrechte im universellen Sinne nicht mehr so relevant sein sollen. Bei der Identitätslinken sieht man darin Kritikpotentiale gegenüber Minderheiten, bei der Identitätsrechten unangemessene Interventionen in die nationale Souveränität.
Beide nehmen in der Bilanz eine partikularistische gegen eine universalistische Perspektive ein. Und genau in dieser Denkperspektive besteht auch ein Gefahrenpotential, das etwa die Menschenrechte in einem universalistischen Sinne relativieren will. Sie werden damit nicht mehr als Individual-, sondern als Kollektivrechte verstanden. Diese sollen sich in der Gesellschaft für die Identitätslinke auf bestimmte Minderheiten beziehen, während die Identitätsrechte damit Nationen oder Völker meint. Im öffentlichen Diskurs wirbt dabei die Identitätsrechte für Positionen, die von der Identitätsrechten zu ihrer Selbstlegitimation genutzt werden können. Dies macht etwa der beiderseitige Anspruch auf "Differenz" deutlich, ähnliches gilt für gesellschaftliche Konsequenzen einer "Separierung". Derartige Auffassungen von links brauchen nur von rechts mit anderen Inhalten gefüllt werden. "Im Ernst, diese linke Identitätspolitik", so die US-amerikanische Philosophin Susan Neiman, "öffnet nicht nur Türen, sie öffnet ganze Häuser der Rechten."38
12. Schlusswort und Zusammenfassung
Die kritischen Anmerkungen zu linker Identitätspolitik beabsichtigten nicht deren komplette Verwerfung. Aus den allgemeinen Auffassungen lassen sich auch bedeutsame Einsichten ableiten, welche für die differenzierte Analyse von diversen Minderheitendiskriminierungen relevant sind. Gemeint sind hier folgende Gesichtspunkte: Ein Alltagsrassismus wird vielfach von Mehrheitsangehörigen nicht wahrgenommen, hat aber soziale Folgen für Minderheitenangehörige. Die Beschäftigung mit Rassismus ist für Schwarze "normal", nicht aber notwendigerweise für Weiße. Angehörige der Mehrheitsgesellschaft sollten hinsichtlich ihres Sozialstatus hier kritisch reflektierend genauere Überlegungen anstellen. Auch als anders erscheinende Identitätsmerkmale haben in einem gesellschaftlichen Pluralismus einen legitimen Stellenwert, was als Einsicht einen notwendigen Respekt im Sinne von sozialer Würde nach sich zieht sollte. Gleichwohl dürfen diese Einsichten sich nicht gegen die für das gesamtgesellschaftliche Miteinander relevanten universellen Prinzipien richten.
Eine diesbezügliche Gefahr ergibt sich durch die partikularistischen Prägungen des identitätslinken Selbstverständnisses, das auf angeblich homogene Gruppen von Minderheitenangehörigen orientiert ist. Aufgrund der damit einhergehenden Fixierung auf Identität und Kollektive ignoriert man aber damit einhergehende problematische Positionen. Sie bestehen in einem ausgeprägten Antiindividualismus und Menschenrechtsrelativismus, welche geschlossene Gesellschaften von Identitätskollektiven entstehen lassen. Darin können nicht nur aufgrund der Gruppenidentität jeweils Individualrechte erodieren, sondern auch die normative Basis für ein größeres soziales Miteinander. Man hätte es statt einer Gesellschaft freier Individuen mit unterschiedlichen Kollektiven mit partikularen Wertefundamenten zu tun. So entfiele aber auch die allgemein geteilte Basis dafür, wie Konfliktregelungen erfolgen sollten.39 Es ginge dann bei Gruppenbildungen nicht mehr um einen Pluralismus mit einem nicht-kontroversen Sektor, sondern um eine Spaltung über kollektive Zuordnungen.
Die erwähnten identitätslinken Diskurse fördern bewusst oder unbewusst derartige Entwicklungen. Mitunter deuten einzelne Autoren auch bestimmte Konsequenzen an, was ein Auszug aus dem Grundlagenwerk zur "kritischen Race-Theorie" zeigt, worin die beiden Juristen Richard Delgado und Jean Stefancic schrieben: "Im Gegensatz zum traditionellen Diskurs über Bürgerrechte, der den schrittweisen Fortschritt betont, stellt die Kritische Race-Theorie die liberale Ordnung ganz grundsätzlich infrage – inklusive des Gleichheitsgrundsatzes, des Abwägens rechtlicher Argumente, des Rationalismus der Aufklärung und des Neutralitätsprinzips der Verfassung."40 Derartige deutliche Bekundungen bedürfen hier keiner ausführlichen Kommentierung. Sie machen aber bezogen auf identitätslinke Grundpositionen deutlich, dass berechtigte Diskriminierungskritik fatale Konsequenzen etwa für rechtsstaatliche Selbstverständlichkeiten hätte. Einem universalistischen Antirassismus würden so die normativen Grundlagen entzogen.
- Alle maskulinen Funktions- und Personenbezeichnungen meinen Menschen unterschiedlichster geschlechtlicher Identität in gleicher Weise. ↩︎
- Um den Anmerkungsapparat nicht zu überlasten, werden fortan nur zwei Titel bei Verweisen angegeben. ↩︎
- Vgl. Kwame Anthony Appiah, Identitäten. Die Fiktionen der Zugehörigkeit, Berlin 2019; Ursula Renz, Was denn bitte ist kulturelle Identität? Eine Orientierung in Zeiten des Populismus, Basel 2019. ↩︎
- Vgl. Georg Auernheimer, Identität und Identitätspolitik, Köln 2020; Lea Susemichel/Jens Kastner, Identitätspolitiken. Konzepte & Kritiken in Geschichte & Gegenwart der Linken, Münster 2018. ↩︎
- Diesbezügliche Einwände erheben Repräsentanten der traditionellen Soziallinken, vgl. Walter Benn Michaels, The Trouble with Diversity. How We Learned to Love Identity and Ignore Inequality, 10. Auflage, New York 2016; Sahra Wagenknecht, Die Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm – für Gemeinsinn und Zusammenhalt, Frankfurt/M. 2021, S. 21-139. ↩︎
- Neben den im Folgenden vier genannten hinaus kursieren noch andere identitätslinke Konzepte, welche hier aber nicht alle thematisiert werden können. Bedeutsam ist etwa der „Postkolonialismus“, vgl. kritisch dazu den Sammelband: Jan Gerber (Hrsg.), Die Untiefen des Postkolonialismus (Hallische Jahrbücher #1), Berlin 2021 ↩︎
- Die Formulierung "race" wird im englischsprachigen Raum wertneutral genutzt, während man "Rasse" im deutschsprachigen Raum eben mit rassistischen Vorstellungen verbindet. Um durch die Begriffsnutzung keine Irritationen aufkommen zu lassen, nutzt die vorliegende Erörterung immer "race" ohne Übersetzung. ↩︎
- Vgl. Richard Delgado/Jean Stefancic, Critical Race Theory. An Introduction, 3. Auflage, New York 2017; Kendall Thomas (Hrsg.), Critical Race Theory. The Key Writings That Formed The Movement, New York 1996. ↩︎
- Vgl. Masiha Eggers u.a. (Hrsg.), Mythen, Masken und Subjekte. Kritische Weißheitsforschung in Deutschland, Münster 2017; Martina Tißberger, Critical Whiteness. Zur Psychologie hegemonialer Selbstreflexion an der Intersektion von Rassismus und Gender, Wiesbaden 2017. ↩︎
- Vgl. M. M. Eboch (Hrsg.), Cultural Appropriation, New York 2019; Greg Tate (Hrsg.), Everything But The Burden. What White People are Taking From Black Culture, New York 2003. ↩︎
- Vgl. Mohamed Amjahid, Der weiße Fleck. Eine Anleitung zu antirassistischem Denken, München 2021; Robin DiAngelo, Wir müssen über Rassismus sprechen. Was es bedeutet, in unserer Gesellschaft weiß zu sein, Hamburg 2020. ↩︎
- Vgl. aus feministischer Blickrichtung die vehemente Polemik: Caroline Fourest, Generation beleidigt. Von der Sprachpolizei zur Gedankenpolizei. Über den wachsenden Einfluss linker Identitärer. Eine Kritik, Berlin 2020. ↩︎
- DiAngelo, Wir müssen über Rassismus sprechen (Anm. 11), S. 35. ↩︎
- Martin Luther King, I Have A Dream Speech – August 28, 1963, in: www.youtube.com. ↩︎
- DiAngelo, Wir müssen über Rassismus sprechen (Anm. 11), S. 76. ↩︎
- Darauf weisen auch selbstkritische Anhänger linker Identitätspolitik gelegentlich hin, vgl. Susemichel/Kastner, Identitätspolitiken (Anm. 4), S. 90. ↩︎
- Vgl. Johanna Soll, Zeit für Forderungen statt Wünsche, in: taz vom 25. Mai 2021, S. 13. ↩︎
- Alice Hasters, Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, München 2019, S. 88. ↩︎
- Dies deuten auch selbstkritische Anhänger linker Identitätspolitik an, vgl. Susemichel/Kastner, Identitätspolitiken (Anm. 4), S. 11 und 69. ↩︎
- Hasters, Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen (Anm. 18), S. 15. ↩︎
- Kübra Gümüsay, Sprache und Sein, 17. Auflage, München 2021, S. 58. ↩︎
- Vgl. Charlotte Busch, Mimosen, Mimesis und Mimi, in: Eva Berendsen/Saba-Nur Cheema/Meron Mendel (Hrsg.), Trigger Warnung. Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen, Berlin 2019, S. 41-52; Hilal Sezgin, Verzeihen statt Pingpong spielen, in: ebenda, S. 37-39. ↩︎
- Vgl. Delgado/Stefancic, Critical Race Theory (Anm. 8), S. 44-57. ↩︎
- DiAngelo, Wir müssen über Rassismus sprechen (Anm. 11), S. 121. ↩︎
- "Schweig alter Mann“" Wie Identität spaltet (ZDF-Sendung) (3. Mai 2021), in: www.youtube.de. ↩︎
- Vgl. Armin Pfahl-Traughber, Die fehlende Trennscharfe des "Islamophobie"Konzepts in der Vorurteilsforschung. Ein Plädoyer für das Alternativ-Konzept "Antimuslimismus" bzw. "Muslimenfeindlichkeit", in: Gedeon Botsch (Hrsg.) Islamophobie und Antisemitismus – ein umstrittener Vergleich, Berlin 2012, S. 11-28; Armin Pfahl-Traughber, „"slamophobie" und "Antimuslimischer Rassismus“"– Dekonstruktion zweier Hegemoniekonzepte aus menschenrechtlicher Perspektive, in: Zeitschrift für Politik, 67. Jg., Nr. 2/2020, S. 133-152. ↩︎
- Vgl. Edward Said, Orientalismus (1978), Frankfurt/M. 2009. Auf die Debatte und Kritik dazu kann hier aus Raumgründen nicht eingegangen werden. ↩︎
- Vgl. Ian Buruma/Avishai Margalit, Okzidentalismus. Der Westen in den Augen seiner Feinde, München 2005. ↩︎
- Vgl. Tidane N’Diaye, Der verschleierte Völkermord. Die Geschichte des muslimischen Sklavenhandels in Afrika, Reinbek 2010; Bernard Lewis, Race and Slavery in the Middle East. An historical Enquiry, Oxford 1990. ↩︎
- Susan Arndt, Rassismus. Die 101 wichtigsten Fragen, München 2015, S. 30. ↩︎
- Susan Arndt, Das Ende der Überlegenheitsarie (Interview) (21. April 2020), in: www.taz.de. ↩︎
- Natasha A. Kelly, Rassismus. Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen!, Zürich 2021, S. 10 ↩︎
- Vgl. Canan Topcu, Nicht mein Antirassismus. Warum wir einander zuhören sollten, statt uns gegenseitig den Mund zu verbieten. Eine Ermutigung, Köln 2021, S. 9-18. ↩︎
- Vgl. Günther Jikeli, Antisemitismus unter Muslimen in Deutschland und Europa, in: Olaf Glöckner/Günther Jikeli (Hrsg.), Das neue Unbehagen. Antisemitismus in Deutschland heute, Hildesheim 2019, S. 49-72; Ruud Koopmans, Religious fundamentalism and hostility against outgroups. A comparison of Christians and Muslims in Western Europe, in: Journal of Ethnic and Migration Studies 41 (2015), S. 33-57. ↩︎
- Vgl. Hendrik Hansen, Linke und rechte Identitätspolitik. Ein Vergleich der poststrukturalistischen wende im Linksextremismus mit dem Ethnopluralismus und Nominalismus der Neuen Rechten, in: Hendrik Hansen/Armin Pfahl-Traughber (Hrsg.), Jahrbuch für Extremismus- und Terrorismusforschung 2019/20 (II), Brühl 2021, S. 242-289; Armin Pfahl-Traughber, Antiindividualismus und Antiuniversalismus als Konsequenz. Die Gemeinsamkeiten von Identitätslinker und Identitätsrechter, in: perspektiven ds, 37. Jg., Nr. 2/2020, S. 137-152. ↩︎
- Autoren aus den gemeinten Minderheitenkontexten haben identitätslinke Positionen ebenfalls vehement kritisiert, vgl. Hamed Abdel-Samad, Schlacht der Identitäten. 20 Thesen zum Rassismus – und wie wir ihm die Macht nehmen, München 2021; Judith Sevinc Basad, Schäm dich! Wie Ideologinnen und Ideologen bestimmen, was gut und böse ist, Frankfurt/M. 2021. ↩︎
- Auch selbstkritische Anhänger linker Identitätspolitik sehen hier kaum noch Unterschiede, vgl. Michel/Kastner, Identitätspolitiken, S. 89. ↩︎
- Susan Neiman, "Das ist die Anziehungskraft des Grusels" (Interview), in: Cicero, Nr. 9 vom September 2020, S. 24-26, hier S. 26. ↩︎
- Vgl. Kenan Malik, Das Unbehagen in den Kulturen. Eine Kritik des Multikulturalismus und seiner Gegner, Frankfurt/M. 2017; Cinzia Sciuto, Die Fallen des Multikulturalismus. Laizität und Menschenrechte in einer vielfältigen Gesellschaft, Zürich 2020. ↩︎
- Delgado/Stefancic, Critical Race Theory (Anm. 8), S. 3. ↩︎






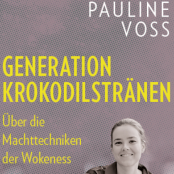

8 Kommentare
Kommentare
David Z am Permanenter Link
Sehr gute Zusammenfassung, vielen Dank dafür.
In Bezug auf die Gefahren der identity policies und ihren Auswüchsen: Wenn Behauptungen nicht mehr mit Sachlichkeit, ratio, Logik und Vernunft unterlegt werden, sondern gleichsam Religionen esoterisch, dogmatisch und totalitär - ja teilweise sogar rassistisch und antisemitisch - begründet werden, dann liegt es auf der Hand, dass Probleme vorprogrammiert sind.
Es gibt im Englischen den schönen Satz, der hier mMn sehr gut zu passt:
"Those who can make you believe absurdities, can also make you commit atrocities".
Die Radikalität, mit der viele dieser Ideen vorgetragen werden, ist (bisher) zwar nur selten physisch, aber die Gewalt in Wort und Schrift ist definitiv erkennbar.
MMn hat das Problem aber noch eine andere Seite: Nämlich den Umstand, dass die Mehrheitsgesellschaft sich diese Narrative ohne spürbaren Widerwillen gefallen lässt - ja sogar auf den Wagen mit aufspringt, siehe Medien, Unis und Unternehmen. Diese Facette des Problems ist womöglich sehr viel gravierender als der Teil, der durch das Aussprechen von kruden Ideen und Forderungen entsteht. Denn krude Ideen und Forderungen wird es immer geben. Damit müssen wir leben. Der entscheidende Punkt für eine Gesellschaft ist vielmehr, die toxischen Ideen zu erkennen und gewillt zu sein, diesen entschlossen entgegenzutreten. Aus meiner Sicht haben wir hier seit Jahrzehnten geschlafen oder weggeschaut. Und der Grund für dieses zögerliche Verhalten ist offensichtlich, dass die Forderungen stets im Mäntelchen von "Gerechtigkeit" und "Menschenrechte" daherkommen. Wer würde sich schon gegen diese beiden so überzeugend klingenden Schlagworte stellen wollen.
A.S. am Permanenter Link
Außer den Juden gibt es noch ein Gruppe systematisch diskriminierter Menschen: Die Atheisten, Hautfarbe und Herkunft egal.
Das wichtigste universale Menschenrecht ist wohl das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Für mich ist nicht nachvollziehbar, wie die "Linken" dieses für ein friedliches Zusammenleben unerläßliche Recht negieren, wenn die Islamisten mal wieder andere Leute umbringen.
Ich sehe die Indentitätspolitik als ein politisches Instrument gegen den aufklärerischen Universalismus. Identitätspolitik setzt systematisch die "Goldene Regel" außer Kraft.
Was mir in dem Artikel zu kurz kommt: Das Individuum darf sich im Kosmos der Identitätspolitik seine Identität nicht aussuchen. Dadurch wird die Identitätspolitik in meinen Augen neo-rassistisch.
"Identitätspolitik ist neo-rassistisch!" - liesse sich mit dieser Formulierung nicht politisch arbeiten?
David Z am Permanenter Link
Sehe ich ähnlich.
Nur eine Ergänzung: Zu den am meisten verfolgten Minderheiten weltweit gehören auch die Christen. Wird leider gerne vergessen, weil diese Verfolgung und Diskriminierung im Westen selbst natürlich nicht stattfindet.
Quelle: https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/verfolgte-christen-open-doors-100.html
A.S. am Permanenter Link
Es sind halt immer die religiösen Mehrheiten, die die religiösen Minderheiten vernichten wollen.
Letztlich ist religiöse Intoleranz auf einen Machtkampf der religiösen Führer untereinander zurückzuführen, der auf der ebene der Gläubigen blutig ausgefochten wird.
Clemens Lintsch... am Permanenter Link
Eine gelungene Annäherung eines sehr komplexen und emotionalen Themas.
Constantin Huber am Permanenter Link
Ohje, immer dieselbe Leier von angeblich pauschal verwerflicher Identitätspolitik. Dabei gibt es daraus sehr sinnvolle Ansätze sowie durchaus kritisierens- und ablehnenswerte.
Hier nicht zu differenzieren, spielt eben doch nur jenen in die Hände, die das Engagement für diskriminierte Minderheiten generell ablehnen. Außerdem wird die wichtige Kritik nur verwässert und all jene, die es schaffen, die notwendige Kritik auf jene zuzuschneiden, derer sie gilt, müssen sich wegen solcher Rundumschläge mühsam (leider berechtigt) dem Vorwurf, die Neue Rechte zu unterstützen, erwehren.
Der grundlegende Denkfehler liegt in dieser Ausführung bei der Annahme, dass diese beiden zitierten Ansätze sich zwingend und gänzlich ausschließen müssten – dabei ist das nicht der Fall.
"In den folgenden Ausführungen geht es hierbei um die Frage, ob bestimmte Gruppenidentitäten oder verallgemeinerbare Prinzipien für Wertungen relevant sein sollen."
Zehn weitere Anmerkungen:
1.) "Die folgenden kritischen Ausführungen bestreiten nicht einen "wahren Kern" bei den gemeinten Positionen."
Von diesem wahren Kern erfährt man von Pfahl-Traughber leider reichlich wenig. Obwohl er doch noch weitaus wichtiger zur Beseitigung von Rassismus und Co. ist als die paar Prozent, die über die Stränge schlagen. Aber immerhin gab es hier offenbar Einsichten. Diese können durchaus anerkennend und lobend hervorgehoben werden!
2.) "Der Charakter und nicht die Hautfarbe ist wichtig."
Eine solche Aussage ist ganz schön stumpf und heikel. Stumpf ist sie deshalb, weil sie unterstellt, dass etwa Anhänger:innen linker Identitätspolitik die Hautfarbe als wichtiger als den Charakter erachteten. Dabei ist das bis auf einen Prozentsatz in Promillebereich bei praktisch niemandem der Fall. Für diese Einsicht reicht es bereits aus, ein einziges Mal einer Debatte der Critical Race Theory beizuwohnen. Hier wird ein übles Vorurteil, ein abwertendes Bauchgefühl, einfach als Fakt ausgegeben. Das erinnert stark an Querdenken. Und nicht zuletzt findet dadurch auch eine moralische Erhöhung statt. Ist das nicht genau das, was den 'ganzen Linken und Woken' gerne als etwas Negatives von bestimmten Gruppen und Individuen nachgesagt wird? Heikel ist die Aussage, weil damit durchaus auch Stimmung gemacht wird – und zwar eine, die ganz pauschal gegen linke Identitätspolitik gerichtet ist. Also auch gegen sehr berechtigtes und solide begründetes Engagement für zu Unrecht diskriminierte Minderheiten. Das spielt der Neuen Rechten in die Karten. Ja, es ist sogar in Teilen wortgleich zu deren Ausführungen.
3.) "Die Autorin denkt demgegenüber in Gruppenkategorien, was auch die in den Formulierungen deutlich werdenden Pauschalisierungen veranschaulichen."
Anders als der Autor aus einer fixen Idee heraus anzunehmen scheint, ist die Welt nicht dichotom in ein Denken in Gruppen und ein Denken in Individuen aufgeteilt. (Er selbst widerlegt das ja bereits, indem er die Gruppe jener, die linke Identitätspolitik befürworten, mit pauschalen Vorurteilen attackiert.) Darüber hinaus ist es nämlich auch möglich, etwa den Individualismus zu befürworten, ja ihn tatsächlich als konstitutiv für so viele moderne Rechte anzusehen, und dennoch, on top, die Marginalisierungen sowie Diskriminierungen von Gruppen anzukreiden. Dafür kann es durchaus notwendig sein, Politiken anzupeilen, die auf solche Gruppen zugeschnitten sind, nicht auf alle Menschen gleichermaßen (deutsch klingende Nachnamen haben es auf dem deutschen Wohnungsmarkt ja eben nicht schwerer als etwa arabisch klingende).
4.) "Denkt man diese Annahmen in ihrer Konsequenz weiter, würde dies auf die Etablierung "geschlossener Gesellschaften" hinauslaufen."
Eine sehr solide Kritik. Würde diese nicht so dargestellt, als beträfe sie quasi alle Befürworter:innen linker Identitätspolitik und würde sie nicht mit Bauchgefühlen vermischt, siehe oben, könnten diese sicherlich mehr Wirkung entfalten. Und Analoges gilt für die Kritik am beschriebenen Ausladen von Wissenschaftler:innen.
5.) "Doch die Identitätslinke blickt häufig nur auf die Sklaverei im Westen, während die Erinnerung an sie in anderen Regionen meist ein Tabu ist."
Aus dem Bereich las ich bereits einige Texte und habe so manche Debatte dazu verfolgt. Derlei habe ich bisher in einem nennenswerten Ausmaß nie erlebt. Auf welche Grundlage stellt der Autor diese Annahme auf? Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier wieder um ein Bauchgefühl handelt, das schlicht als Fakt ausgegeben wird. Einen Beleg sucht man vergebens. Redlich geht anders.
6.) Ob es Rassismus gegen Weiße gibt oder nicht, ist durchaus Gegenstand aktueller Debatten. Und wird auch exakt so im akademischen Diskurs aufgegriffen. Der Autor stellt die Sachlage im Text jedoch reichlich verzerrend so dar, als würde es definitiv und unstrittig Rassismus gegen Weiße geben. Derart unwissenschaftliche Äußerungen sollten als Meinungsbeiträge gekennzeichnet werden. Verkannt wird dabei etwa, dass Rassismus für einige im Diskurs als feststehender Begriff aufgefasst wird, der mit der Jahrhunderte langen Ausbeutung von BIPoC assoziiert wird und demgegenüber, durchaus auch vorhandene üble Diskriminierungen gegenüber Weißen in Ländern mit einer BIPoC-Mehrheit, nicht mit diesem Begriff bezeichnet werden sollten, um erstere Begriffbedeutung nicht zu verwässern. Im Text von Pfahl-Traughber wird zudem suggeriert, dass jene, die das so sehen, die vorkommenden Diskriminierungen gegenüber Weißen gar nicht anerkennen würden. Dabei ist das nicht der Fall. Sie plädieren lediglich dafür, einen anderen Begriff zu nutzen. Den Rassismus gegenüber Jüd:innen könnte man zum Beispiel auch schlicht "Antisemitismus" nennen. Und spoiler alert: Die meisten tun das bereits. Und meinen damit die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gegenüber Jüd:innen. Diese gibt es übrigens von Weißen und Nicht-Weißen. Speziell einen Begriff zu erfinden, der ausschließlich die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit von Weißen an Weißen beschreibt, halte ich für unnötig. Das wäre wieder ein verwerflicher Teil von Identitätspolitik.
7.) "Warum geht es nicht auch gegen Antisemitismus, denn Juden werden nach wie vor bedroht?"
Das klingt ziemlich stark nach dem Geniestreich der Springerpresse, bestimmten Linken zu unterstellen, sie hätten sich nicht zum Leid der Israelis oder Ukrainer:innen geäußert. Nur doof, dass sich herausstellte, dass die an den Pranger gestellten, das bereits taten.
Und ähnlich auch hier. So ziemlich alle Social-Media-Seiten und Zeitungen sind voll mit der Ablehnung von Antisemitismus. Auch mit Texten von jenen, die üblicherweise als Identitätslinke beschrieben werden. Könnte man wissen, wenn man denn mit ehrlichem Interesse die Tätigkeiten von Identitätslinken mal verfolgte, statt hauptsächlich von Bauchgefühlen und einer (esoterisch klingenden) diffusen Masse auszugehen.
8.) "Beide können für diesen Anspruch übrigens keine demokratische Legitimation vorweisen, fehlt es doch an Belegen für eine in den jeweiligen Bezugsgruppen existierende mehrheitliche Zustimmung."
Es lässt sich durchaus solide argumentieren, dass weite Teile von SPD, Grüne und Linke identitätspolitische Ansätze verfolgen. Diese sind in einigen Bundesländern Teil der Regierung, in manchen mit einer Mehrheit. Dass hier das FDP-Mitglied Armin Pfahl-Traughber keine demokratische Legitimation für linke Identitätspolitik sieht, wo doch lediglich FDP, Union, FW und AfD in den Parlamenten dagegen ist, muss zumindest als einseitige Betrachtung geframt werden. Es ließe sich sogar sagen, dass er hier eine Gruppenperspektive (die der letztgenannten Parteien eben) als die einzig zulässige darstellen möchte, obwohl es auch starke Argumente gibt, die etwa für Teile linker Identitätspolitik sprechen. Insofern wüsste ich nicht, was ich jenen entgegenhalten sollte, die Armin Pfahl-Traughber nachsagen, dass er rechte Identitätspolitik betreibe.
9.) "Die kritischen Anmerkungen zu linker Identitätspolitik beabsichtigten nicht deren komplette Verwerfung."
Dafür liest sich der Text aber exakt so. Weshalb der Autor nicht stets von "Teilen linker Identitätspolitik" schreibt oder sich einen neuen Begriff ausdenkt, ist mir schleierhaft. Könnte er damit sich doch sicher sein, weitaus mehr Zustimmung zu erfahren. Von Fans linker Identitätspolitik ebenso wie von deren Gegnern. Denn dann wäre ersichtlich, dass es um das bessere Argument und nicht um das Schlechtreden politisch anders zu verortenden Gruppen geht.
10.) Und nicht zuletzt wird hier im Text linke und rechte Identitätspolitik gleichgesetzt, indem diese als gleich ablehnenswert dargestellt werden. Dass es jedoch auch weite Teile von linker Identitätspolitik gibt, die sehr berechtigt sind, wird dabei fast komplett unterschlagen. Das Hufeisen mit all seiner Überholtheit lässt grüßen.
P.S.: Dass an zwei Stellen erwähnt wird, dass man die Ansätze nicht gleichsetzen möchte, bedeutet ja nicht, dass das keinesfalls so ist.
Armin Pfahl-Tra... am Permanenter Link
Constantin Huber liefert viele Einseitigkeiten und Schiefen in seinem Statement. Die genaue Lektüre meines Textes, incl. des Blicks in die Fußnoten, hätten hier viele Widersprüche vermeiden lassen.
SG aus E am Permanenter Link
"Islamophobie", "Antimuslimischer Rassismus", "Muslimfeindlichkeit"? – "Anti-Orientalismus"!
Ein Vorschlag zur Güte.
Armin Pfahl-Traughber erinnert an den Begriff "Orientalismus" von Edward Said:
"Damit würden Gesellschaften des Nahen Ostens allgemein als 'bedrohlich', 'mysteriös' oder 'rückständig' wahrgenommen. So sei erst das Gegenbild vom 'Orient' im Westen entstanden. Auch wenn dazu eine differenziertere Betrachtung nötig wäre, kann dieser Grundaussage eingeschränkt zugestimmt werden."
Armin Pfahl-Traughber hat mehrfach auf die Schwächen verschiedener Begriffe, die das angespannte Verhältnis der deutschen Mehrheitsgesellschaft zu gewissen unbeliebten Minderheiten beschreiben wollen, aufmerksam gemacht. Weder die Begriffe "Islamophobie" noch "Antimuslimischer Rassismus" seien geeignet jenes Phänomen adäquat zu beschreiben, das die deutsche Gesellschaft derzeit so umtreibt. Er empfiehlt das Wort "Muslim(en)feindlichkeit". Doch auch dieser Begriff verengt den gemeinten Personenkreis und impliziert eine bestimmte Religionszugehörigkeit, die oftmals gar nicht gegeben ist, sei es weil die von 'Muslimfeindlichkeit' betroffenen Personen einer anderen oder keiner Religion angehören (z.B. Jesiden oder Ex-Muslime).
Da einige Autoren (nicht Armin Pfahl-Traughber) von Parallelen zwischen der heutigen Ausländer- / Fremden- / Muslimfeindlichkeit und dem deutschen Antisemitismus des 19. Jahrhunderts (z.B. eines Heinrich von Treitschke: "Die Juden sind unser Unglück") überzeugt sind, sollte man m.E. einen Begriff suchen, der diese Parallelen auch sprachlich zeigt. Ich schlage darum vor, parallel zum Begriff 'Antisemitismus' den Begriff 'Antiorientalismus' zu prägen.
'Antiorientalismus' wäre dann: eine bestimmte Wahrnehmung von Menschen der MENA-Region, die sich als Hass gegenüber diesen Menschen ausdrücken kann. Der Antiorientalismus richtet sich in Wort oder Tat gegen muslimische oder nichtmuslimische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen muslimische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Darüber hinaus können auch Staaten der MENA-Region, die dabei als 'orientalisches' Kollektiv verstanden werden sowie deren Repräsentanten und Regierungschefs, Ziel solcher Angriffe sein.
Damit wird der berechtigten Kritik an den herkömmlichen Begriffen Genüge getan:
– Die Ablehnung patriarchalischer Subkulturen ist keine Krankheit (gegen: Islamophobie).
– Es gibt keine Menschenrassen (gegen: antimusl. Rassismus).
– Auch Säkulare sind betroffen (gegen: Muslimfeindlichkeit).
—
PS: Semantisch bezeichnet 'Semitismus' in der deutschen Sprache Anleihen an Konstruktions- oder Ausdrucksweisen, wie sie in semitischen Sprachen üblich sind. Unter Orientalismus in der Kunst versteht man Darstellungen und (häufig imitative) Verwendungen nah- und fernöstlicher Motive durch europäische Kunstschaffende (wikipedia.de).