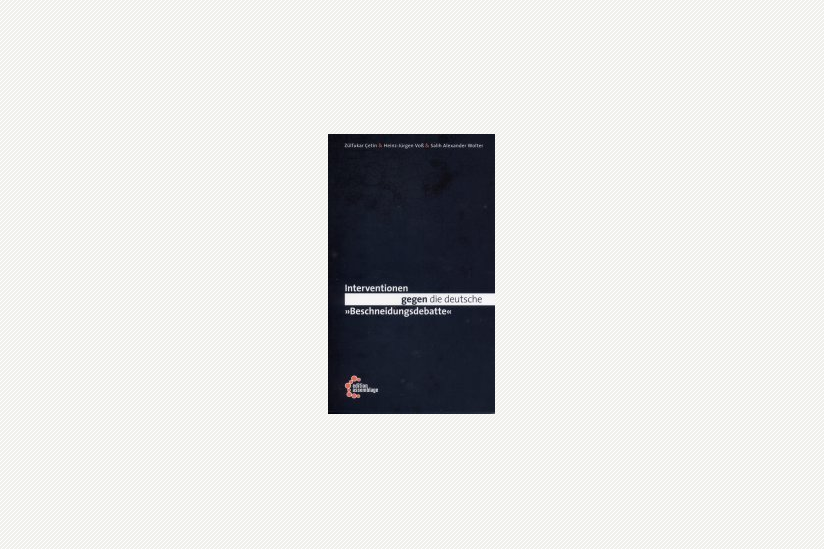(hpd) Anfang Dezember, kurz bevor der Bundestag über das neue Beschneidungsgesetz abstimmte, erschien ein schmales Bändchen über die Debatte, die seit dem Sommer so intensiv geführt worden war. Es enthält neben dem Vorwort zwei Aufsätze, die sich mit zwei unterschiedlichen Aspekten befassen und von sehr unterschiedlicher Qualität sind.
Im Vorwort wird der Anspruch definiert, Anregungen zu geben, „hegemoniale Elemente in den eigenen Positionen festzustellen und sich selbst zu fragen: "Wer kann an welcher Stelle und mit welchem Gewicht sprechen, wer nicht – und warum?“ Im Buch selbst ist von diesem diskursanalytischen Ansatz allerdings nicht mehr viel zu finden.
Die medizinische Basis der Debatte
Heinz-Jürgen Voß setzt sich mit der „medizinischen Basis“ der Debatte auseinander. Er erörtert anhand zahlreicher Studien die Empfindungsfähigkeit des Penis nach einer Beschneidung sowie die Folgen für das Infektionsrisiko (Geschlechtskrankheiten und Harnwegserkrankungen). Ausführlich befasst sich der Autor mit Komplikationen bei einer Beschneidung im Kindesalter. Er kommt nach Auswertung der Literatur zu dem Ergebnis, dass – sterile und fachlich geeignete Ausführung unter Betäubung vorausgesetzt – das Risiko für Komplikationen sicher unter zwei Prozent liegt und ernste Komplikationen unter diesen Umständen so gut wie nie auftreten. Insgesamt überwögen die Vorteile einer Zirkumzision die Nachteile. Ob die Zahlen in dieser Form stimmen, ist für Nichtfachleute nur mit größerem Aufwand zu überprüfen; in der Literaturliste fehlen jedenfalls jene Studien, die in einem im Humanistischen Pressedienst erschienenen Artikel zur „Studienlage zur Beschneidung von Knaben“ angeführt werden und hohe Komplikationsraten und Todesfälle belegen sollen. Trotzdem bereichert Voß’ Argumentation mit seinem kritischen Blick auf die Auseinandersetzung um „medizinische Definitionsmacht“ die Debatte.
Beim Beitrag von Zülfukar Çetin und Salih Alexander Wolter liegt der Fall anders. Die Autoren bemühen sich offenbar, die „Beschneidungsdebatte“ zu dekonstruieren und das heißt, sie als Teil des in Deutschland bestehenden Rassismus verstehen: „In der breiten Ablehnung der Knabenbeschneidung durch die mehrheitsdeutsche Öffentlichkeit verschmelzen Elemente des Antimuslimischen Rassismus und des stets latent gebliebenen Antisemitismus.“ Um zu diesem Ergebnis zu kommen, müssen sie allerdings zentrale Aspekte der Debatte unerwähnt lassen.
Beschneidung im Rahmen des „Integrationsdiskurses“
Çetin & Wolter gehen davon aus, dass die ganze Kontroverse von „einem ehrgeizigen Juristen, der sich einen Namen machen wollte“, lanciert wurde. Indem die Beschneidung in Frage gestellt werde, habe dies für Juden und Muslime zur Folge, „entweder illegal zu handeln oder das Land zu verlassen“. Die ganze Diskussion sehen sie als „neue Eskalationsstufe des Diskurses der ‘Integration’“, der darauf hinauslaufe, „dass die Realität von Migration in Deutschland nichts zu suchen habe“.
Längere Passagen des Textes setzen sich (in Anschluss an die Vorstellung von Gouvernementalität bei Michel Foucault) mit dem Körperverhältnis und mit Sexualität auseinander sowie mit medizinischen Aspekten und der Frage nach einer möglichen Traumatisierung. Außerdem gehen die Autoren, allerdings eher oberflächlich, auf religionskritische Perspektiven ein.
Nun hat es in der „Beschneidungsdebatte“ tatsächlich eine ganze Reihe von Beiträgen gegeben, die sich ihrer Sache sehr sicher waren und die gegenteilige Position kaum reflektiert haben. So ist die Beschneidung insbesondere bei Juden nicht nur archaisches, seit Jahrtausenden praktiziertes Ritual, sondern – unabhängig davon, ob es sich um orthodoxe oder liberale, um säkulare oder religiöse Juden handelt – auch eine Zeremonie, die einen Teil der jüdischen Identität ausmacht. Wer die möglichen Folgen eines Beschneidungsverbotes nicht reflektiert, muss zu dem Vorwurf Stellung nehmen, kulturelle Minderheiten auszugrenzen bzw. sie nicht als legitimen Teil der Gesellschaft anzusehen.
Doch Çetin & Wolter stehen allen Einseitigkeiten der Kritiker in nichts nach. Das beginnt damit, dass – soweit ich die Debatte überblicke – von denen, die ernsthafte Beiträge beigesteuert haben, eigentlich niemand gefordert hat, die Beschneidung komplett zu verbieten; viele Vorschläge sehen vor, die Entscheidung dem Jungen zu überlassen, die er zum Beispiel mit Erreichen der Religionsmündigkeit dann selbst fällen kann. Da die meisten Muslime ihre Söhne nicht als Babys beschneiden lassen, stellt sich hier der Konflikt dann schon nicht mehr so grundlegend dar. Für Juden hingegen wäre nichts gewonnen, da die Beschneidung bei ihnen am achten Lebenstag des Kindes durchgeführt werden soll. Allerdings gibt es mit Brit Schalom auch im Judentum eine alternative Zeremonie, bei der auf die Entfernung der Vorhaut beim Säugling verzichtet wird. Und von den aus ehemaligen Sowjetrepubliken nach Deutschland eingewanderten Juden sind offenbar viele nicht beschnitten, was ihrer Aufnahme in jüdische Gemeinden jedoch nicht im Wege steht.
Aber Çetin & Wolter sehen das Problem der Beschneidungsdebatte nicht in ihrer schnellen Zuspitzung auf die Alternative „Beschneidung oder nicht“, die in ihrer Polarisierung verhindert hat, dass überhaupt nach Lösungen gesucht wurde, wie ein Ausgleich zwischen der körperlichen Unversehrtheit des Jungen und den Interessen der Religionsgesellschaften bzw. der religiösen Eltern denn hätte aussehen können. Denn die betroffenen Kinder kommen in ihren Ausführungen allenfalls am Rande und nur als Objekte vor. Lediglich der im Vorwort von Heinz-Jürgen Voß zu findende Hinweis, dass es offenbar keine Selbsthilfegruppen der von Beschneidung Betroffenen gibt, stellt eine ernst zu nehmende Frage an jene, die aus kinderrechtlicher Perspektive argumentieren.
„Religionskritik als Sprachrohr des Rassismus und Antisemitismus“
Eine kritische Reflexion religiöser Traditionen findet bei Çetin & Wolter nicht statt. In Überlegungen, ob es legitim ist, dass Religionsgemeinschaften über die Kinder ihrer Mitglieder verfügen dürfen und ob solche Rechte auch den Körper umfassen dürfen, sehen sie ein „Schema der rassistisch motivierten Diskriminierungen“ und eurozentristische Kriterien. Religionskritik wird so zum „Sprachrohr des Rassismus und Antisemitismus“. Nachvollziehbar dargelegt wird diese Behauptung nicht: Auf den anderthalb Seiten, die das betreffende Kapitel umfasst, wird weder ein Argument noch ein den Vorwurf stützendes Zitat angeführt. Dass individuelle Emanzipation zum Konflikt mit religiösen Normen führen kann, wird nicht erörtert.
Letzteres ist wohl auf die Perspektive der beiden Autoren zurückzuführen: Sie operieren mit dem Begriff des „Antimuslimischen Rassismus“, halluzinieren homogene Kollektive und gehen von der Identität von Muslim/in und Migrant/in aus. Welch bizarre Blüten das Denken in diesen Kategorien hervorbringt, zeigt das im aktuellen Heft der Zeitschrift konkret veröffentlichte Interview mit dem Sozialwissenschaftler Vassilis Tsianos. Auch Çetin & Wolter blenden Teile der Realität einfach aus, damit ihre Ausführungen stimmig erscheinen.
Denn dass in dem Land, in dem angeblich der „Antimuslimische Rassismus“ grassiert, gerade der Islamische Religionsuntericht an öffentlichen Schulen eingeführt wird und islamische Verbände längst politische Partner der Regierenden sind, ist den Autoren offenbar ebenso entgangen, wie die zahlreichen „Biodeutschen“ in muslimischen Strukturen (auch in leitenden Funktionen wie etwa Ayyub Axel Köhler, Norbert Müller
oder Pierre Vogel). Und wer suggeriert, dass der alltägliche Rassismus sich gegen Muslime richtet, also gegen Menschen, die sich zum Islam bekennen, müsste nachweisen, dass christliche, atheistische oder religiös nicht interessierte Türken, Iraner, Tunesier oder Indonesier signifikant seltener diskriminiert werden. Çetin & Wolter führen solchen Nachweis nicht, sie setzen die Existenz eines „Antimuslimischen Rassismus“ voraus und verwenden den Begriff mit der gleichen Selbstverständlichkeit, wie die konservativen Islamverbände. Folgerichtig beschließt auch ein Zitat des Vorsitzenden des Zentralrates der Muslime, Ayman Mazyek, ihren Aufsatz.
Weitere Hinweise, wo die Autoren politisch anzusiedeln sind, tauchen bei genauer Lektüre des Textes auf und können auch von den eingestreuten Foucault-Zitaten und der Bezugnahme auf die Dialektik der Aufklärung nicht verdeckt werden. So schreiben Çetin & Wolter, das Ergebnis der Kopftuchdebatte sei gewesen, dass „Frauen, die ‘islamisch korrekt’ bekleidet bleiben wollen“, der schlechte Ausweg geblieben sei, auf soziale Aufstiegsmöglichkeiten zu verzichten (S. 18). Allein: Über drei Viertel der in Deutschland lebenden Musliminnen tragen überhaupt kein Kopftuch. Die Formulierung, das Kopftuch sei notwendig, um „islamisch korrekt“ gekleidet zu sein, ist insofern falsch. Die Autoren übernehmen die Auffassung bestimmter Strömungen im Islam, mit einem ganz bestimmten reaktionären Männer- und Frauenbild und behaupten diese als allgemein verbindlich. So betätigen sich Çetin & Wolter letztlich als Türöffner für rechte religiöse Positionen, sagen Antirassismus und meinen Kulturrelativismus, stellen sich – gegen individuelle Abweichung – auf die Seite der Orthodoxie.
Die gute Nachricht zum Schluss: Auf Seite 93 wird in einer verlegerischen Notiz angekündigt, dass der Programmrat „Veröffentlichungen zu Religion und Autorität, die die spezifischen historischen Bedingungen in Deutschland reflektieren und in geeigneter Weise die in allen Religionen bestehende Zurichtung von Menschen, respektive Kindern, problematisieren und kritisieren“, beabsichtigt. Dem sehe ich hoffnungsvoll entgegen.
Gunnar Schedel
Zülfukar Çetin / Heinz-Jürgen Voß / Salih Alexander Wolter: Interventionen gegen die deutsche „Beschneidungsdebatte“. Münster: edition assemblage 2012. 92 Seiten, kartoniert, Euro 9,80, ISBN 978-3-942885-42-3
Das Buch ist auch im denkladen erhältlich.