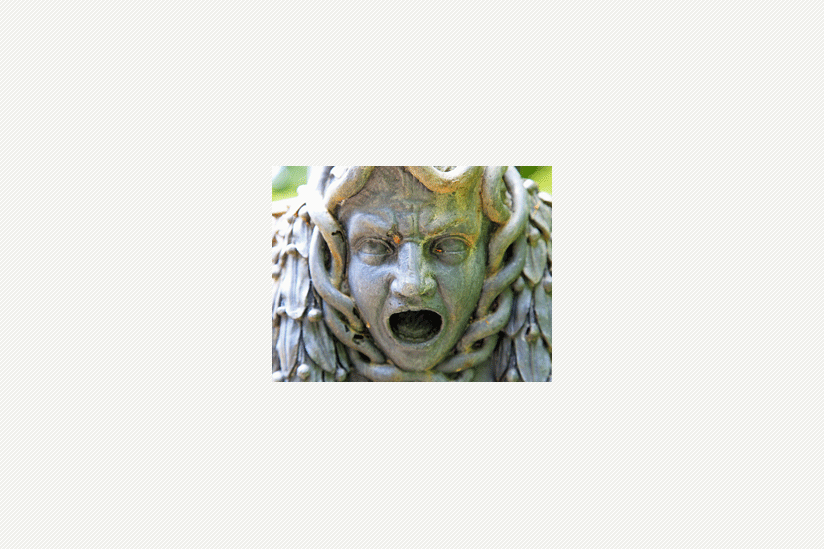KIEL. (hpd) Nicht nur durch das Aufdecken der Missbrauchsfälle in den vergangenen Jahren ist es zu einem höheren Interesse gekommen, sich mit traumatischen Ereignissen sowie deren Folgen auseinanderzusetzen. Psychologen haben sicher schon längst die dauerhaften Folgen von Missbrauch und Gewalt erkannt. Jedoch jetzt erst liegt eine Studie vor, die sich mit den Kosten befasst.
Unter dem Titel „Kein Kind mehr – kein(e) Trauma(kosten) mehr?“ wurde von den Autoren versucht zusammenzutragen, welche Folgen aus einem traumatischen Ereignis im Kindesalter entstehen und welche enormen Kosten für Behandlung, Berufsbildung u. ä. folgen. Das größte Problem scheint zu sein, dass es zu wenig Behandlungsplätze und damit zu wenig Hilfe für die Betroffenen gibt.
Dieses Thema wurde offenkundig, als klar wurde, dass Kinder unverschuldet durch sexuellen Missbrauch, Gewalt oder „nur“ Vernachlässigung krank werden und lebenslang an diesen Folgen zu tragen haben. Die notwendigen Behandlungen der Folgen sind neben den Einschränkungen der Lebensqualität der Betroffenen ein ökonomischer Faktor für alle Krankenkassen und die Wirtschaft.
Die Autoren Susanne Habetha, Sabrina Bleich, Christoph Sievers, Ursula Marschall, Jörg Weidenhammer und Jörg M. Fegert sind als Mediziner, Psychologen und Ökonomen tätig und haben sich im Rahmen einer Studie für das Institut für Gesundheits-System-Forschung GmbH in Kiel eingehend mit dieser Thematik beschäftigt. Auch wenn die Datenlage für Deutschland sehr dünn ist, haben sie einige Anhaltspunkte und Vergleichswerte in den USA, Kanada und Australien gefunden.
Nachdem auch einige Studien und Berichte zum sexuellen Missbrauch von Kindern vorliegen, ist vor allem die Forderung nach besseren Therapien, einfacheren Zugangsmöglichkeiten zu Ärzten und Therapeuten und damit die Idee der Schaffung von Traumazentren in den Mittelpunkt gerückt.
Ausgangssituation
Die Folgen aus erlebtem Missbrauch und Gewalt machen sich vor allem in somatischen Beschwerden, Sozialproblemen, Leistungsbeeinträchtigungen, mangelndem Selbstwertgefühl und verminderter Lebensqualität bemerkbar.
Unter den derzeit mangelnden Leistungen zur medizinisch/psychologischen Hilfe haben nach Recherchen der Studie besonders Betroffene aus ländlichen Gegenden, Männer und Menschen mit Migrationshintergrund zu leiden. Auch Psychotherapeuten selbst, die tagtäglich an die Grenzen der Leistungsfähigkeit der Versorgungsleistungen stoßen, fordern spezifische Angebote, Einschluss von neuen Therapieverfahren in die Kassenleistungen, sowie die Vernetzung von Kliniken und Beratungsstellen. Trotz vieler Ansätze und dem Wissen um die Brisanz hat sich bisher nicht viel Wirksames getan.
In der Studie wird darauf hingewiesen, dass Traumatisierung von Kindern und Jugendlichen nicht die seltene Ausnahmeerscheinung ist, sondern uns leider tagtäglich umgibt. Die daraus entstehenden Folgen in Form von unterschiedlichsten Krankheitsbildern, Persönlichkeitsstörungen und Leistungsverlusten müssen von der gesamten Gesellschaft getragen werden. Damit ruft es natürlich auch die Ökonomen der Krankenkassen auf den Plan, die daran interessiert sind, die Kosten für Behandlungen zu senken bzw. vorhandene Ressourcen gezielt einzusetzen.
Im Vorfeld gab es einige Studien, die sexuellen Missbrauch, körperliche Misshandlung und das Miterleben elterlicher Gewalt untersuchten. Aus dem ermittelten Zahlenmaterial ergibt sich, dass die Hälfte der Befragten im Kind- bzw. Jugendalter emotional oder körperlich vernachlässigt wurden, ca. 15 Prozent wurden emotional misshandelt, 12 Prozent körperlich und 13 Prozent sexuell missbraucht.
Die Betroffenen, die später an Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) litten, hatten kaum die Möglichkeit professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Sie hatten entweder keinen Zugang zu einem Arzt oder Therapeuten oder es wurde gar nicht als Krankheit erkannt. Auch dass das Thema Kindesmisshandlung und Vernachlässigung von der Gesellschaft weitestgehend ignoriert wird, spielt dabei eine Rolle. Bei Kindern und Jugendlichen kommt erschwerend hinzu, dass die Betroffenen und ihr Umfeld diese Störungen nicht erkennen und nicht wissen, dass es dafür medizinische und psychologische Hilfe gibt.
Auch von Kinderschutz-Zentren, Jugendhilfe, Pädagogik, Polizei und Justiz sind nicht immer ausreichende und professionelle Hilfen zu erwarten. Es gibt inzwischen einzelne neuere Projekte in Beratungsstellen, Schulen und Jugendhilfen, jedoch fehlt es denen oft an Kompetenz und Eingliederung in bestehende Strukturen, sowie an materiellen Grundlagen.
Auch in der ärztlichen Ausbildung besteht Nachholbedarf. Kinder- und Jugendpsychiatrie findet bisher kaum Beachtung in der Ausbildung. Es stehen nur wenig Traumatherapeuten einer großen Anzahl Betroffener gegenüber. Für Therapeuten und spezielle Therapien fehlt es an Ausbildungsplätzen.
Ein wichtiger Schritt ist in den letzten Jahren die Einrichtung von Traumaambulanzen, die jedoch fast ausschließlich an großen Kliniken existieren und sich darauf spezialisieren, Ersthilfe zur Krisenintervention zu leisten. Damit sollte es möglich sein, keine weiteren Warteschlangen an Traumapatienten aufzubauen. Jedoch hilft es kaum denen, die inzwischen seit Jahren an den Folgeerscheinungen zu leiden haben und längst den Kinderschuhen entwachsen sind.
Prävention von Traumatisierungen
Das wirksamste Mittel, um traumatischen Folgeerscheinungen zu minimieren ist die Prävention. Vor allem bei Gewalt, Kindesmisshandlung und -missbrauch ist dies oberstes Gebot.
In einer deutschen Studie wurde das Kostenverhältnis von Prävention zu den Folgekosten mit 1:13 bei normalem Verlauf angesehen und bei extremen Störungen erhöht sich das Verhältnis um ein Vielfaches.
Die Kosten für Traumafolgen sind recht schwer zu ermitteln. Es gibt nur wenige internationale Studien dazu. Die gesamtgesellschaftlichen Kosten, die aus den Folgen von Traumatisierung entstehen sind weitestgehend unbekannt.
Bei einer bundesweiten Studie von Kindern und Jugendlichen, die Kontakt zu einem Kinderschutz-Zentrum aufgenommen hatten, wurden bei über der Hälfte Störungen in der sozialen Entwicklung, bei einem Fünftel Lernbehinderung und bei jeweils ca. einem Zehntel Sprach- und andere Entwicklungsstörungen festgestellt, sowie eine erhöhte Rate an Suizidversuchen und späteren Strafdelikten. Von diesen Kindern und Jugendlichen waren lediglich 2,3 Prozent in psychiatrischer Behandlung.
Der Zusammenhang zwischen Trauma und lebenslangen Folgeerscheinungen, wie z. B. erhöhte Risiken für PTBS, Depression, Angststörungen, Alkohol- und Drogenprobleme sowie Störungen des Sozialverhalten sind erkannt, aber bisher sind keinerlei Erhebungen darüber gemacht worden, welchen finanziellen Rahmen diese (oftmals) behandel- und behebbaren Störungen haben.
Internationale Studien
Um die Kostengröße zu ermitteln, wurde auf internationale Studien aus den USA, Kanada und Australien zurückgegriffen, diese wurden ergänzt durch Daten, die die Barmer Krankenkasse gesammelt hatte. Aus den Krankenkassendaten wurden bestimmte Krankheitsbilder abgefragt und ausgewertet.
Obwohl PTBS bei Erwachsen bereits seit den 1970er Jahren als Krankheit bekannt ist, ist dies bei Kindern erst seit 1988 erkennbar. Die Diagnose bei Kindern ist sehr schwer, da sie sich in aller Regel noch nicht so ausdrücken können und die Erinnerung noch nicht ausgeprägt ist. Deshalb ist die eindeutige Diagnose von PTBS bei Kindern kaum möglich, jedoch weisen sie eine Vielzahl von anderen und ähnlichen psychischen Störungen wie Erwachsene auf. Aus dem Grunde spricht man auch neuerdings von „Traumaentwicklungsstörungen“.
Es gibt kaum Untersuchungen über die Langzeitfolgen von Traumatisierungen, deshalb wurde auf die Studien zum sexuellen Missbrauch und körperlicher Misshandlung von Kindern und Jugendlichen zurückgegriffen. Zu diesen Fällen gibt es umfangreiche Untersuchungen und es wurde festgestellt, dass es zu überdurchschnittlich vielen psychischen Störungen bei diesen Kindern und Jugendlichen kam.
Zu einzelnen Traumafolgestörungen, wie PTBS, Depression, Angststörungen, Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen und Störungen des Sozialverhaltens, sowie Übergewicht und Bluthochdruck, was ebenfalls als Folgeerscheinungen erkannt wurde, gibt es seitens der Krankenkassen gute Dokumentationen. Dabei wurde herausgefunden, dass vor allem nach sexueller Gewalt des Risiko für PTBS zwischen 50 und 80 Prozent liegt und damit wesentlich höher, als nach anderen traumatischen Ereignissen.
Für die Studie musste zuerst geklärt werden, welche Kosten überhaupt berücksichtigt werden sollen. Die vorliegenden internationalen Studien berücksichtigten größtenteils die Kosten aus Opfersicht, also kaum die der Täterverfolgung.
Ein weiterer zu klärender Punkt war, ob man lediglich die Kosten der nachgewiesenen Fälle berücksichtigt oder die um das 20fach höhere Anzahl aus den Prävalenzangaben. Auf jeden Fall würde die Betrachtung der bekannten Fälle kein repräsentatives Ergebnis liefern, da die Dunkelziffer viel zu hoch ist. Eine weitere Schwierigkeit bestand in der Ermittlung der Kostenbereiche, da nicht eindeutig zuordenbar ist, welche Kosten direkt durch das Trauma bedingt sind. Eine komplette Kostenaufstellung ist auch real nicht machbar, da viele Kosten nicht erfasst werden oder privat getragen werden und damit nicht ermittelbar sind.
Es sind auch nur für wenige Traumata (wie für Missbrauch und Misshandlung) die Auswirkungen bekannt. Für andere, wie schwerer Unfall, Verletzung, Zeugenschaft eines Ereignisses) gibt es kaum Daten und konnten somit gar nicht berücksichtigt werden.
Diese Studie kann deshalb auch nur eine Einschätzung bieten und bringt keine gesicherten Werte. Durch wenig öffentliche Beachtung und mangelnde Bereitstellung von Finanzen für die Erforschung dieses Themas entstand eine ebenfalls nur lückenhafte Datenrecherche. Dennoch ist es gelungen, Traumafolgekosten den Präventionskosten gegenüberzustellen.
Danach sind Traumafolgekosten um ein vielfaches höher als Präventionsmaßnahmen. Da dieser Studie sehr konservative Einschätzungen zugrunde liegen, ist real mit wesentlich höheren Kosten zu rechnen.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Kosten für eine Ermittlung der Größenordnung relevant sind:

Im Ergebnis dieser Studie wird eine Summe von
11.005.676.636 Euro
(Elf Milliarden Euro) ermittelt, die durch Folgen von Kindesmisshandlung/-missbrauch und Vernachlässigung jährlich entsteht. Damit würden auf jeden Bundesbürger Traumafolgekosten in Höhe von rund 135 € entfallen (als Vergleich 2.579 € für den EU-„Rettungsschirm“).
Bewertung
Diese Studie kann nur bedingt einen Anhaltspunkt für die Folgekosten von Traumatisierungen bieten. Die Herleitung der Folgekosten ist sehr einfach gehalten, weil viele Daten mit großen Ungenauigkeiten behaftet sind. Die unterschiedlichen verwendeten Datenquellen sind unter anderen Gesichtspunkten erstellt worden und bieten daher nur mittelbar Bezugsquellen zu der hier zu ermittelnden Größe der Kosten.
Ziel muss es jetzt sein, Spezial-Ausbildungsplätze für neu erkannte Wege der Therapie zu schaffen. Der erstmalige Versuch, die Kosten der Folgen von Traumatisierungen zu erfassen, liefert Anhaltspunkte für die ökonomische Seite von Therapien. Nämlich, dass sehr zeitnah zum Traumaereignis die Behandlung beginnen muss, um möglichst rasch die bekannten Folgekrankheiten zu vermeiden bzw. zu minimieren. Das erfordert insgesamt eine größere Beachtung von Traumata. Ärzte und Therapeuten müssten befähigt sein, solche Patienten zeitig zu erkennen, um sie dann gezielt behandeln zu können bzw. sie an Spezialisten zu vermitteln.
Elke Schäfer
Quelle: Deutsche Traumafolgekostenstudie - Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie; Universitätsklinikum Ulm; „Kein Kind mehr – kein(e) Trauma(kosten) mehr?“- Susanne Habetha, Sabrina Bleich, Christoph Sievers, Ursula Marschall, Jörg Weidenhammer und Jörg M. Fegert; Institut für Gesundheits-System-Forschung GmbH Kiel; Februar 2012, 140 Seiten, ISBN 978-3-88312-327-1
Weiteres zum Thema: Gahleitner, Silke Birgitta & Oestreich, Ilona (2010). „Da bin ich heute krank von.“ Was hilft ehemaligen Heimkindern bei der Bewältigung ihrer Traumatisierung? Im Auftrag des Rundes Tisches Heimerziehung. Berlin: Runder Tisch Heimerziehung. [Download]