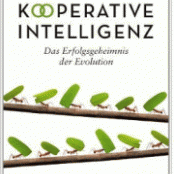BERLIN. (hpd) Die Evolution ein Forschungsgebiet nicht für Naturwissenschaftler, sondern auch für Philosophen? Ja, wir sollten darüber nachdenken, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Evolution reden. Ein Naturgesetz, eine Reihe von Naturgesetzen über die Natur selbst oder ein ganzes Bündel sehr verschiedenartiger Aussagen, wie mit Daten aus der Natur heranzugehen und sie zu verstehen seien?
Weiter hilft das neue Buch „Evolution“ des Philosophen und Biologen Georg Toepfer.
Der schmale aber konzise Band in der Reihe Grundwissen Philosophie des Reclam Verlages ist vor allem bestens geeignet, vorschnelle Übertragungen von Aussagen über die Evolution in der Natur auf die Gesellschaft zu bremsen. Denn „survival of the fittest“, „Anpassung“, all diese Begriffe werden höchst problematisch. Erst recht, wenn sie mechanistisch verstanden werden, was Charles Darwin selbst nie getan hat.
Was also können wir über die Naturgeschichte mit Sicherheit sagen? Das ist eine philosophische Frage und die Antwort tautologieverdächtig: Dass Natur als Prozess verstanden werden muss. Der Titel der Hauptschrift Darwins, „On the Origin of Species“, sagt es bereits: Dass Arten entstanden sind. Evolution meint Entwicklung. Doch welche Faktoren spielen dabei mit? Besser: Welche Konstanten? Selektion und Anpassung. Gern sagen wir umgangssprachlich, der Anpassungsdruck bewirkt eine Selektion, als ob es sich um einen Kausalzusammenhang handele. Von Kausalität reden wir, wenn ein Ereignis ein anderes notwendig zur Folge hat. Selektiert werden nun aber Eigenschaften, es entstehen Arten. Das sind zwei völlig verschiedene Ebenen.
Richard Dawkins und der frühe George Christopher Williams erhoben in den Sechzigern die Gene zu Protagonisten der Evolution. Die Gegenposition wird von denjenigen vertreten, die von einer Gruppenevolution sprechen. Elliott Sober war hier in den Achtzigern führend. Was einer Population nützen kann, kann einzelnen Individuen durchaus schaden. Diese gegensätzlichen Ansätze zu bewerten, hilft eine genaue Sprache. Georg Toepfer, Leiter des Forschungsbereichs LebensWissen des Berliner Zentrums für Literatur- und Kulturforschung, stellt fest, dass zu unterscheiden sei zwischen einer „Selektion von Genen“ und einer „Selektion für Gene“. Ersteres ist gewiss, letzteres sehr die Frage.
Die Häufigkeit des Auftretens eines Gens wäre vielleicht nur ein Indikator, die „Währung“, in der die Entwicklung gemessen wird. Wie aber vollzieht sich diese? Nicht in den Individuen, nicht in den Arten, denn Arten sind ja, einmal entstanden, gerade die konstanten Parameter. Das Individuum „will“ zunächst einmal überleben, es erfährt kaum eine genetische Veränderung (höchstens dahingehend, welche Gene ins Spiel gebracht werden). Zu fassen ist die Veränderung nur im Übergang von einer Generation in die nächste. Wobei der Begriff der Populationen ins Blickfeld gerät. In ihnen treten sogenannte Drifts auf. Veränderungen, die sich weitervererben oder eben nicht. Und hier kommt die Selektion ins Spiel.
Was bewirkt die Selektion?
Wir ahnen es: Die Selektion bewirkt gar nichts. Wer über Selektion spricht, sagt nur etwas über die statistische Wahrscheinlichkeit des Vorkommens eines bestimmten Merkmals innerhalb einer bestimmten Population aus. Der Druck der Anpassung bewirkt nichts. Über sie lässt sich eigentlich überhaupt nur nachträglich etwas sagen. In Form eines Narrativs, das erklärt, warum eine Eigenschaft von Individuen eines Typs sich als erfolgreicher erwiesen hat gegenüber ihren Konkurrenten.
Eigenschaften treten zunächst einmal einfach auf, und die mit ihnen ausgestatteten Individuen treten in Interaktion mit ihrer Umwelt und ein in einen wechselseitigen Prozess. Rupert Riedel, der große Biologe, hat in Anlehnung an Leibniz´ „prästabilisierte Harmonie“ von einer „Harmonie a posteriori“, einer nachträglich einsichtig werdenden weil erst allmählich entstehenden Harmonie gesprochen.
Prognostizieren lässt sich mit Hilfe der Evolutionstheorie gar nichts. Womit klar ist, dass sie nicht den Charakter eines Gesetzes haben kann. Karl Raimund Popper hat sie als metaphysisches Forschungsprogramm bezeichnet, andere als Schema für eine Argumentation im Einzelfall. Oder als Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie auf biologische Verhältnisse.
Sicher ist: Es gilt nicht das Einer-gegen-alle-Prinzip. Denn was heißt hier schon „einer“. Bereits eine ganze Weile vermutet die Wissenschaft, dass Mehrzeller aus dem Zusammenschluss verschiedenartiger Einzeller entstanden sind, ja, selbst die Zellen aus dem Verschmelzen von Elementarstrukturen des Lebens mit anderen Lebewesen, aus welchen später die Mitrochondrien entstanden, die Katalysatoren der Stoffwechselprozesse innerhalb der Zellen. Dann stünde schon am Anfang des Lebens die Vielheit, nicht die Einheit. Neueste Theorien fassen komplizierte Organismen zunehmend als Zusammenschluss der verschiedensten Lebewesen auf. Man denke nur an unsere Darm- und Speichelbakterien, ohne die wir gar nicht leben könnten. Dann wäre schon das, was wir einen Organismus bezeichnen, aus anderer Perspektive eher ein Ambiente.
Damit würde zunehmend auch das alte Bild des Stammbaums obsolet, mit dem wir uns das Entstehen der Arten veranschaulichen. Angemessener wäre die Vorstellung eines Netzwerkes.
Kulturelle Evolution
Evolution ist unterdessen zu einem sehr weiten Feld geworden. Das war wohl der Grund, warum seit einiger Zeit auch der Begriff der „kulturellen Evolution“ ein gern benutzter Terminus wurde. In der Kultur geht die Evolution weiter, kann dies bedeuten oder auch, Entwicklungen in der Kultur vollziehen sich nach den gleichen Prinzipien wie die biologischen Prozesse. Die Funktion der Gene übernähmen die „Meme“, die kulturellen Traditionen.
Natürlich lässt sich daran nach Herzenslust zweifeln. Die Kultur wird von der Vernunft gesteuert. Kulturelle Veränderungen treten nicht zufällig auf, wie genetische Mutationen es tun. Veränderungen werden bewusst weitergegeben und können auch bewusst nicht weitergegeben werden. Und wichtiger noch: Mittels der Vernunft kann eine menschliche Population auch gegen ihr optimales Überleben entscheiden. Aus biologischer Sicht wirkt die Vernunft dann sogar geradezu parasitär. Doch wollen wir deshalb auf sie verzichten?
Das können wir gar nicht – sie ist der Spiegel, durch den wir Menschen die Welt sehen. Weshalb es auch so schwierig ist, etwas über ihre Genese zu sagen. Wie Hans Michael Baumgartner schrieb: „Die Rückseite des Spiegels ist nur durch den Spiegel erkennbar: Sie ist die Spiegelung seiner Vorderseite.“
Simone Guski
Georg Toepfer: Evolution. Grundwissen Philosophie. Reclam Stuttgart 2013, 140 S. 11,95 Euro.