BERLIN. (hpd) Was sind eigentlich Arten? Warum werden heute so viel mehr entdeckt als früher? Nützt das dem Artenschutz? Mit diesen Fragen, nicht nur mit Artnamen, beschäftigt sich Michael Ohl in seinem Buch "Die Kunst der Benennung". Er ist Insektenforscher, Taxonom, also Spezialist für Artenbestimmung am Naturkundemuseum in Berlin, und Evolutionsbiologe an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Das Benennen erfordert Erfindungsgeist. Angesichts der Millionen noch unbekannter Arten, die der Entdeckung harren, mehr denn je. Anhand der DNA-Analyse lassen sich neue, durch geografische Ausbreitung und schließlich Entfernung entstandene Arten ausmachen, zwischen denen durch die rein morphologische Betrachtung der sichtbaren Merkmale noch – muss man vielleicht sagen – oft keine Unterscheidung möglich wäre. Das könnte freilich zu einem gewissen Abnutzungseffekt in der öffentlichen Wahrnehmung führen. Auf bedrohte Arten lässt sich besser hinweisen, wenn man sie nicht exponentiell immer weiter aufsplittert. Umsiedlungsprojekte zum Artenschutz werden fragwürdiger als nötig, beruft man sich nur auf DNA-Unterschiede. Weshalb dieses Untersuchungsverfahren auch nicht unumstritten ist. Ebenso Artnamen an Sponsoren von Naturschutzgebieten oder Forschungsvorhaben zu verkaufen. Aber bis jetzt gilt: Erlaubt ist alles, was ein Wort ist, das heißt eigentlich nur: sprechbar ist und mehr als einen Buchstaben hat.
Doch was ist eigentlich eine Artbezeichnung? Die steile These von Michael Ohl lautet: Ein Name. Denn: Mit Namen bezeichnet man Individuen, aber auch Ereignisse wie Stürme oder Entitäten wie die UNESCO. Arten haben ein Vorkommen in Raum und Zeit, sie entstehen und vergehen, ihre Individuen bilden eine Fortpflanzungsgemeinschaft, und sie verändern sich. Diese Erkenntnis verdanken wir der Evolutionsbiologie. Eine Art wird definiert durch ihre Position im Stammbaum des Lebens, wie die Wissenschaft sie beschreibt. Durch die Zugehörigkeit zur Gattung und so weiter.
Man begann, die riesige Menge der Arten im 17. Jahrhundert zu ahnen, als Pieter van Musschenbroek beobachtete, dass etwa fünf Insekten jeweils auf nur eine Pflanzenart spezialisiert sind. In der Zoologie schätzte er, dass jede Art zwei Fressfeinde hat. Er vermutete 150 000 Arten. Charles Bonnet beschrieb im 18. Jahrhundert "jede Pflanze als Republik, bewohnt von vielen Bürgern". Sein Zeitgenosse Eberhard Zimmermann kalkulierte bereits 7 Millionen Tierarten. Die Ökologie eröffnete in mehrfacher Hinsicht neue Denkhorizonte, schon damals.
Es ist, als ob der Universalienstreit heute wieder auferstünde. Haben Ideen oder Konzepte ein reales Dasein? Einzelne Individuen einer Art – einer wissenschaftlich benannten wohlgemerkt, aber auf die Bedeutung dieses Details kommen wir später – bilden, so Ohl, einen Teil einer Entität. Der analytische Sprachphilosoph William van Orman Quine schreibt einmal, die japanische Sprache bezeichnet nicht eine Kuhherde als eine Menge von mehreren Kühen, sondern die einzelnen Kühe als einen Bestandteil der Herde. Ebenso verhält es sich mit den Individuen von Arten nach Michael Ohl. Und die aufgespießten Schmetterlinge in den Museen, die in Alkohol eingelegten Geckos und das versteinerte Riesengürteltier? Sie sind Holotypen, was sagen will: Referenzstücke, Stellvertreter. Im Sinne von: "So wie dieses Exemplar sehen die Angehörigen dieser Art aus." Dazu erfolgt eine Beschreibung. Man versucht natürlich, möglichst typische zu finden. Man muss es aber nicht. Manchmal hat man nur ein Exemplar. Aber auch ein mickriges Exemplar ist nicht weniger eine Kobra oder eine Nacktschnecke als ein Prachtexemplar.
Die Tiere müssen nicht ausgestopft, die Pflanzen nicht gepresst werden. Es reicht auch ein Foto. Der Holotypus ist aber dann nicht das Foto, sondern das auf ihm zu sehende Lebewesen. Manchmal genügt auch eine Beschreibung allein, Carl von Linné fertigte eine fünfseitige über den Homo sapiens an. Auf welchen Holotypus verweist sie? Auf alle, die er kannte und von denen er wusste. Am meisten und am besten wohl sich selbst.
Zeige ich dagegen auf einen Mauersegler oder "Turmquäker", eine "Spierschwalbe" oder "Mauersteuerle", verwende also eine der 122 möglichen Regionalnamen, ist das anders. Hier spreche ich etwas an als etwas, ich bestimme. Die Bestimmung hat Appellativ-Charakter.
Man sieht, Taxonomie ist zu einem Teil Biologie und zum anderen Teil Sprachwissenschaft. Und doch, was für eine Poesie steckt in den wissenschaftlichen Namen! Man führe sich nur einige Spitzmausnamen zu Gemüte: Afrikanische Riesenspitzmaus, Kleinfüßige Savannenspitzmaus, Niobes Spitzmaus, Uluguru-Waldspitzmaus. Etruskerspitzmaus, Zwerg-Waldmoschusspitzmaus, Mondwaldspitzmaus oder Hochmütige Waldspitzmaus, um nur einige deutsche Übertragungen zu nennen. Denn eigentlich benutzt man eine alte Sprache, vorzugsweise Latein, aber auch auf ein Idiom der australischen Aboriginals ist schon zurückgegriffen worden.
Die Namen der Kamelhalsfliege Agulla modesta adrythe, aphyrte, aphynphte sind nur scheinbar griechisch. In Wahrheit aber purer österreichischer Dialekt - "die Dritte", "Vierte", "Fünfte" - und "aphaphlyxte"? Hier darf die Leserin raten, oder sie lese die Artikelüberschrift noch einmal. Equus quagga quagga ahmt die Art und Weise nach, wie eine Ethnie der Koi in Südafrika diese Zebra-Art nennt, wobei sie ihrerseits das Wiehern dieser Pferdeartigen imitiert.
Wissenschaftlich benennen kann man schließlich auch Arten, deren Existenz nicht einmal bewiesen ist, wie mit dem Ungeheuer von Loch Ness 1975 in der Zeitschrift "Nature" als Nessiteras rhombopteryx geschehen. Zulässig ist der Name, auch wenn die Art bestenfalls hypothetisch existiert.
Michael Ohl: "Die Kunst der Benennung", Matthes & Seitz Verlag 2015, 317 S. 29,95 Euro




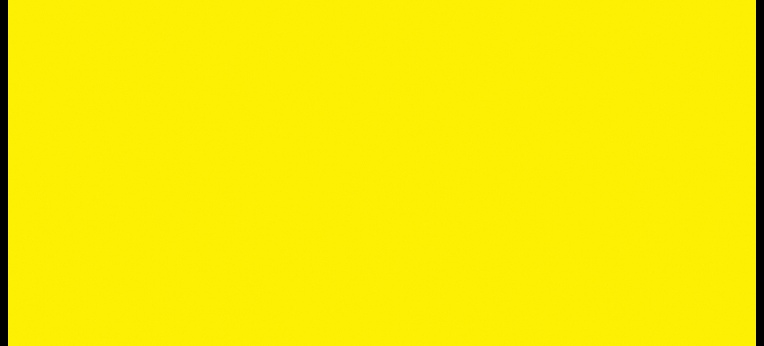




2 Kommentare
Kommentare
Hans Trutnau am Permanenter Link
>>adrythe, aphyrte, aphynphte und aphaphlyxte<< - köstlich. Aber warum darf nur die Leserein raten, ich als Leser aber nicht?
Andrea Pirstinger am Permanenter Link
JEDES Lesende darf raten!