"Die Phantasie ist der Natur gewachsen, das heißt auch: Sprache ist der Natur gewachsen. Das ist die Grundüberzeugung des Dichters." Dichten bedeutet, die Phantasie der Natur zu entziffern. Genau das tut Wilhelm Lehmann in seinen neu herausgegebenen Tagebüchern. Da schimmert die Novembersonne im Morgendunst wie das rotgelbe Dotter des Wendehalses durch die dünne Schale. "Um zu wirken, wird die Wirklichkeit surrealistisch."
Ein Dichter stellte sich zuerst die seit Thomas Nagel berühmt gewordene Frage, wie es wohl ist, eine Fledermaus zu sein. Am 19. November 1928 notierte Wilhelm Lehmann hier, in diesem Skizzenbuch und schier unerschöpflichen Steinbruch seiner Lyrik: "Ein Bündel von Nerven; wer es je in der Hand hielt, wird das Entsetzen des grauseidenen Wesens nie vergessen, wie Wind im Getreide Welle auf Welle den zarten Körper übergleitend, der über ein Gerüst aus Stäben gespannt ist." Der Autor, im Brotberuf Lehrer in Eckernförde, wechselte die Perspektive. Wie nimmt so ein Wesen uns war? "Weiche Berührung unseres Fingers muss der Fledermaus wie der Schlag eines Steinhammers im Gehirn dröhnen." Ausgesetzt scheint hier auch das Tier, ausgeliefert aber ebenso der Natur. "Wie ist es möglich, dass so ein Wunder an Überempfindlichkeit sich durch den Sturz der Jahrtausende herübergerettet hat? Mit märchenhafter Sinneskraft begabt und die Millionen Hindernisse des Daseins vermeidend."
Sorge kommt auf. "Aber freilich, wenn der mächtige Mensch sich nicht hütet, ist es fraglich, ob wir sie noch lange behalten werden. (Weil man gemerkt hat, wie wichtig sie ist, hat man ihr in Amerika bereits Unterschlupfmöglichkeiten geschaffen und Fledermaustürme gebaut.)". Lehmann, der 1882 als Sohn eines Lübecker Geschäftsmanns in Venezuela geboren wurde, hat Henry Thoreaus "Walden" mit Begeisterung gelesen, und das amerikanische Nature Writing lag ihm näher als die deutsche Romantik.
"Jedes Tier, das vergeht, jedes Lebewesen, das ausstirbt, verdünnt das Weltvokabular, bringt uns weiter zurück von der Wahrheit, die nur aus dem Zusammenklang aller Lebewesen sich herausarbeitet." Spricht da die Natur? Vom "Gedicht des sichtbaren Daseins" schreibt Lehmann in seinen Tagebüchern aus den Jahren 1927 bis 1931, die bei Matthes & Seitz jetzt wieder ediert worden sind.
Denkt die Natur? Der Idealzustand des Menschen ist jedenfalls, wie ein Stück Natur zu werden. Gleich jener wahren Menschen einst des Tschuang Tse. Emotionslos. "Alle ihre Gefühlsäußerungen waren unpersönlich wie die vier Jahreszeiten. Allen Lebewesen begegneten sie, wie es ihnen entsprach." Darin sollte man keinen Hang zur Esoterik vermuten, auch nicht, wenn Lehmann Nagasena gedenkt, des in griechischer Philosophie geschulten Philosophen, der am Hindukusch vor fast 2000 Jahren einem König philosophisch Rede und Antwort stand. Ihn lässt Lehmann fragen, was der Wind sei. Der ist weder groß noch klein, hat weder Farbe noch Gestalt, und doch existiert er.
Dieser Unsichtbare ist Protagonist in Lehmanns Tagebüchern. Er ist immer da und immer anders. Menschen hingegen kommen kaum vor, sie sind Lehmanns Romanen vorbehalten. Und ich bin überzeugt, er meint wirklich den ewigen Küstenwind im Konkreten und nicht das Nichts.
Lehmann ist ein unermüdlicher Betrachter. Er schaut genau hin. Der Zeitgenosse Klaus Bossfeld hat ähnlich genau das Wachstum der Pflanzen, ihr Keimen, Blühen und Reifen zu Früchten festgehalten wie Lehmann. Beide sind fasziniert von der Geometrie und Architektur des Organischen. Die Fotografie friert das Wachstum ein. Die Sprache dagegen fasst die Natur im Fluss und schult die Wahrnehmung des Lebendigen, das uns umfängt und niemals bleibt, wie es ist. "Wer sich gewöhnt hat, die Landschaft als einen schwingenden Zustand zu betrachten, in dem ein Augenblick in den anderen vergleitet, die Hügel wie Wolkengestalten schwimmen, Form zu Form eilt, fasst auch diesen immer wieder gelockerten Starrkrampf wie eine Bemühung der Natur auf, im Gleichklang zu schweben." Kybernetiker und Ökologen werden später aus einer solchen Weltsicht schöpfen.
Dem Dichter freilich kommt es zunächst einmal darauf an, die Umwelt in einer völlig unverbrauchten Weise in Worte zu fassen. Da wellt dann das Meer in Zarthellblau, der "Farbe des Stareneis". Der Leib der rotschwarzen Libelle gleicht einer "indianischen Göttersäule", und Meisen und Goldhähnchen "wiehern leise wie kleine Elfenbeinpferde".
"Der Mut der Existenz" haucht uns in der Einfachheit der Anemone an. Das Leben ist Wagnis und Ausgeliefertsein zugleich. Denn die Natur geschieht. "Aber auch im Menschen geschieht mehr, als er handelt", notiert Lehmann am 17. Februar 1948, in dem er sein Tagebuch noch einmal aufnimmt. Er starb 1968. Es ist Zeit, Wilhelm Lehmann wieder zu lesen.
Wilhelm Lehmann: "Bukolisches Tagebuch. Mit einem Nachwort von Hanns Zischler, Naturkunden, Matthes & Seitz Verlag Berlin 2017, 291 S., 22 Euro



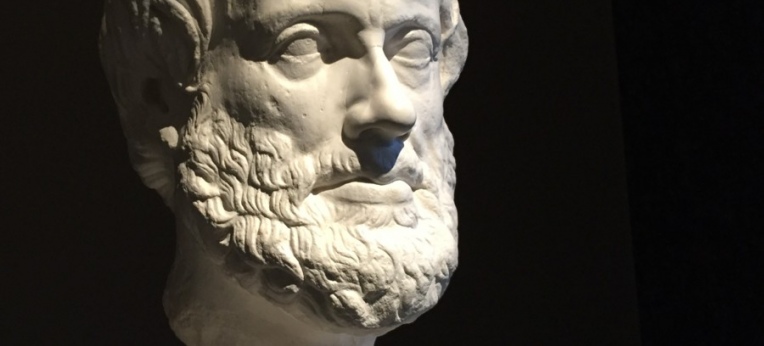
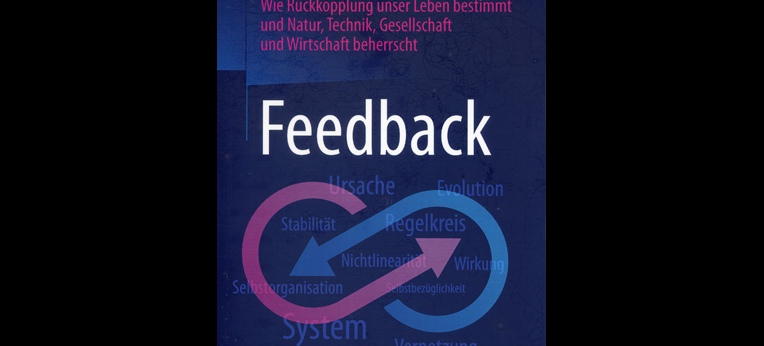


2 Kommentare
Kommentare
Kay Krause am Permanenter Link
Sprache, das ist Kommunikation.
Sprache funktioniert auch ohne Ton.
Sprache, das ist Dichtung,
und geistige Belichtung.
Sprache ist ein Teil der Natur,
Sprache ist "Ich liebe Dich."
Sprache ist "Verstehst Du mich?"
Jedes Tier spricht seine Sprache,
wenn auch nicht im gleichen Maße.
Und Du als Stadtmensch glaubst es kaum:
zu Dir spricht jede Blume, jeder Baum.
Mit Gleichgesinnten und ganz ohne Hände
spricht jeder Wurm im Garten Bände.
Ja, selbst die winzige Mikrobe
(die ich hier besonders lobe!),
kommuniziert mit den Kollegen,
und kann so Kontakte pflegen.
Inwieweit Atome sprechen mit Neutronen
(die doch sehr eng zusammen wohnen),
weiß ich nicht, das ist mir gänzlich unbekannt,
und liegt wissenschaftlich noch nicht auf der Hand.
Doch Sprache spricht nicht nur von Mund zu Mund,
auch Gesten geben sprachlich etwas kund.
Und so, wie Männer schöne Frau'n umkreisen,
um denen ihre Liebe zu beweisen,
so kreist das Neutron um's Atom herum,
und der Gedanke ist doch gar nicht dumm,
dass heiße Liebe hier im Spiel,
und Kommunikation das Ziel.
Zum Schluß das Fazit sei gegeben:
Sprache, das ist einfach Leben!
Simone Guski am Permanenter Link
Danke schön!