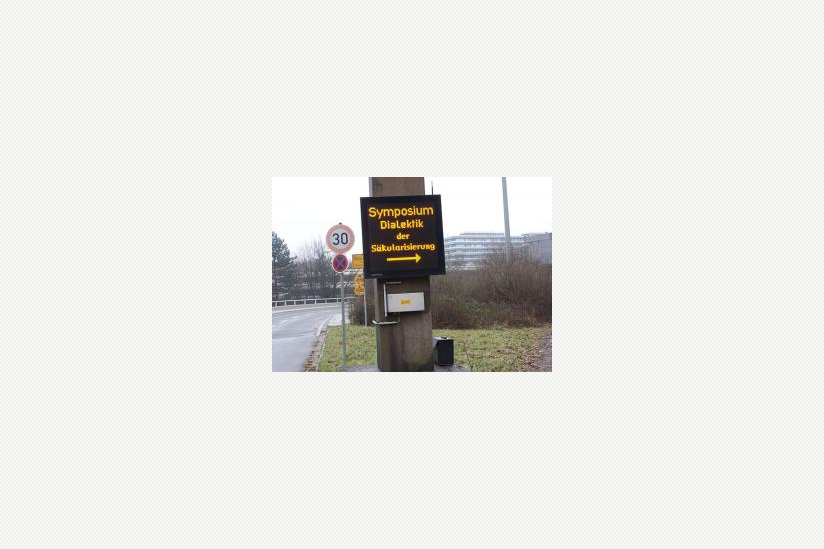BOCHUM. Es wird keinen Gottesbezug in der Europäischen Verfassung geben. Der
europäische Einigungsprozess ist wichtiger als dieses Detail. Das ist den Worten von Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert am gestrigen Sonntag auf dem Abschlusspodium der Konferenz „Dialektik der Säkularisierung“ zu entnehmen. Der hpd berichtete über diese Tagung <vorab>. Lammert, Schirmherr des Symposiums, sprach davon, dass er es hinsichtlich des Gottesbezuges für ausgeschlossen halte, „dass dies erreicht werden könnte“.
Vorausgegangen waren diesem Statement Stellungnahmen aus den fünf Arbeitskreisen der Tagung. Von denen legten einige eine andere Interpretation der Dialektik der Säkularisierung nahe. Wie überhaupt der Forschungstitel des Projektes „Religion und Säkularisierung“ hieß. Was aber die hochkarätig vor allem durch Philosophen besetzte Konferenz unter Anwesenheit von etwa 400 Gästen diskutierte und in Erinnerung an die „Dialektik der Aufklärung“ (Horkheimer / Adorno) präsentierte, das reichte weit über die historische Erinnerung hinaus und fragte, was hier und heute eventuell in welches Gegenteil umschlägt, welche Wende die Geschichte der Säkularisierung vielleicht gerade nimmt.
Wie immer auf so kompakten Tagungen, diese war sogar bewusst als Forschungssymposium angelegt, gibt es wenig Diskussion im Saal, aber viel Vorträge. Das forderte in der Schlussrunde Teilnehmende zu Grundsatzerklärungen heraus, die Aussagen und Tendenzen im verhandelten Stoff subjektiv zuspitzten. So meldete sich Ernst Grewel zu Wort, um (bezogen auf den von ihm besuchten Arbeitskreis) die theologische Dominanz in der Debatte über Anthropologie zu kritisieren. Religion sei als eine Konstante behauptet worden. Überhaupt sei doch beim Säkularisierungsbegriff und seiner Anwendung auf Deutschland zu bedenken, dass Staat und Kirche letztlich hier noch nicht vollständig getrennt und die Konfessionsfreien stärker zu beachten seien. Dazu merkte Arbeitskreisleiter Volkhard Krech (Bochum) an, dass es durchaus Debatten gäbe, das Drittel der Konfessionslosen in der Bevölkerung sogar als „dritte Konfession“ zu fassen.
Moderator Walter Jaeschke (Bochum, Arbeitskreis „Menschenwürde und Säkularisierung“) teilte in einer Replik mit, Kardinal Ratzinger aus dem Buch von Detlef Horster (Hannover) „Jürgen Habermas und der Papst“ (2006) zitierend, dass Religion für die menschliche „Zuwendung“ unerlässlich sei. Dies wiederum veranlasste den Autor dieses Berichts zu dem lauten Zwischenruf „Wie das? Das kann auch Nicht-Religion!“ Dies wiederum hielt einen Diskutanten nicht mehr auf seinem Stuhl. Er rief ins Mikrofon, an das Podium appellierend, es gehe doch schließlich nur um Religionen, solche mit und solche ohne Gott.
Jedenfalls legte der Schlussakt der Veranstaltung Verwunderungen und Verwundungen offen, die bei der überaus sachlichen und argumentativen, sehr streng akademischen Debatte so nicht zu erwarten gewesen waren. Aber die Reaktionen zeigen dann doch, dass es bei dem ganzen Thema um Vorgänge geht, die bei den drei Hauptfragen, die die Organisatoren um Walter Schweidler (Bochum) der Konferenz vorgaben, nun einmal aufkommen. Schließlich geht es auch um Bekenntnisse – um „Musikalisches“: „Gibt es Unabstimmbares in der Demokratie?“ „Gibt es eine Leitkultur?“ (dazu in diesem Bericht unten mehr) und „Gibt es eine ’postsäkulare’ Gesellschaft“? Auf die hier dargebotene Kontroverse zwischen Peter Sloterdejk (Karlsruhe) und Robert Spaemann (München) wird an anderer Stelle einzugehen sein, wie überhaupt auf den noch dieses Jahr erscheinenden Protokollband hinzuweisen ist.
Bevor also auf die „Leitkultur“-Debatte eingegangen wird, ist auf noch eine politische Pointe hinzuweisen, die der Hauptreferent zu diesem Thema, Julian Nida-Rümelin (München), in einer seiner Repliken anbringen zu müssen meinte. Er hatte sein humanistisches Konzept der „Leitkultur“ vorgetragen. Es wurde aus dem Saal heraus als ein „atheistisches“ bezeichnet. Auch der Autor dieses Berichtes sieht dieses so, weil es ohne Gott auskommt. Nun ist aber die Bezeichnung „atheistisch“ noch immer so etwas wie ein ehrenrühriger Anwurf. Das muss jedenfalls der Referent so gesehen haben, sonst hätte er sich nicht ausdrücklich von einem (nicht näher benannten) militanten atheistischen Humanismus abgegrenzt.
So verständlich dies vielleicht noch gewesen sein mag, bei dieser Gelegenheit aber die „Humanistische Union“ als früher einmal existente Vereinigung zu bezeichnen und ihr sozusagen aufs Grab zu schreiben, sie sei eine ganz linke „Tarnorganisation“ gewesen, war ebenso uninformiert wie deplatziert hinsichtlich der humanistischen Tätigkeit, die dieser Bürgerrechtsverband gerade hinsichtlich der Sicherung der Menschenrechte <leistet>.
Dem Komplex „Leitkultur“ voraus ging eine von Christoph Böhr moderierte Runde zum deutschen Verfassungsrecht, die Christian Hillgruber (Bonn) mit der These eröffnete, das Unabstimmbare sei hinreichend in der Verfassung selbst bestimmt. Wer hier etwas ändern wolle, müsse sich (Art. 79,3) als Revolutionär kenntlich machen. Die Menschenwürde (Art. 1) bestimme den Inhalt der Grundrechte und bei deren Sicherung sei bei Interpretationen der Verfassung und dabei, welcher Wille sich hier durchsetze, letztlich nicht der geistesgeschichtliche Hintergrund entscheidend, sondern die Exegese des positiven Rechts und das Erkennen dessen, was die Väter und Mütter des Grundgesetzes zum Zeitpunkt der Normsetzung für maßgeblich hielten.
Dabei seien zwei Rechtsgüter nicht hinaus definierbar: dass jede Person keine Sache, sondern ein Rechtsgut ist; dass die Würde nicht verliehen wird, so dass niemand jemals rechtlos sein darf, also keine juristische Selektion stattfinden dürfe. Das Lebensrecht existiere grundsätzlich, unabhängig auch von religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen der Handelnden. Über die Frage, ob bereits ungeborenes Leben diese Würde habe – was der Referent bejahte – entspann sich dann ein unentschiedener Streit. Hillgrubers Antwort auf das Unabstimmbare lautete, man müsse dafür eben Mehrheiten schaffen bzw. erhalten.
Winfried Hassemer, Vorsitzender des zweiten Senats und Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, entwickelte seine Thesen in einem Dreierschritt: Es gibt Unabstimmbares, es gibt solches nicht, vielleicht aber doch und was wäre dafür zu tun?
Wenn man so wolle, könne man die Art. 19,2 und 79,3 GG für den Kern „alteuropäischer ’Leitkultur’“ halten. Die Demokratie kenne zwar nur Abstimmbares, denn es gäbe kein Naturrecht und, da es auch keine Staatskirche mehr gebe, brauche auch der Staat nicht auf religiöse Weisheiten zu hören. Doch Ewigkeitsrechte kann er sich auch nicht selbst sichern, angesichts der Tatsache, dass in der Demokratie nun einmal Abstimmungen und Wahlen vorgesehen seien.
„Leitkultur“ sei für ihn die akzeptierte kulturelle Norm, dasjenige, was nicht abstimmbar sei, sondern „abstimmungsresistent“. Dazu zählte er das Folterverbot (im Kontext mit dem Abwägungsverbot, der Opferungsproblematik), die Sicherung nichtkorrupter Gerichtsbarkeit, die ungefähre Gleichheit der Wahlen, die Hinnahme der Abwahl und die Gleichheit vor Gericht (am Beispiel der Fälle Hartz und Ackermann). Die Leitkultur bedürfe der Pflege und des Diskurses.
An dieser Stelle ist ein Verweis auf das wie immer assoziativ, aber leider mit übergroßem Tempo vorgetragene Referat von Peter Sloterdejk angebracht, weil es in der These vom „Neueren Testament“ gipfelte, der „großen Erzählung“, die über das Alte und Neue Testament hinausreiche, an dem gerade (hoffentlich) geschrieben werde in Zeiten des Endes der Unmusikalität in den kalten Plattenbauten der Moderne. Es stehe in diesem Buch all das, was in den letzten 1.800 Jahren zu den Weisheiten hinzugekommen wäre. Es erfasse, was die Menschheit nicht vergessen dürfe.
Julian Nida-Rümelin gab die Einführung in die „Leitkultur“-Debatte, in dem er kurz – auf Bassam Tibi und Norbert Lammert verweisend – in die Debattengeschichte einführte. Man müsse von der Frage ausgehen, was die normative Substanz der Demokratie sei. Er erkenne hier die Orientierung an der individuellen Selbstbestimmung, die er „humanistisch geprägten Individualismus“ nenne; die Rechtsgleichheit als „normativer Universalismus“, mit der Verinnerlichung als Gerechtigkeitssinn; und die Hilfspflichten, welche die staatliche Ordnung erhalten (dazu zählen auch solidarische Aktionen und soziale Bürgerrechte) sowie die individuellen Aktionen garantieren und zugleich zivilisatorisch einhegen.
Er erkenne zahlreiche Opponenten gegen diese Auffassung, drei wolle er kenntlich machen: diejenigen, die kulturelle Prägungen für überflüssig halten, weil sie den Markt als Ordnungsrahmen und Werte für marktgängige Güter ansehen; diejenigen, die eine postmoderne universelle Indifferenz annehmen, der letztlich alles egal sei; und diejenigen, die für multikulturalistischen Pluralismus sind, in dem es keine großen Gemeinsamkeiten gibt, dafür um so mehr Identitätsvielfalt.
Humanismus als Leitkultur bedeute, nach der Urteilskraft der Menschen zu fragen und diese zu bilden, denn die Expertokratie sei an ihr Ende gekommen. Rationalität und Freiheit seien zusammen zu denken, denn man brauche Menschen, die in der Lage sind, Gründe vernünftig abzuwägen, um selbst herauszubekommen, was richtig ist. In dieser Annahme liege zugleich die Universalität dieser Maxime begründet, denn Rechtstreue reiche nicht aus, um Toleranz aus Respekt vor dem Anderen zu üben und die Differenzen auszuhalten.
Daraus folge auch das Neutralitätsgebot des Staates und der Grundsatz, dass die Menschen selbst verantwortlich sind. Das Recht sei für die Sicherung der Individualität da, und dafür, dass man sich nicht einmischt in die Individualität des Anderen. Das Unabstimmbare sei die humanistische Leitkultur, ohne die keine Demokratie möglich sei.
Humanismus ist in Nida-Rümelins Verständnis ein Konzept, auf das man sich über religiöse Grenzen hinweg zu einigen vermag. Insofern wird sein Bestehen auf Nicht-Atheismus (s.o.) zwar verständlicher, aber zugleich klar, dass er Humanismus eher als eine Sammlung vernünftiger Prinzipien und weniger (gar nicht?) als eine Weltanschauung sieht – wobei zu erklären wäre, was an dem Konzept nicht selbst weltanschaulich ist.
Das wird deutlicher, wenn man dieses Konzept der „Leitkultur“ zu dem von Norbert Lammert in Beziehung setzt. Der Begriff sei erklärungsbedürftig. Aber in der gesellschaftlichen Debatte sei es oft so, dass man sich die Begriffe nicht aussuchen könne, die man klären müsse.
In zehn Anmerkungen legte Lammert dann seine Auffassung dar. Erstens sei wichtig, dass Streit sein müsse. Zweitens könne niemand Anspruch auf Überlegenheit erwarten. Drittens sei kulturgeschichtlich gesehen eine Rangfolge nicht möglich, aber in einer Gesellschaft unverzichtbar. Denn es sei viertens nötig, einen Mindestbestand gemeinsamer Werte gegen Beliebigkeit zu setzen. Fünftens könne Vielfalt ohne Verbindlichkeiten im Gemeinschaftlichen nicht auskommen. Sechstens müssten Verfassungen als Ausdruck von Kulturen gesehen werden und nicht als Ersatz dafür, denn nicht die Politik halte zusammen, sondern Kultur.
Siebentens (und hier beginnt der Dissens zu Nida-Rümelin deutlich zu werden, ohne so ausgesprochen worden zu sein) sei Religion die wichtigste Institutionen für Werte und man müsse gegen zwei Übertreibungen (Verirrungen) polemisieren: dass man bestimmte religiöse Überzeugungen eins zu eins in Recht umsetzen könne; dass man leichtfertig religiöse Überzeugungen für unbedeutend erklärt.
Achtens sei Multikulturalität kein brauchbares Konzept der Selbstkonstituierung einer Gesellschaft. Neuntens müsse die Einheit von Glaube und Vernunft für unsere Gesellschaft als konstitutiv angenommen werden (unter Verweis auf das Tagungsmotto, das vom Dialog Ratzinger / Habermas herrühre). Zehntens bleibe der Zweifel an absoluten Wahrheiten das Gütesiegel unseres Kulturverständnisses.
Werden diese beiden Standpunkte (Nida-Rümelin / Lammert) in Beziehung gesetzt zu den anderen Debatten auf der Konferenz, so drängt sich der Eindruck auf, dass der Diskurs über die Dialektik der Säkularisierung dann doch ein zutiefst innersäkularer war. Auch theologische Standpunkte wurden in weltlicher Sprache vorgetragen. Das mag banal oder gar unangemessen klingen beim Bericht über eine wissenschaftliche Tagung, bezeichnet aber vielleicht den Kern der Säkularität, dass auch das Reden über Gott oder über Religiöses außerreligiös erfolgt.
So halte ich einige Klagen am Rande, in einigen Wortmeldungen und besonders im insgesamt sehr erhellenden und sehr konservativ gefärbten Referat von Robert Spaemann (es sei reale Betrachtung nötig, ob Säkularisierung wirklich stattfand), man hätte Säkularisierung als Begriff genauer bestimmen müssen, nur bedingt für stichhaltig. Den Säkularen war klar, worum es geht. Nicht- oder Nur-Bedingt-Säkulare hätten gern ihre relativierenden Definitionen eingebracht. Doch: Sie passten nicht in die Diskursweise.
Das wurde besonders im Arbeitskreis „Menschenwürde“ deutlich, als ein Diskutant, ein einheimischer Pfarrer im Ruhestand, besorgt fragte, ob nicht – wenn Gott ausfalle als letzte Rückversicherungsinstanz – die Kalaschnikow irgendwann regieren werde. Am Tag zuvor hatte Sloterdejk erklärt, dass mit der Entstaatlichung der Sozialversicherungen nach dem Beispiel der USA auch hierzulande Gott zum höchsten und letztendlichen Privatversicherer werde, wenn alle andren Stützen wegfallen. Man benötige schon eine Antwort darauf, in welche Gesellschaft wir da fallen.
Detlef Horster begann seine Rede über Menschenwürde äußerst praktisch und politisch: Was bedeutet sie, wenn Referat V/B/4 im Arbeitsministerium 345.- € / Monat für Hartz IV-Empfänger für menschenwürdig hält? Überhaupt werde erst seit 1966 die Sozialhilfe in der Bundesrepublik mit Argumenten der Menschenwürde begründet. Aus diesem Bezug leitete der Referent ab, ob es nicht klug sei, Menschenwürde von ihren Verletzungen her zu bestimmen, wo z.B. Folter und Armut zum Verlust der Selbstachtung führen. Für Selbstachtung wiederum sei kognitive Kompetenz und die Fähigkeit zur Selbstbeurteilung nötig. Man müsse ernsthaft über ein Grundeinkommen nachdenken und sich auch den Konzepten der humanistischen <Egalitarismuskritik> stellen, wie sie z.B. aus den USA durch Angelika Krebs hierher gekommen sei. Dagegen erklärte Nida-Rümelin sofort das Gleichheitsprinzip für unaufgebbar.
Den Höhepunkt in diesem Arbeitskreis setzte zweifellos der China-Kenner Heiner Roetz (Bochum). Er nutzte seine Anmerkungen zum Referat und zur Diskussion, um v.a. drei Positionen zu verdeutlichen: Als Kenner autoritärer asiatischer Despotien halte er sich erstens für verpflichtet, auf die vergleichbare Haltung der Kirchen zu den Menschenrechten im 19. Jahrhundert zu verweisen, um historisch den angeblichen Beitrag der Katholischen Kirche bei der Definition der Menschenrechte zu relativieren. Zweitens sei eine christliche Begründung der Menschenrechte bei deren Einführung in China mehr als problematisch. Aber drittens gäbe es in der chinesischen Antike einige Anknüpfungspunkte, Menschenrechte rein ethisch aus eigener chinesischer Tradition für diese Kultur herzuleiten.
Am Schluss sei noch einmal auf Norbert Lammerts Arbeitspensum am Wochenende eingegangen, weil dies ebenfalls zur Dialektik der Säkularisierung gehört. Die <„Westfälische Rundschau“> berichtet heute, dass er am Samstag von einer Bochumer Karnevalsvereinigung die „Goldene Grubenlampe“ verliehen bekam. „Vorher war Lammert bereits an der Ruhr-Uni zu Gast, wo er an einem Symposium zur ’Dialektik der Säkularisierung’ teilgenommen hatte. Danach hatte er seine Flexibilität unter Beweis gestellt, indem er den Valentinsball im Stadtparkrestaurant besuchte, um zu fortgeschrittener Stunde im Zelt an der Herner Straße aufzutreten.“
Anmerkung: Jürgen Habermas selbst äußerte sich übrigens zeitgleich zum Thema in der <“Neuen Züricher Zeitung“>.
Horst Groschopp