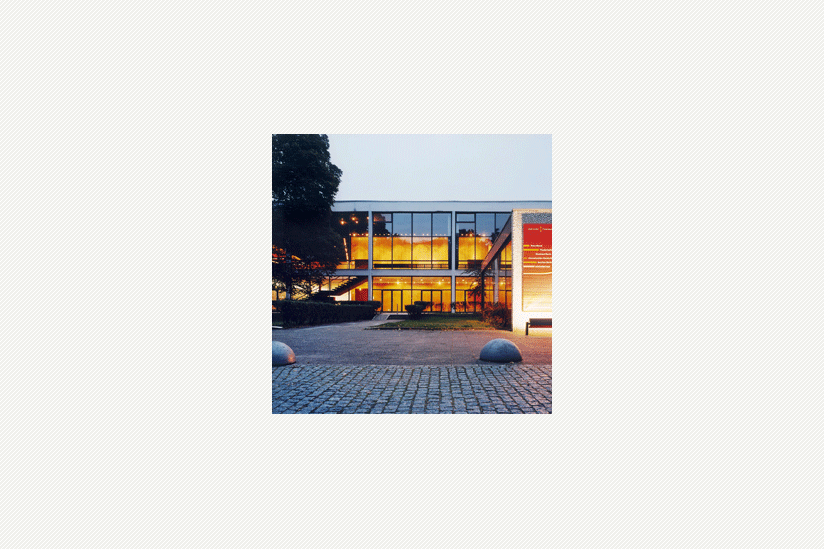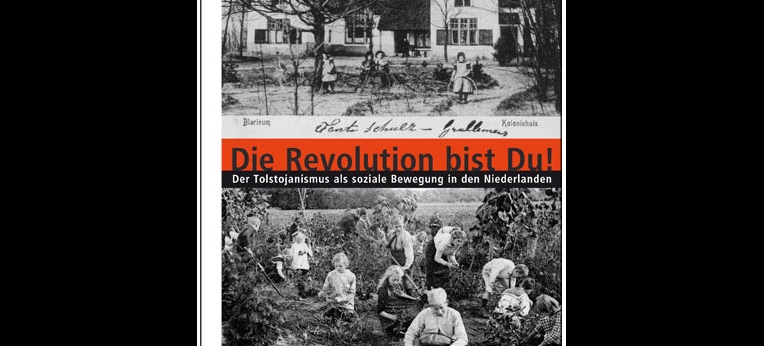BERLIN. (hpd) Salman Rushdie sprach auf dem Internationalen Literaturfestival über Literatur und über Religion. Darüber, was sie voneinander unterscheidet und welche Verwirrungen entstehen, wenn von der Literatur erwartet wird, was in früheren Zeiten von der Religion erhoffte wurde. Und warum sein autobiografischer Roman „Joseph Anton“ die Realität wiedergibt und trotzdem Literatur ist.
Der gut gelaunte Mann mit lakonischem Witz plauderte listig scheinbar leichthin. Er strahlte, und seine Glatze glänzte fröhlich im Scheinwerferlicht – kaum vorzustellen, dass er das alles erlebt hat und überlebt hat, was ihm widerfahren ist. Ein Sieger. Sein Sieg besteht darin, dass er noch lebt. Und weiter schreibt.
Fast 25 Jahre ist es her, als an einem Valentinstag Khomeini Salman Rushdies Ermordung befahl. Vielleicht bezog Salman Rushdie seine Widerstandskraft vor allem daraus, dass er eines nie gelten ließ: dass es sich um ein Todesurteil handelte. „Er wollte widersprechen. Das sei es nicht … Es handelte sich nicht um ein Edikt eines Gerichts, das er anerkannte“, heißt es in dem Roman. Trotzdem stand alles auf dem Spiel: In seinem Roman wollte er zeigen, „wie leicht es ist, einen Menschen auszulöschen und eine andere Version von ihm zu schaffen“, sagt Salman Rushdie im Berliner Festspielhaus. Was er durchlebte und beschrieb, betrachtet er heute als ein Vorwort, ein sehr privates, persönliches zu dem, was sich in der jüngsten Geschichte später abspielen sollte.
Die Mischung aus Faktizität und Fiktion ist es, die Leser und Zuhörer immer wieder durchschüttelt. Persönliches Leben und große Ereignisse werden miteinander verwoben. Rushdie erfuhr von der Fatwa sechs Tage, nachdem seine zweite Frau ihm nach nur einem Jahr Ehe erklärt hatte, sie fühle sich nicht mehr gut mit ihm. Noch gar nicht lange her war es, dass er mit Bruce Chatwin nach Australien gereist war und den Berg Uluru bestiegen hatte, den, um die religiösen Gefühle der Aborigines zu respektieren, heute keiner mehr ohne Genehmigung betreten darf. Auf Chatwins Beerdigung zu gehen, war Rushdies erste mutige Entscheidung, nachdem er von der Fatwa erfahren hatte. Rushdie riskierte die gefährliche Öffentlichkeit dieser Trauerzeremonie.
Die beiden Autoren hatten in Australien einmal einem Gerichtsverfahren zugehört, in dem ein weißer Trucker-Fahrer sich verantworten musste, aus einem nichtigen Anlass fünf Menschen getötet zu haben, indem er den Laster in eine Bar fuhr. „Der Laster war ihm wichtiger als die Menschenleben.“ Heute urteilt Rushdie über die religiösen Fanatiker: „Ihr Glaube war ihr Lastwagen, den sie mehr als Menschen liebten.“ Zeitgeschichte fließt immer wieder nebenbei ein - „Das war wenige Wochen bevor Mandela freigelassen wurde“, erinnert er sich, als er mit seinem Sohn schließlich sogar unter Polizeischutz auf den Jahrmarkt ging.
Den Roman habe er geschrieben, weil so viel Falsches über die Ereignisse jener Jahre kursierte. „Die Wiederholung macht es, dass die Dinge zu Fakten werden...was nicht wahr ist, wird es so plötzlich doch.“ Aber natürlich hat ihm auch eine innere Stimme gesagt: „Das ist eine gute Geschichte!“ Er hat sie nicht in Ich-Form geschrieben, obwohl er so angefangen hat. „Ständig sagte ich ´mich´,´mir´, ´ich´, und dann dachte ich: ´Halt den Mund!´“ Nicht in Ich-Form zu schreiben, machte es ihm schließlich überhaupt erst möglich, über das Geschehene zu berichten. Und obwohl Rushdie einräumt, dass der Roman eine sehr einfache Struktur habe, betont er: „Die Wahrheit zu sagen, ist kein einfaches Konzept.“
Sein Sohn bat ihn einmal, eine Geschichte zu erzählen – und bekam zur Antwort, dass könne er jetzt nicht. Aber wenn das Buch fertig sei, werde er eines für ihn schreiben. Dabei dachte sich der Vater: „Jetzt bleibt vielleicht nicht genug Zeit, noch ein Buch zu schreiben.“ Zwölf Jahre hatte er unter ständigem Polizeischutz im Verborgenen gelebt, zwei Jahre würde er an dem Buch schreiben und ein Jahr überall auf der Welt darüber reden müssen...
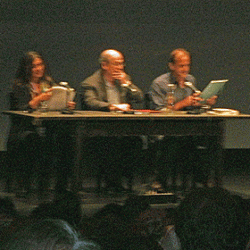 Natürlich musste Salman Rushdie einmal mehr die Frage seines Gesprächspartners, seines Übersetzers Bernhard Robben, beantworten, warum sein Protagonist den Namen Joseph Anton trägt. Joseph nach Joseph Conrad und Anton nach Anton Tschechow. „Tschechow war ein Autor der Einsamkeit und der Isolation“, antwortet Rushdie, und Joseph Conrad habe viel über Spionage und Geheimdienste geschrieben, aber wichtiger war Salman Rushdie ein Satz aus dem „Herz der Finsternis“, in dem der schwer an Tuberkulose erkrankte Held der Geschichte ausspricht: „Ich muss leben, bis ich mein Leben sterbe.“
Natürlich musste Salman Rushdie einmal mehr die Frage seines Gesprächspartners, seines Übersetzers Bernhard Robben, beantworten, warum sein Protagonist den Namen Joseph Anton trägt. Joseph nach Joseph Conrad und Anton nach Anton Tschechow. „Tschechow war ein Autor der Einsamkeit und der Isolation“, antwortet Rushdie, und Joseph Conrad habe viel über Spionage und Geheimdienste geschrieben, aber wichtiger war Salman Rushdie ein Satz aus dem „Herz der Finsternis“, in dem der schwer an Tuberkulose erkrankte Held der Geschichte ausspricht: „Ich muss leben, bis ich mein Leben sterbe.“
Salam Rushdie versteht bis heute nicht, warum sein Buch „Die satanischen Verse“ eine solche Wut hat erzeugen können. Es handele sich doch nur um eine einzige große Traumfrequenz (der beiden nach einem Terrorangriff auf ein Flugzeug abstürzenden und ineinander verkrallten Schauspieler Gibril und Saladin, von denen der eine zum Engel und der andere zum Teufel mutiert). Untersucht habe er das Phänomen der Offenbarung. Der fromme Gibril hat eine Erfahrung, der die des Religionsgründers Mohammeds sicher sehr ähnlich war. „Manchmal hört er nur, manchmal sieht er nur. Manchmal nimmt er nur sein Inneres war, manchmal nur Äußeres. Manche Momente sind äußerst schmerzhaft. Ganz klar, so etwas gibt es. Alle Mystiker berichten von solchen Erfahrungen. Die Frage ist nur, würde ich Engel sehen, wenn ich bei ihm stünde? Natürlich sagt mir mein skeptischer Sinn: Ich würde es nicht. Trotzdem hatte Mohammed diese Erfahrung. Es handelt ich um das, was wir ein gespaltenes, schizophrenes Bewusstsein nennen. Diese Frage behandele ich im zweiten Kapitel. Dabei entstehen zwei Fragen: Wie tritt das Neue in die Welt? Erster Test: die Schwäche. In 999 von 1000 Fällen wirst du zerstört. Ein Fall wird die Welt verändern. Die zweite Frage ist: Wie schwach ist derjenige, der die mystische Erfahrung macht? Alle Propheten erleiden Momente der Schwäche. Überstehen sie diese, kommen sie groß raus. Wenn jemand stark ist, zweifelt keiner mehr - bis auf ein paar Autoren.“
Robbens Vergleich, dies erinnere auch an die überwundene Schwäche Joseph Antons, entgegnet Salman Rushdie knapp: „Ich bin kein Prophet.“ Auf des Übersetzers besorgte Feststellung, Bücher zu lesen mache noch keinen besseren Menschen, kontert er ebenso trocken: „Ich würde es mögen, wenn es so wäre, aber ich bin auch nicht besser geworden.“ Er erinnert an Ezra Pound, der mit den Faschisten liebäugelte. Aber warum lesen wir dann? Rushdie: „Warum nicht? Fragt man das die anderen Künste? Warum soll gerade die Literatur die Priesterrolle übernehmen? Als Leser möchte ich nicht gesagt bekommen, was ich denken soll. Große Literatur lehrt nicht, aber sie bietet eine Weise an, die Welt zu sehen. Sie ist keine Lehrerin, die erzieht. Sie ist nicht schlau – nur ein bisschen.“
Unter den rund 1000 Zuhörern der Veranstaltung im - fast - vollen Haus war übrigens auch eine junge, klug und hübsch aussehende Frau mit Kopftuch zu sehen.
Simone Guski