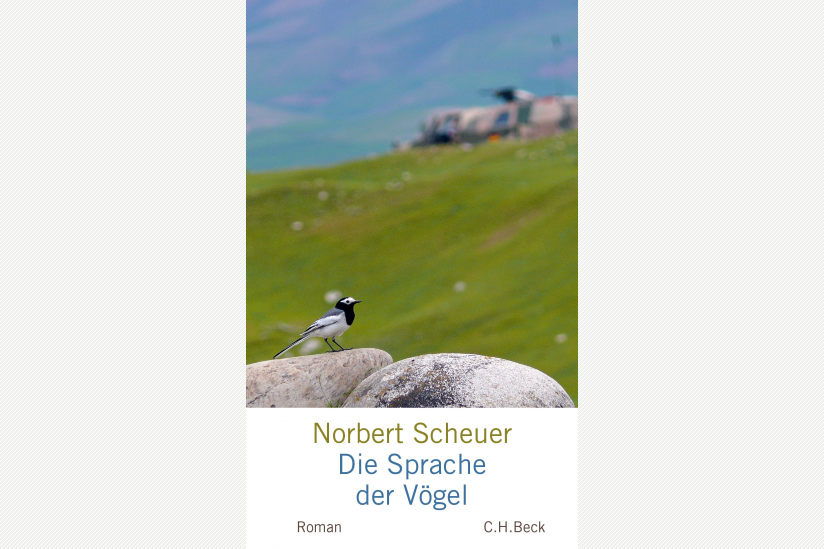BERLIN. (hpd) Norbert Scheuers Roman "Die Sprache der Vögel" ist kein Buch über Vögel. Jedenfalls nicht in erster Linie. Er stellt die Frage, was einem Menschen alles zustoßen muss, damit er sich bei der Bundeswehr zum Afghanistan-Einsatz meldet. Aber es ist auch ein sehr romantisches Buch. Seine Vögel gleichen hingetuschten Chiffren. Sie sind Lettern einer fast kabbalistischen Philosophie.
So einen wie Paul Arimond gab es wirklich. Der US-Amerikaner Jonathan Trouern-Trend beobachtete während seines Irak-Einsatzes minutiös und kenntnisreich die Vögel des Zweistromlandes. Weil er, anders als die deutschen Söldner, nicht die meiste Zeit eingeschlossen im Camp zubrachte, hatte er dazu reichlich Gelegenheit. Er führte darüber einen Blog – militärische Ereignisse bleiben natürlich völlig ausgeklammert. Das Blog erschien als Buch, "Birding Babylon", 2009 auch auf Deutsch.
Scheuers Romanfigur hat seine Leidenschaft für die Vögel schon in den Genen. Bereits ein Urahn bereiste zur Goethe-Zeit das Land mit dem blauesten aller Himmel, um die Ursprache der Vögel zu suchen. Mit seinem Vater, dessen Fähigkeiten im Hochsprung dem Fliegen schon sehr nahe kommen, beobachtet er nichts lieber als Vögel, so seltene wie Wanderfalken, die unter der Brücke nisteten. Das waren die glücklichsten Momente im Leben von Vater und Sohn.
Nach Afghanistan zog es ihn, als alles um ihn zusammenbrach. Seine Mutter trieb sich herum. Sein Vater hatte Suizid begangen, seine Schwester war drogensüchtig. Er selbst hatte einen Unfall verursacht, nach dem sein bester Freund ohne Verstand und Fähigkeit sich zu bewegen und sich zu artikulieren zurückblieb. So tritt er einen Dienst als Sanitäter an, will aber dort im Orient vor allem Vögel beobachten.
Sie haben alle zusammen, meint er, eine gemeinsame Sprache, mit der sie den Himmel singen. Ihre Grammatik bilden die Linien ihrer Flüge. Und auch die Federn sind Teil dieser Sprache, vor allem aber ihre Melodien, die, den Vögeln meist angeboren, so etwas wie die Sphärenklänge der Welt sind. Paul verlässt immer wieder verbotenerweise das Lager, um sie an einem See zu beobachten, der auch ein seine Farben stets wandelnder Spiegel des Himmels ist. Der Verlust der Freundin zuhause und dass sein verunglückter Freund in der Heimat stirbt, schließlich noch ein neu gewonnener afghanischer Freund ums Leben kommt, der Krieg um ihn herum zehren auch an Pauls Verstand. Aber er schreibt die ganze Zeit über – sehr knapp und verdichtet- was ihn bewegt. Er beschreibt die Vögel, die Marotten seiner Kameraden und seine Einsätze, die immer blutiger und härter werden.
Was er da aufzeichnet, - ja er zeichnet dazu seine gefiederten Lieblinge auch wortwörtlich mit Tusche aus Kaffeewasser - gelangt in die Hände seiner ehemaligen, nun schwerkranken Lehrerin, wird von einer Regenböe durcheinandergewirbelt, aber von ihr wie ein Puzzle neu zusammengesetzt. Ob die Lehrerin dies nun richtig gemacht hat – der Urahn nicht doch nur ein Fiebertraum ist und er nie im Orient gewesen war - ist, wenn man das Buch zu Ende gelesen hat, nicht mehr mit Sicherheit zu sagen. Dieser Ambrosius Arimond behauptete – gibt es Ähnliches nicht schon bei Diogenes? - , „der Mensch sei ein Vogel, der nicht mehr fliegen könne, denn ein Vogel ohne Federn hätte eine Gestalt, die einem nackten, nach vorn gebeugten Menschen gleiche, unsere Haare bestünden wie die Vogelfedern aus Kreatin und unsere Sprache hätte nur das Singen verlernt“.
Vieles, sehr vieles taucht in diesem kleinen Roman als Möglichkeit auf, als Andeutung, wird dann aber nicht ausgeführt. Wer Wahrscheinlichkeit der Ereignisse innerhalb der Parameter von Raum und Zeit fordert, wird bei diesem Roman ins Grübeln kommen. Manche Konstellationen erscheinen sehr konstruiert. So zum Beispiel dass der Stubenkollege aus dem Lager der Lehrerin die Aufzeichnungen bringen kann, weil nicht nur Paul sondern auch er selbst als einst verstoßenes Heimkind sie kannte, weil sie also aus demselben winzigen Dorf, nicht größer als das Militärlager, in der Eifel stammen, ohne sich dort zuvor jedoch je begegnet zu sein. Und dass später Paul und die Lehrerin zur gleichen Zeit im Krankenhaus waren, wo er sie vielleicht vom Fenster gegenüber aus gesehen hat - wenn sie sich nicht täuscht.
Aber um Wahrscheinlichkeit geht es hier nicht, sondern um die Macht der Phantasie und die Sehnsucht nach dem, was bleibt und klar und schön ist. "Unser Leben ist nicht wie das der Vögel", heißt es einmal, "Wir können uns nie so sicher sein wie sie. Unsere Sprache vergeht, wir treffen nie die richtige Melodie, weil unsere Gedanken und Gewohnheiten sich zu schnell ändern". Und an anderer Stelle: "Sperlinge können, nachdem sie das Nest verlassen, sofort fliegen. Wir hingegen müssen alles erst lernen, selbst Kleinigkeiten." Das Buch handelt von jemandem, der das Leben nicht lernen wollte, sich stattdessen immer nach dem Fliegenkönnen sehnte. Sein Vater sprang einst, fast schon wie ein Vogel fliegend, über die Sichtschutzwand in den Tod. Ob Paul ihm gefolgt ist?
Elster lernen Menschenwörter. Sie grübelten über sie nach und stürben, wenn sie sie nicht verstünden. Denn auch Menschenwörter können zauberhaft sein – Norbert Scheuers jüngster Roman beweist das. Dafür wurde er dieses Jahr für den Belletristik-Preis der Leipziger Buchmesse nominiert.
Norbert Scheuer: „Die Sprache der Vögel“, C. H. Beck Verlag, München 2015 gebunden 238 S. 19,95 Euro