GÖTTINGEN. (hpd) "Einer neuen Wahrheit ist nichts schädlicher als ein alter Irrtum" heißt es irgendwo bei Goethe. Axel Meyer, Professor für Zoologie und Evolutionsbiologie an der Universität Konstanz und international ausgewiesener Genomforscher führt uns mit seinem Buch über die genetischen Grundlagen von Intelligenz und Geschlechtsunterschieden nachdrücklich die Weisheit des Goetheschen Sinnspruchs vor Augen.
Dabei ist die Wahrheit, dass nämlich Gene das Leben bestimmen, an sich gar nicht so neu. Neu sind aber die in den letzten Jahren und Jahrzehnten hinzugewonnen Einsichten über die Architektur des Genoms und die Rolle, die einzelne Gene bei der Ausprägung biologischer Merkmale haben – die der Intelligenz und der psychischen Geschlechtsmerkmale eingeschlossen. Trotz der immensen wissenschaftlichen Fortschritte auf diesem Gebiet, bleibt ein alter Irrtum - wie es scheint - ungebrochen in öffentlicher Meinung und Politik vorherrschend, nämlich dass genetische Ausstattungen getrost ignoriert werden können, wenn es um Ungleichheiten geht, sei es in Bildungserfolgen oder in den sozialen Rollen von Männern und Frauen in der Arbeitswelt oder im Privaten.
Axel Meyer baut sein Argument stringent auf. Es geht los mit einem Crash-Kurs in Genetik, der mit der Frage beginnt, was eigentlich Gene sind, und in dem uns von Kapitel zu Kapitel zunehmend mehr jener genetischen Komplexität vorgeführt und in einer gut lesbaren Sprache erläutert wird, die die Basis allen Lebens ist. Besondere Aufmerksamkeit widmet der Autor den Geschlechtschromosomen und insbesondere auch den regulativen Kaskaden, die dafür verantwortlich sind, dass aus befruchteten Einzellen entweder Frauen oder Männer entstehen, manchmal aber auch Personen, die sich nicht ganz so eindeutig einem biologischen Geschlecht zuordnen lassen.
Nach einem drei Kapitel langen Exkurs in die Soziobiologie und einer Erörterung der Frage, welche evolutionären Hintergründe geschlechtliche Differenzierung wohl haben mag, und wie sich diese Hintergründe in der Lebenspraxis von Partnerwahl und Fortpflanzung auch von Homo sapiens niederschlägt, kommt es zu einer Engführung dessen, was wir aus den ersten Kapiteln gelernt haben, auf die genetischen (oder genauer: biologischen) Grundlagen von Intelligenz- und Geschlechtsunterschieden.
Das Buch schließt ab mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für mehr wissenschaftliche Informiertheit in gesellschaftlichen Diskursen, insbesondere in Bezug auf die von Meyer aufs Schärfste kritisierten Auswüchse radikal konstruktivistischer Gender-Debatten.
Der Verfasser ist ein erfahrener Publizist, der es hervorragend versteht, auch komplizierte Sachverhalte der molekularen Genetik dem Leser in verdaubarer Form anzubieten. Er tut dies auf der Grundlage neuester und allerneuester Forschungsergebnisse, und deshalb ist sein Buch nicht nur für den aufgeschlossenen Laien von größtem Interesse, sondern auch für den biologisch vorgebildeten Leser, der dankbar dafür sein dürfte, die rasante Entwicklung der einschlägigen Forschung in kompakter Aktualisierung vermittelt zu bekommen.
Das Buch wird sehr kontrovers diskutiert werden, weil es mit Betonung der Gene eindeutig Stellung bezieht und in aller Klarheit die Position der Natur in der nicht enden wollenden Natur/Kultur-Debatte stark macht. Dabei vertritt Axel Meyer nicht einmal eine extreme Form eines genetischen Determinismus, denn er anerkennt Grenzen seines Ansatzes, indem er die Kultur durchaus als möglichen Faktor für die Entstehung von Unterschieden in persönlichen Merkmalsausprägungen zulässt.
Prof. Dr. Axel Meyer zählt zu den meist zitierten Biologen der Gegenwart. Er studierte an den Universitäten Marburg, Kiel, Miami und Berkeley. Nach dem Studium arbeitete er als Postdoc bei Allan C. Wilson an der University of California at Berkeley im Fachbereich für Biochemie. 1990 wurde er Assistant Professor an der State University of New York at Stony Brook am Department für Ökologie und Evolution. Dort wurde er 1993 zum Associate Professor ernannt. Die Universität Konstanz berief ihn 1997 auf den Lehrstuhl für Zoologie und Evolutionsbiologie. Er ist Beirat der Giordano Bruno Stiftung.
Eine scharfe Grenzziehung zwischen dem, was im geschlechtstypischen Denken, Fühlen und Handeln ursächlich der Natur beziehungsweise der Kultur zugeschrieben wird, gelingt freilich nicht. Was nicht überraschen kann, denn das Verhältnis von Biologie und Kultur ist nicht als additives, sondern als ein synergetisches zu denken. Das Scharnier zwischen beidem wird mit dem Begriff der "Gen/Umweltinteraktion" angedeutet. Ich bedauere ein wenig, dass Axel Meyer bei der Behandlung der Gen-Umweltinteraktion nicht expliziter geworden ist und dem Leser nicht konkret ausbuchstabiert, wie man sich diese Interaktion vorzustellen hat. Solange hier nicht Klarheit hergestellt ist, können beide Parteien, die "Biologisten" und die "Kulturisten", von sich behaupten, die entscheidende Determinante von Geschlechts- und Intelligenzunterschieden im Blick zu haben, während der jeweils anderen Seite eine unspezifische und deshalb letztlich unbedeutende Nebenrolle in diesem Interaktionsgeschehen zugewiesen wird. Ergebnis dessen wäre ein lähmendes Patt.
Die Debatte ließe sich zuspitzen, wenn man berücksichtigt, dass Gene und Kultur eben nicht gleichberechtigt nebeneinander stehen (was die Rede von Interaktion zwar suggeriert, aber keinesfalls meint). In Anbetracht der geradezu trivialen Beobachtung, dass es erst die Gene und ihre Produkte sind, die es der Umwelt ermöglichen, ihre kreativen Einflüsse auszuüben, könnte man mit einigem Recht diskutieren, ob nicht der kulturelle Einfluss selbst genetisch reguliert wird. Vieles spricht dafür, denn bekanntlich kann ein und dasselbe Lebensereignis für den Einen mit traumatischen Folgen verbunden sein, für einen Anderen aber nicht. Wie wir die Umwelt verarbeiten und welchen Einfluss wir ihr auf unsere Entwicklung erlauben, hängt von dem ab, was metaphorisch als "Gene der Umwelt" bezeichnet wurde. Im englischen ist in diesem Zusammenhang auch von differential susceptibility die Rede.
Die genetische Regulation der Umweltsensibilität unterliegt natürlich auch den Regeln der Vererbung. In langen Ausleseprozessen ist sie auf reproduktive Fitness hin ausgerichtet worden, was die Frage aufwirft, was dann noch mit der heiß umkämpften Natur/Kultur-Grenze sinnvoller Weise gemeint sein könnte. Jungen "wissen" von Geburt an, dass sie männlich sind, und Mädchen "wissen" von Geburt an, dass sie weiblich sind, und sie werden ihre jeweilige Umwelt, die kulturelle eingeschlossen, so selektiv nutzen und sich von ihr in ihrer geschlechtstypischen Entwicklung informieren lassen wie es ihre Gene für das jeweilige Geschlecht vorsehen. Kann man derartige Entwicklungsprozesse wirklich als "Interaktion" bezeichnen?
In dieser Sicht macht es einen Riesenunterschied, ob man nach der genetischen Grundlage von Merkmalen fragt oder nach der genetischen Grundlage von Unterschieden zwischen Merkmalen. Ein Unterschied, der in der Gender-Debatte leider nicht immer klar berücksichtigt wird. Trotz Anerkennung der Einlassung von Gender Studies Vertretern, dass Geschlechterrollen kulturell sehr verschieden interpretiert werden können und ihnen deshalb Plastizität inhärent ist, würden wir uns mit dieser Auslegung der Gen/Umwelt-Interaktion in einer perfekt Darwinischen Welt bewegen. Kulturelle Vielfalt und kulturelle Einflüsse auf Merkmalsausprägungen, ob nun in der Intelligenz, den Geschlechterprofilen oder sonst wo, sind eben keine gültigen Argumente für eine “anti-genetische” Sicht auf die Dinge.
Diese Interpretation des genetischen Determinismus macht im Übrigen auch Schluss mit dem "kreationistischen Manifest" vieler Kulturwissenschaftler. Denn auf die Frage, wenn die Kultur den Menschen macht, wer oder was dann eigentlich die Kultur macht – eine Frage, auf die Kulturwissenschaftler keine Antwort kennen - gibt es eine naturwissenschaftliche Antwort. Es ist "natürlich" der biologisch evolvierte Mensch mit seinen in langen Darwinischen Ausleseprozessen bewährten Präferenzen, Strategien und Interessen, und in letzter Analyse ist es die Erbinformation, das Material der Evolution, das hier die Regie übernimmt.
Axel Meyer reibt sich an der political correctness unserer Zeit. Im Schlusskapitel schreibt er sich (aus guten Gründen) regelrecht in Rage, wenn es darum geht, der Naturwissenschaft Primat bei der Klärung der Frage einzuräumen, was ist und was nicht - und an dem Primat auch dann nicht zu rütteln, wenn es um Themen wie Intelligenz und Geschlechterunterschiede geht – um Themen also, die besondere ideologische Aufmerksamkeit finden und emotional stark besetzt sind. Wissenschaft ist korrigierbar, Ideologie nicht (oder zumindest nicht im gleichen Maße). Gerade deshalb sind die alten Irrtümer ja so nachhaltig schädlich, und deshalb muss Wissenschaft gelegentlich unmoralisch sein, wenn sie gute Wissenschaft sein will und sich der Wahrheitsfindung verpflichtet fühlt.
Evolution sei dank, dass Axel Meyer ganz offensichtlich des "Selbstbewusstseinsgen" mitbekommen hat, Unmoralität auszuhalten und seine, die wissenschaftliche Sicht auf die Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen. Denn seit der Aufklärung gilt: Zu wissen ist immer besser als nicht zu wissen.
Adams Apfel und Evas Erbe – Wie die Gene unser Leben bestimmen und warum Frauen anders sind als Männer. Von Axel Meyer. München (C. Bertelsmann) 2015, 19,99 Euro






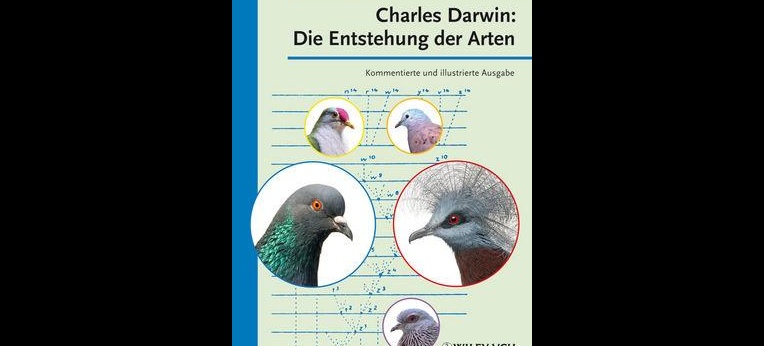
6 Kommentare
Kommentare
Franz Gillinger am Permanenter Link
"Denn auf die Frage, wenn die Kultur den Menschen macht, wer oder was dann eigentlich die Kultur macht – eine Frage, auf die Kulturwissenschaftler keine Antwort kennen - gibt es eine naturwissenschaftliche Antwor
Petra Pausch am Permanenter Link
Sie sind ganz offensichtlich nicht in der Lage, sich auch nur halbherzig darauf einzulassen, etwas Neues zu lernen. Das, was Sie hier unterstellen, steht in keiner Zeile des Buches.
Franz Gillinger am Permanenter Link
Das hab ich auch nicht behauptet - ich hab es aus der Rezension entnommen. - Und was Weiterbildung betrifft, da wissen Sie nicht das Geringste über meine Art und Form, also kann ich auf Unterstellungen verzichten.
MfG
Little Louis am Permanenter Link
Was aber,
wenn ".... kulturelle Einflüsse auf Merkmalsausprägungen.." (Zit.) durch "epigenetische" Mechanismen letztendlich doch "genetisch fixiert werden können??
Sascha Laubeiter am Permanenter Link
Der Autor der Rezension, Prof. Voland, ist im Beirat der Giordano Bruno Gesellschaft. Im Beirat der Giordano Bruno Gesellschaft ist auch der Autor des rezensierten Buches, Prof. Meyer.
Frank Nicolai am Permanenter Link
Der Vorwurf ist nicht so recht fair.