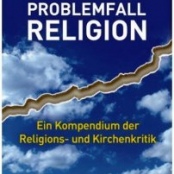WEIMAR. (hpd) Kurt Flasch (geb. 1930 in Mainz) ist emeritierter Philosophiehistoriker mit Spezialisierung auf Spätantike und Mittelalter. Als Lehrstuhlinhaber in Bochum oder als Gastprofessor an der Pariser Sorbonne befasste er sich eingehend u.a. mit den Werken des Augustinus von Hippo. Seine Sicht der intellektuellen Entwicklungen in der europäischen Philosophie faßte er 1994/95 in seinen Abschiedsvorlesungen “Warum ich nicht mehr Christ sein kann” zusammen.
Diese bilden die Grundlage für sein 2013 vorgelegtes Buch “Warum ich kein Christ bin” – das mittlerweile bereits in fünfter Auflage vorliegt. Dennoch richtet sich dieses Buch nicht an die Fachwelt, sondern an breiteste Leserschichten. Mit wissenschaftlicher Akribie begründet Flasch darin seine ihm sicherlich nicht einfach gefallene Abkehr von Christentum und christlichen Kirchen.
So stellt er zunächst klar, dass sein “Auszug wenig mit dem Zustand der Kirchen, aber viel mit ihrem Anspruch auf Wahrheit zu tun” habe. (S. 9) Nicht die Missbrauchsskandale, nicht die Protzbauten von Prälaten und auch nicht die Kirchensteuer seien der Grund, sondern die kirchliche Lehre an sich. Wobei es ihm nicht um Religion im allgemeinen geht, sondern um klerikale Ansprüche im Hier und Heute: “Sie fordern öffentlich politischen und gesellschaftlichen Einfluß, z.B. auf die Gesetzgebung des Bundestages, auf die Gesundheits-, die Schul- und Medienpolitik.” (S. 10)
Flasch stellt zunächst die Frage “Was heißt hier ‘Christ’?” und konstatiert, dass sich die Mitglieder christlicher Konfessionen auf die verschiedensten Arten definieren würden. Er könne sich mit keiner dieser Definitionen anfreunden, zumal man “an der Eigentumslosigkeit, also am Liebeskommunismus, die Christen schon lange nicht mehr erkennen” könne. (S. 25)
Der Autor beginnt mit einem autobiographischen Abriss und teilt mit, dass er in einer Familie praktizierender Katholiken aufgewachsen ist und bereits als Kind und Jugendlicher in Gesprächsrunden von Laien, Priestern und sogar Bischöfen einbezogen wurde. Diese Menschen erlebte er als sehr honorig, die ihm viel für seinen Lebensweg mitgaben. Dennoch, anderes erlebte er stärker: “Freilich wurde mir schon in den fünfziger Jahren klar: Die privilegierte Stellung der Kirchen in der frühen Bundesrepublik beruhte auf einer Lebenslüge, sie hätten insgesamt Widerstand gegen die Nazis geleistet. Aber die Kirchen als Körperschaften haben mich wenig interessiert, mich beschäftigte das, was ihr Inhalt sein sollte und es selten genug war, nämlich die Frage: Ist das Christentum wahr?” (S. 30)
Flasch wendet sich im ersten Kapitel den historischen Umbrüchen und intellektuellen Entwicklungen seit der Aufklärung und Napoleon zu. Und geht dabei auf den Beginn der historisch-kritischen Bibelforschung ein und damit auf die neuen Glaubensbegründungen seit dem 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart: “Christliche Wortführer von heute präsentieren ihr Christentum gern als den Erlebnisinhalt: Religion der Liebe. Dann sagen sie, das einzig Wesentliche sei die Liebe zu Gott und dem Nächsten.” (S. 72) Der Autor antwortet: “Das sind höchst diskutable Annahmen. [Der Christ; SRK] setzt voraus, daß sein Gott existiert. Nehmen wir an, es gäbe keinen Gott, dann wäre die Forderung nach Gottesliebe wenig sinnvoll. (…) Gottes Liebe wird in Zusammenhänge gestellt, in die sie argumentativ nicht gehört.” (S. 72) Flasch merkt an, dass z.B. in den Evangelien bei Jesus-Zitaten an keiner Stelle davon die Rede ist, dass Gott die Liebe sei.
Kapitel II ist überschrieben mit “Der wahre Glaube”. Flasch beginnt mit Ausführungen zum Wahrheitsbegriff und schreibt mit Bezug auf Religionen: “Der ‘Realismus’ im Wahrheitskonzept religiöser Reden erzeugt folgenden Zwiespalt: unwahrscheinlich oft haben Glaubensverkünder zuerst den Tatsachencharakter ihrer Geschichten behauptet und breiteten dann, von Argumenten gegen das Unwahrscheinliche bedrängt, den Schleier der Bildhaftigkeit über das früher als faktisch Behauptete. Was sie zunächst als ‘real passiert’ gepredigt haben, reduzierten sie zuletzt auf ein ‘Zeichen’.” (S. 86)
Wie “wahr” biblische Geschichten sind, das macht Flasch ganz lapidar mit dieser Feststellung klar: “Schon im ‘Neuen Testament’ stellen die Schriftsteller, die Jesus nie gesehen haben, sich als Augen und Ohrenzeugen vor.” (S. 88) Davon ausgehend sucht der Autor Antworten auf Fragen wie: “Muß Religion wahr sein?”; “Woran erkennt man die wahre Religion?” und was ist “heute religiöse Wahrheit”?“ Eine seiner Antworten lautet, auch mit Blick auf ”Ratzingers feine Sprache“: “Kirchen wollen, daß sie eine göttliche Wahrheit für alle vermitteln.” (S. 108) Denn darauf gründe sich der universale Machtanspruch des Klerus. Mit seinen Ausführungen will er aber auch helfen, zu einem klareren Begriff des ”Fundamentalismus" zu kommen. Fundamentalismus sei übrigens allen monotheistischen Religionen eigen und nicht nur dem Islam.
In Kapitel III geht Flasch auf den Komplex “Weissagungen und Wunder” sowohl im “Alten” als auch im “Neuen Testament” ein und stellt fest: “die christliche Religion ohne Wunder gibt es nicht. (…) es gibt irdisch-reale Interessen derer, die sie erzählen.” (S. 119) Denn mit ihnen wurden seit der Spätantike und besonders im Feudalismus Eigentumsansprüche, staatliche Machtansprüche und Privilegien des Klerus begründet.
Ausführlich schreibt Flasch über das “Wunder der Auferstehung”, das “das zentrale Ereignis christlichen Glaubens” sei. Dazu untersucht er die Texte der “Neuen Testaments”. Allerdings würden sich diese Berichte über das angebliche Ereignis nicht decken, sondern einander sogar widersprechen.
In den Kapiteln IV (“Gott”) und V (“… und die Welt”) wendet der Autor sich den Hauptinhalten des christlichen Glaubens sowie dessen Verhältnis zur Welt zu. Ausführlich geht es um die diversen angeblichen Gottesbeweise und um das alte Problem der Theodizee, also dem Widerspruch zwischen dem Übel in der Welt und dem guten und allmächtigen ‘Gott’ der Christen.
Er beginnt der Frage, wie man “Gott” definiere bzw. definieren wolle. Er unterscheidet dabei den “Gott der Philosophen” von dem biblischen “Gott der Väter”. Zu beiden schreibt Flasch kurz und bündig: “Denn Gott hat niemand je gesehen.” (S. 146) Und er schreibt insbesondere zum Gott der Bibel, dass alle Erzählungen über diesen doch sehr differieren würden.
Auch wenn Flasch sich in seinem Buch speziell dem Gott der Bibel, dem Gott der Juden und der Christen, zuwendet, so unterstellt er jedoch auch anderen religiösen Auffassungen (Naturreligionen, polytheistischen Religionen) den Begriff “Gott” anstelle des richtigeren Begriffs “Götter”. In dieser Frage ist er leider zu sehr dem mediterranen Monothismus mit “Gott” verhaftet und verkennt damit das Denken anderer Kulturkreise.