Am 20. Februar begann – kurz nach dem Prozess gegen Dr. Spittler – ein weiterer gegen einen ärztlichen Suizidhelfer wegen Totschlags. Auch Dr. Turowski soll gegen den Facharztstandard zur Sicherung der Freiverantwortlichkeit verstoßen haben. Wie dieser überhaupt definiert werden kann, soll ein interdisziplinärer Ansatz und eine erste ärztliche Fortbildung für unterschiedliche Kontexte nun klären helfen.
Ärztliche Hilfe zum Suizid ist straffrei, wenn sich jemand aus freiem Willen das Leben nehmen will. Was aber, wenn jemand eine psychische Störung hat, dabei aber kognitiv uneingeschränkt und auch arbeitsfähig ist? Wäre dann eine freie Entscheidung unbeeinflusst davon im Einzelfall durchaus, allenfalls vielleicht oder aber gar nicht möglich? Die 40. Strafkammer des Landgerichts Berlin wirft dem Allgemeinmediziner und ehemaligen Hausarzt Dr. Christoph Turowski (74) vor, einer chronisch an Depression leidenden Patientin zweimal Mittel zur Selbsttötung überlassen zu haben. Die Ärzte Zeitung vom 19. Februar stellt den Fall so dar:
"Laut Anklage überließ der Arzt der Frau im Juni 2021 in ihrer Berliner Wohnung 80 Tabletten mit einem tödlichen Wirkstoff, die sie in seinem Beisein eingenommen habe. Der Angeklagte sei auch nach der Einnahme in der Wohnung der Frau geblieben. Die Frau habe aber überlebt, da sie die Tabletten wenige Stunden nach der Einnahme erbrochen habe. Am 12. Juli 2021 habe er der Frau dann in einem Hotelzimmer eine Infusion mit einem anderen tödlich wirkenden Medikament gelegt. Die Frau habe die Infusion selbst in Gang gesetzt. Kurz darauf sei sie daran gestorben."
Die Liste ließe sich fortsetzen
Vor knapp drei Woche erst hatte das Landgericht Essen in einem ähnlichen Fall den Arzt Dr. Johannes Spittler zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Im Online-Medium Tagesspiegel Background Gesundheit & E-Health vom 12. Februar wird die gegenwärtige Situation so beschrieben: "In Brandenburg wiederum wird aktuell gegen einen Arzt im Ruhestand ermittelt, der als Sterbehelfer tätig war und im Verdacht steht, die Freiverantwortlichkeit eines Suizidenten, der sich ihm anvertraut hatte, nicht ausreichend geprüft zu haben. Die Liste ließe sich fortsetzen." Betroffene würden von wachsender Verunsicherung berichten: "Menschen in existenziellen Krisen wissen oft nicht, wem sie sich anvertrauen können, Adressen potenzieller Sterbehelfer werden wie Geheimwissen gehandelt. Überforderte Ärzte treffen einsame Entscheidungen, Sterbehilfevereine definieren eigenmächtig Normen für Qualitätsansprüche an Gutachter und Methoden."
Unterdessen haben medizinische Fachgesellschaften die Eigeninitiative ergriffen. Darunter sind einerseits die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) und andererseits die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN). Beide sprechen für höchst unterschiedliche Zielgruppen ihrer Patient*innen und vertreten jeweils eine eher liberale oder aber "psychiatrisch-restriktive" Position. Andreas Hochhaus, Geschäftsführender Vorsitzender der DGHO, erläutert, deren Mitglieder beklagten Unsicherheiten "beim Umgang mit Sterbewünschen bei unheilbar an Krebs Erkrankten und sehen deshalb einen erheblichen Bedarf für professionelle und interdisziplinäre Empfehlungen".
Unendliche Geschichte und Initiative zur ärztlichen Fortbildung
Das Bemühen um verbindliche Regulierungen, wozu etwa ein Vier-Augen-Prinzip von zwei Ärzt*innen zählen könnte, wird zunehmend zu einer "Geschichte ohne Ende" – so lautete die Anmoderation in der jüngsten Debatte zum Thema "Geht's ohne Gesetz besser – oder wie geht's weiter?" mit der FDP-Politikerin Katrin Helling-Plahr. Jedenfalls besteht Bedarf für – dabei keinesfalls ausschließlich aus psychiatrischer Sicht – erstellte Leitlinien, zumal es nach einer als zu baldigen gesetzlichen Regelung nicht aussieht.
Entscheidend sei, dass die Leitlinie interdisziplinär entwickelt werde, betont Prof. Jan Schildmann, Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin an der Universität Halle. Er führt im Tagesspiegel aus, Grund hierfür seien die unterschiedlichen klinischen Kontexte, in denen Suizidhilfe angefragt werde. "Die Situation von Patientinnen und Patienten mit einer lebensbegrenzenden Krebserkrankung unterscheidet sich beispielsweise von der eines hochaltrigen Menschen in einer Pflegeeinrichtung". Ein zweiter wichtiger Grund seien "unterschiedliche professionsethische Haltungen in den verschiedenen Fachgesellschaften". Es gebe allerdings gemeinsame Kriterien, die in allen Situationen erfüllt sein müssten: "Wichtig sind hier die Prüfung des Informationsverständnisses hinsichtlich der Handlungsoptionen und ihrer Konsequenzen, die Fähigkeit, diese Informationen vor dem Hintergrund persönlicher Werthaltungen abzuwägen sowie die Kommunikation einer Entscheidung".
Die Entwicklung eines Instruments zur Testung der Freiverantwortlichkeit bei Anfragen nach Suizidassistenz, verrät Schildmann, sei aktuell auch Gegenstand der Forschung und bereits einer (kostenfreien) Online-Fortbildung am 12. April, 15:30 – 17:30 Uhr. Aus dem Veranstaltungstext: "Anfragen nach Assistenz bei der Selbsttötung werfen bei Ärztinnen und Ärzten sowie Vertretern weiterer Gesundheitsberufe Fragen zum professionellen und rechtssicheren Umgang auf. Gegenstand dieser praktisch orientierten Fortbildung sind Statements aus unterschiedlicher fachlicher Perspektive und die gemeinsame Diskussion möglicher Kriterien einer verantwortbaren Praxis."
Anmeldung für alle Interessierten unter geschichte.ethik[at]uk-halle.de.




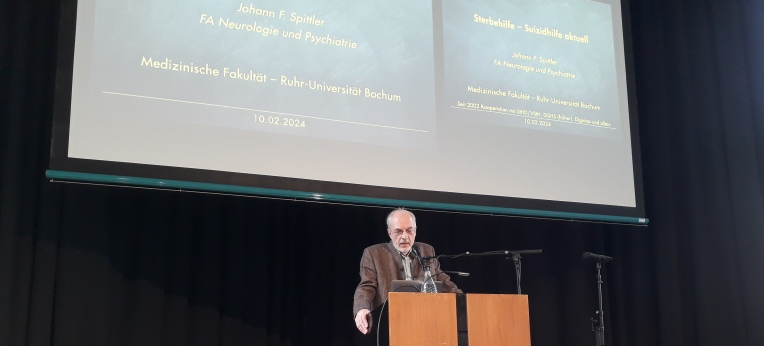





3 Kommentare
Kommentare
Gerhard Baierlein am Permanenter Link
Auch zu diesem Thema kann man ein blockieren der Kirchen für eine Menschliche Gesetzgebung erkennen.
Da ist noch viel Handlungsbedarf für Vernunft vorhanden.
Rainer Haselberger am Permanenter Link
Die deutsche Situation ist eine Katastrophe für Ärzte und verzweifelte Leidende!
Wo bleibt da die Würde des todgeweihten Menschen?
Christian Walther am Permanenter Link
Im vorliegenden Beitrag wird u.a. auf aktuelle Bemühungen hingewiesen, ÄrztInnen eine bessere Orientierung für die Beurteilung der Freiverantwortlichkeit zu geben. In unserem Land hätte man sich darum - z.B.
Somit überrascht es nicht, dass die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) bereits 2019 Empfehlungen zur „Urteilsfähigkeit in der medizinischen Praxis“ veröffentlicht hat (frei über das Internet erhältlich). Deren Perspektive wird allerdings sehr vorsichtig formuliert, wie die nachfolgenden Zitate zeigen: “Die Frage, wie Urteilsfähigkeit am besten evaluiert werden soll, ist Gegenstand kontroverser Diskussionen. So gibt es unterschiedliche Auffassungen wie stark kognitive Elemente gewichtet werden sollten.“ „Die Richtlinien selbst gehen nicht vom Konzept aus, die Urteilsfähigkeit sei ein objektiv feststellbarer Befund. Vielmehr wird die Urteilsfähigkeit definiert als ein reflektiertes Werturteil des Evaluierenden gestützt auf empirische Fakten zum Denken und Fühlen des Patienten.“ Vielleicht kommt diese Zurückhaltung in Deutschland gar nicht so gut an – aber warten wir ab, bis Ergebnisse der o.a. Bemühungen vorliegen.
Christian Walther, Marburg